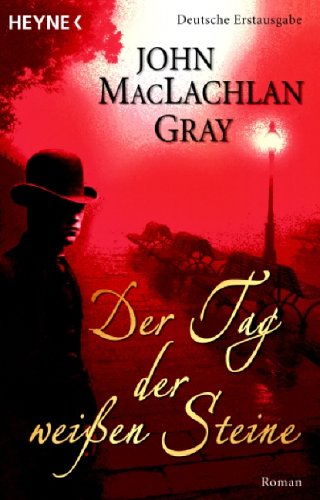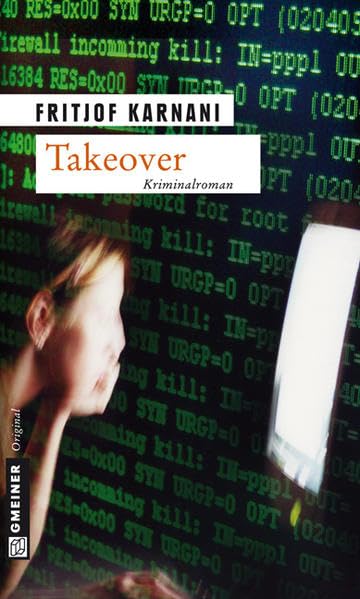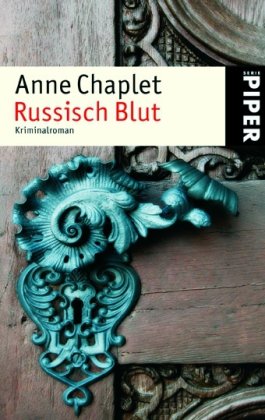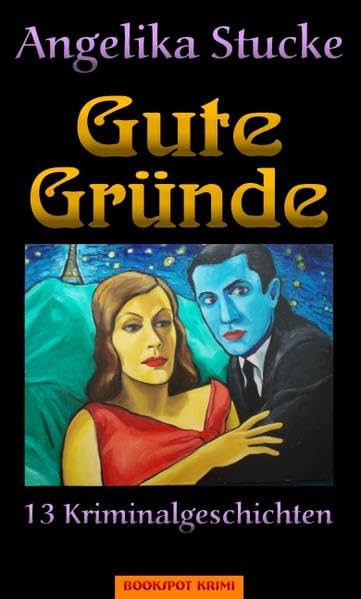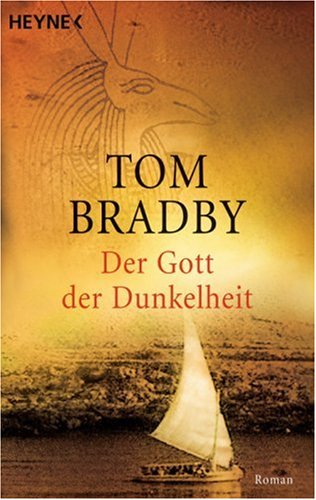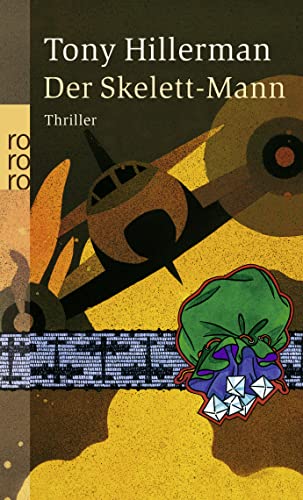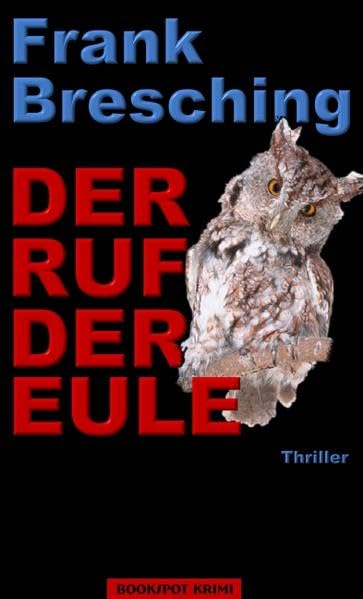Victor Gunn – Schritte des Todes weiterlesen
Archiv der Kategorie: Thriller & Krimis
Richard Laymon – Die Insel
Die Schwestern Kimberly und Thelma sowie ihre Gatten Keith und Wesley haben ihrem Schwiegervater, dem reichen Geschäftsmann Andrew Collins, und seiner Ehefrau Billie zum Geburtstag eine Seereise nach den Bahamas geschenkt. Sie kommen mit und haben auch die jüngste Tochter Constance sowie deren Freund Rupert Conway eingeladen.
Die Reise endet katastrophal: Während sich die Familie und Rupert auf einer unbewohnten Insel tummeln, fliegt die Jacht, auf der sie reisen, samt ‚Kapitän‘ Wesley in die Luft. Die Überlebenden sind ohne Funkgerät gestrandet. Niemand weiß, wo sie sich aufhalten, was eine Suche stark erschweren oder gar unmöglich machen wird.
Andrew, ein ehemaliger Offizier, übernimmt das Kommando. Seine Familie ist nur bedingt kooperativ; interne Spannungen sorgen für ständige Streitereien. Den Ernst des Schiffbruchs blendet man aus. Er ist ohnehin von nebensächlicher Bedeutung, wie sich herausstellt. In der Nacht verschwindet Keith spurlos; Rupert findet ihn später: Er hängt mit eingeschlagenem Schädel und einem Strick um den Hals an einem Baum.
Panik bricht aus. Wer hat Keith umgebracht? Lauert ein Killer auf der Insel? Ist es womöglich einer der Schiffbrüchigen? Hässliche, bisher sorgfältig verschwiegene Tatsachen kommen ans Tageslicht. Die Familie Collins ist einander nicht gerade grün. Andrew ist ein Patriarch, der seine Schwiegersöhne verachtet, die er – wohl zu Recht – verdächtigt, vor allem das Familienvermögen geheiratet zu haben.
Ist Wesley wirklich bei der Explosion umgekommen? Plant er Andrew und seine Familie nach und nach umzubringen, um dann das Collins-Erbe anzutreten? Arbeitet Gattin Thelma mit ihm zusammen? Viele Fragen tauchen auf, die es rasch zu klären gilt, denn der Killer legt keine Pause ein …
Die Welt ist einfach (und schlecht)
Viel Potenzial scheint Laymons Geschichte eigentlich nicht zu besitzen. Der Verfasser erzählt sie zudem in sehr einfachen Worten und geradlinig. Die Anzahl der möglichen Plotvarianten scheint begrenzt. Aber man darf sich nicht täuschen lassen. Laymon entpuppt sich als Meister im Legen falscher Fährten. Der Purist wird ihm im Verlauf der Lektüre faule Tricks vorwerfen, denn Laymon schreckt nie davor zurück, das Plotgerüst dreist ins Wanken zu bringen.
Plötzlich bringt er völlig neue und unerwartete Elemente in die Handlung ein. Unsere Vermutungen darüber, wer oder was sich hinter dem mörderischen Geschehen verbirgt, werden ad absurdum geführt: Der Verfasser legt uns aufs Kreuz, was freilich sein gutes Recht ist, zumal es funktioniert und der Handlung, die im Mittelteil gefährlich ins Schlingern gerät, eine neue Richtung gibt und belebt.
Dies ist außerdem ein weiterer der verfassertypisch garstigen Thriller, die mit der Geschwindigkeit und Unaufhaltsamkeit eines umstürzenden Mülleimers über seine Leser kommt. Man könnte den Plot minimalistisch nennen, denn er bedient sich einer Kulisse, die man durchaus als Klischee bezeichnen kann: die einsame Insel, umgeben vom Meer, das sich weder überqueren noch Rettung erwarten lässt. Freilich funktioniert diese Umgebung vorzüglich als Labor, in dem sich unter kontrollierten Bedingungen allerlei Experimente durchführen lassen.
Wieder einmal der Herr der Fliegen
Hier geht es um eine isolierte Gruppe von Menschen, die sich einer unbekannten Gefahr ausgesetzt sehen. Hinzu kommt die Tatsache der Strandung, ein Faktor, der den Stress der Situation erhöht, da niemand kommen wird, um die Versuchskaninchen vor brenzligen Situationen zu bewahren. Im Gegenteil: Der Ernst der Lage, d. h. in diesem Fall der Tod einiger oder sämtlicher Beteiligten, ist fest im Szenario einkalkuliert.
Das dritte und nicht geringste Problem ist die Uneinigkeit der Gestrandeten. Sie kennen einander seit Jahren und tragen viele ungelöste Konflikte mit sich herum. In der Zivilisation gibt es die Möglichkeit, einander aus dem Weg zu gehen. Auf der Insel wird man zu Nähe und Kooperation gezwungen. Allerdings stellt sich heraus, dass die verdrängten Probleme allzu groß sind; nicht einmal die unmittelbare Not, die Bedrohung durch einen unsichtbaren Killer kann für Abhilfe sorgen. Dass die Gruppe so rasch auseinander- und dann dem Mörder zum Opfer fällt, beruht vor allem auf den ständigen Streitigkeiten, die für eine Spaltung der Gruppe sorgen, deren Mitglieder so angreifbarer werden.
Wer Laymon und sein Werk kennt, wird nicht enttäuscht bzw. die bekannten Elemente finden. Der Autor nennt die Dinge beim Namen. Streit, Kampf, Folter und Mord finden selten im barmherzigen Zwielicht statt. Laymon richtet den Scheinwerfer auf die richtig hässlichen Dinge und schildert sie mit der ihm eigenen brutalen Deutlichkeit. „Gewaltpornografie“ nennen das seine Gegner und verdammen ihn; sie scheinen in ihrer Argumentation zu verdrängen, dass Pornografie primär Unterhaltung sein soll. Die Gewalt bei Laymon hat indes gar nichts Unterhaltsames an sich; sie ist schmutzig, blutig und eklig.
Die eigentliche Kritik richtet sich deshalb eher gegen die Tatsache, dass Laymons hässliche Schmuddelgeschichten spannend sind. „Die Insel“ gehört zwar nicht zu den besten Werken seines Verfassers, doch hat man sich erst eingelesen, will man auf jeden Fall wissen wie es weiter- und ausgeht. Ist das nicht ein praktikabler Maßstab für den Unterhaltungswert einer Geschichte?
Der Held als Widerling
Für die betont simple Sprache gibt es eine gute Begründung: „Die Insel“ ist kein ‚richtiger‘ Roman, sondern ein Tagebuch, das Rupert Conway über seine Tage als Schiffbrüchiger führt. Er ist ein 18-jähriger Mann, der weder wirklich erwachsen noch geistig eine Leuchte ist. Das gilt es berücksichtigen, wenn Rupert schreibt. Überhaupt darf nie vergessen werden, dass wir die Ereignisse stets durch den Filter der Rupertschen Schreibe erleben. Können wir ihm trauen? Er beteuert mehrfach die Wahrheit seiner Darstellung, doch da ist Ruperts Plan, seine Aufzeichnungen als Grundlage für einen späteren Roman zu nutzen. Er manipuliert also auf jeden Fall. Geht er so weit zu lügen, Geschehnisse zu verschweigen, zu verdrehen?
Rupert ist definitiv kein in sich ruhender Charakter. Er steckt noch tief in der Pubertät, ist mit mehreren attraktiven, chronisch leicht bekleideten Frauen auf einer Insel gefangen. Bald sind deren Ehemänner verschwunden; Rupert hat also theoretisch freie Bahn. Seine Gedanken kreisen unentwegt um Sex, nicht einmal Lebensgefahr und Tod können das ändern. Dieser Wesenszug lässt Rupert unsympathisch erscheinen. Er ist allerdings auch eine fabelhafte Tarnung für mögliche andere, finstere Beweggründe.
Mit Rupert auf der Insel sitzt der Collins-Clan fest, eine wahrlich schrecklich nette Familie, die hinter der polierten Oberschicht-Fassade nichts als Lügen, Intrigen, Unterdrückung und sogar Wahnsinn verbirgt. Die Isolation zwingt sie zusammen, die Tünche wird abgewaschen, die sorgsam unterdrücken Gefühlen brechen sich Bahn.
Das Element der Verunsicherung
Wer ist Täter, wer Opfer? Nicht nur Rupert wird in tiefe Verwirrung gestürzt. Immer wieder wechselt Laymon die Perspektiven. Scheinbar Tote tauchen quicklebendig wieder auf. Welches Spiel wird hier gespielt? War der Schiffbruch von Anfang an Teil einer irrsinnigen Familienintrige? Geschickt kappt Laymon jegliche Möglichkeit die Protagonisten in ‚Gut‘ und ‚Böse‘ einzuteilen. Er ist es, der allein die Fäden in der Schreibhand behält. Erst im Finale fallen die Masken.
Dabei hätte der Verfasser sicherlich raffen können. Vor allem im Mittelteil verzettelt sich Laymon in Streitigkeiten und Verfolgungsjagden, die letztlich Leerlauf darstellen, weil sie die eigentliche Handlung nicht voranbringen. „Die Insel“ ist ein rohes Werk, das über weite Strecken wie vom Verfasser ohne Nachbearbeitung zusammengehauen wirkt. Das mag gewollt sein, dürfte jedoch die Realität widerspiegeln, denn Laymon war ein überaus schreibfreudiger Schriftsteller, der in manchen Jahren vier Romane und zahlreiche Kurzgeschichten auf den Markt brachte. Man muss seinen ‚primitiven‘ Stil mögen, sonst wird man ihn ablehnen, was schade wäre, denn solange er seine Obsessionen im Griff behielt, konnte dieser Mann sein Garn spinnen, auch wenn es ziemlich blutig zu sein pflegte – oder man ihn ließ: In Deutschland dauerte es einige Zeit, bis die üblichen Tugendapostel auf Laymon aufmerksam wurden. Ab der 13. Auflage der „Insel“ schritt die Zensur (hier unter dem Deckmantel der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften) ein und ließ nicht wenige Passagen streichen oder ‚abschwächen‘ – eine Information, die Leser berücksichtigen sollten, wenn sie Lektüre ohne Fremdeingriffe vorziehen.
Autor
Richard Carl Laymon wurde 1947 in Chicago, Illinois, geboren, wo er auch aufwuchs. Ein Studium in Englischer Literatur begann er an der Willamette University, Oregon, und schloss es mit einem Magistertitel an der Loyola University, Los Angeles, ab. Anschließend arbeitete Laymon u. a. als Schullehrer, Bibliothekar sowie Rechercheur für eine Anwaltskanzlei.
Als Schriftsteller debütierte Laymon 1980 mit den Psychothrillern „Your Secret Admirer“ und „The Cellar“ (dt. „Haus der Schrecken“/„Im Keller“). In den folgenden beiden Jahrzehnten veröffentlichte er mehr als 60 Romane und zahlreiche Kurzgeschichten. Dabei beschränkte er sich nicht auf die Genres Horror und Thriller, sondern schrieb u. a. auch Romanzen oder Westernromane. Laymons Erfolg hielt sich in den USA lange in Grenzen; seine eigentliche Fangemeinde hielt ihm in Europa die Treue. Dafür dürften seine ungeschminkt derben und an blutigen Effekten nicht sparenden, die puritanische Sexfurcht der US-Gesellschaft ignorierenden und anklagenden Geschichten verantwortlich sein. Dennoch wurden Laymon-Werke mehrfach für renommierte Buchpreise nominiert. Im Jahre 2000 wurde „The Travelling Vampire Show“ (dt. „Die Show“) mit dem „Bram Stoker Award“ für den besten Horror-Roman des Jahres ausgezeichnet.
Den Preis konnte Richard Laymon nicht mehr selbst in Empfang nehmen. Er starb am 14. Februar 2001 an einem Herzanfall. Über sein Leben, vor allem jedoch über sein Werk informiert diese Website.
Taschenbuch: 559 Seiten
Originaltitel: Island (London : Headline Book Publishing Ltd 1995)
Übersetzung: Thomas A. Merk
http://www.randomhouse.de/heyne
eBook: 609 KB
ISBN-13: 978-3-641-02910-4
http://www.randomhouse.de/heyne
Der Autor vergibt: 



John MacLachlan Gray – Der Tag der weißen Steine
London im Jahre 1858: Sechs Jahre sind vergangen, seit Edmund Whitty, Sonderberichterstatter der Zeitung „Falcon“, eine zentrale Rolle bei der Entlarvung des Frauenmörders „Chokee Bill“ spielte. Viele Schlagzeilen und gutes Geld hat ihm dies beschert, doch die Tage des Ruhmes sind lange vorbei. Whitty steckt in einer Pechsträhne. Seit einiger Zeit schnappt ihm ausgerechnet sein erbitterter Konkurrent, Alastair Fraser, die Schlagzeilen weg. Seit Wochen hat Whitty keinen Artikel mehr verkaufen können und steckt in Geldnöten, die umso ernster sind, als er beim „Captain“, einem gefürchteten Wucherer, in der Kreide steht.
In seiner Not übernimmt Whitty einen dubiosen Auftrag: Für einen Detektiv aus den USA soll er das betrügerische Medium Bill Williams entlarven. Die Séance endet im Fiasko, als Williams plötzlich vom Geist David Whittys beherrscht zu sein scheint Sorgfältig hat der Journalist bisher verborgen halten können, dass sein vor sechs Jahren ertrunkener älterer Bruder in der Tat womöglich nicht einem Bootsunfall zum Opfer fiel. Woher kennt Williams die Familientragödie der Whittys? Und wieso wird Edmund wenig später ein Foto zugespielt, das David beim verbotenen Liebesspiel mit einer Minderjährigen zeigt? Soll Edmund erpresst werden? Lebt sein Bruder etwa noch? John MacLachlan Gray – Der Tag der weißen Steine weiterlesen
Karnani, Fritjof – Takeover
_Internetspannung auch im deutschen Krimi-Underground._
Viel gibt es leider nicht in Erfahrung zu bringen, über die Schriftstellerkarriere von Fritjof Karnani, wohl aber über seinen Lebensweg und die offensichtlichen Pfeiler seiner Inspiration: Als studierter Wirtschaftsingenieur und preistragender Spezialist in Sachen Unternehmensstrategien kennt er sich in einem aus: Wirtschaft und Politik. Dementsprechend spielt sich sein Krimi-Debüt vor genau jener Kulisse ab:
_Informationsterrorismus und Datenkidnapping._
Damit bekommt es Ferry Ranco zu tun, Chef der größten Provider-Firma Deutschlands: GermanNet. Bei GermanNet flattert eine höchst dringliche E-Mail ins Postfach, in der die Sicherheitsfirma X-SECURE davor warnt, dass gerade ein Hacker sämtliche Sicherheitsbarrieren durchbrochen hätte, so unmöglich das eigentlich sein müsste. Warum wird gerade Ferry Ranco angesprochen? Weil jeder Internetnutzer – auch jeder Hacker – eine sogenannte IP-Adresse hat, und da die entsprechende „Hacker-Adresse“ bei GermanNet angemeldet ist, kann GermanNet herausfinden, wer dieser Nutzer ist.
Jedenfalls, Ferry Ranco kümmert sich darum und findet über den Besitzer dieser IP-Adresse Erstaunliches heraus … Sein Interesse ist geweckt, er ruft einen alten Studienkollegen an, der sich mit dem Gebiet „Hacker“ auskennt, und bittet ihn um Hilfe. Die soll er auch bekommen, in Form einer gut aussehenden Studentin, die sich im Rahmen ihres Studiums mit diesem Thema befasst. Just zu diesem Zeitpunkt tritt Ferry ein mysteriöser Fremder gegenüber und warnt ihn davor, seine Nachforschungen zu vertiefen; als Ferry dem nicht nachkommt, verleiht der Fremde seinen Forderungen blutigen Nachdruck.
Ferry muss untertauchen, zusammen mit Judith, der hübschen Studentin; eine wunderbare Gelegenheit für Rolf Keller, am Stuhl seines verhassten Chefs zu sägen. Währenddessen werden wirtschaftliche und politische Größen immer wieder von einem mysteriösen Maximilian aufgesucht, der ihnen Informationen anbietet, die er eigentlich gar nicht haben dürfte.
_Drei Zutaten für einen explosiven Spannungscoctail._
Nummer eins: Das Syndikat, ein unsichtbarer Gegner mit Big-Brother-Auge auf alle IT-Vorgänge. Nummer zwei: Rolf Keller, ein Gegenspieler, der versucht, Ferry Ranco vom Thron seines Lebenswerks zu stoßen. Nummer drei: Karnanis ausgeprägtes Wissen über das Funktionieren des Internets und von wirtschaftlichen Großkonzernen.
Hätte Fritjof Karnani diese drei Zutaten nun mit Inbrunst durchgeschüttelt und eiskalt serviert, hätte man sich das Ergebnis mit wahrer Wonne und in einem Zug in die Kehle gießen können. Stattdessen aber verwässert er alles Potenzial mit lauwärmsten Klischees: Rolf Keller, der Gegenspieler von Ferry, hat als einzigen Grund für seine Intrigenspielereien nur den: Er mochte Ferry noch nie und wollte schon immer die Nummer eins sein. Er ist ein wahrer Sammelband an Rivalenklischees, raunzt seine Untergebenen an, schleimt bei den Geldgebern, packt unterstellten Sekretärinnen an die Hupen, um seine Macht zu beweisen und bekommt Büro-Randale-Anfälle, wenn nicht alles so läuft, wie er sich das vorstellt (was nie passiert, weil er kurzsichtig und dumm ist).
Dann gibt’s da noch den philosophischen Barkeeper, mit tief schürfenden Weisheiten wie: Man kann eher den Sinn des Lebens verstehen als die Frauen; es gibt den supersympathisch gut aussehenden Millionärs-Chef und die spitzenblondinige Chefsekretärin (ehemalige Miss Berlin). Der fehlende Tiefgang ist es ja gar nicht mal, es ist diese extremste Schwarz-Weiß-Malerei, die den Figuren alles Glaubwürdige raubt, eingebettet auch noch in vorhersehbarste Nebenhandlungen: Ferry, der Millionär, der schon lange aufgegeben hat, nach „der Richtigen“ zu suchen, trifft auf Judith, die hübsche Studentin, die seinem Charme interessanterweise nicht sogleich verfällt … Na? Eine Idee, wie’s weitergeht?
Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn die mysteriösen Datendiebe ihnen das Leben mit dem versprochenen blutigen Ernst erschweren würden, aber auch das: Pustekuchen. Sicher, „das Syndikat“, wie der Verein von Ferry genannt wird, treibt schon üble Spielchen, aber unser Protagonist bekommt davon selten etwas zu spüren, er hat seine Spuren gut verwischt und kann sich seinem persönlichen „Schlaflos in Seattle“ mit Judith hingeben, ohne sich vor den Nachstellungen des Syndikats fürchten zu müssen.
Das Syndikat übt dann eben anderweitig Druck auf Ferry aus: Es hilft Rolf Keller, am Stuhl seines verhassten Chefs zu sägen. Nun, das wäre spannend gewesen! Wenn Ferry Ranco nicht schon am Anfang des Buches mit dem Gedanken gespielt hätte, sich seinen Aktienanteil auszahlen zu lassen, um fortan im gut situierten Ruhestand zu leben – er hat nämlich gar keinen Bock mehr auf GermanNet!
Um es auf den Punkt zu bringen: Fritjof Karnani betreibt über die ganzen 268 Seiten geradezu vorsätzliche Konfliktflucht, die am Ende fast schon kriminelle Ausmaße annimmt. Mal ehrlich: Dieser Schluss ist eine Frechheit. Dazu werden alle aufgeworfenen Handlungsstränge auf Teufel komm raus zusammengezurrt. Seufz.
_Fehlzündung der Debütkanone._
Um meinen Standpunkt klar zu machen: Ich unterstütze den Underground, wo es nur geht, und hasse nichts mehr als auf dem „Nachwuchs“ herumzuhacken. Gerade in der Literaturszene hat es der deutsche Nachwuchs doppelt schwer, und kleine Verlage wie der |Gmeiner|-Verlag müssen sich zermürbende, wenig aussichtsreiche Schlachten mit den Marktgiganten liefern, die ihrerseits fremdsprachige Literatur dem Einheimischen bevorzugen.
Dementsprechend schmerzt es mich, „Takeover“ derartig in Grund und Boden zu stampfen. Aber es hilft nichts, aller Sympathiepunkte zum Trotz kann dieses Buch nicht überzeugen. Die 268 Seiten lesen sich flüssig, Karnanis Schreibe ist kompetent, kompakt und sein Insiderwissen weiß schon das eine oder andere Mal zu begeistern, aber die Story ist ein glatter Fehlschuss. Ein Per Helge Sørensen setzt „Takeover“ seinen hochspannenden Internet-Thrillern „Mailstorm“ und [„Intrigenspiel“ 1590 zum Frühstück vor. Und Fritjof Karnani gleich mit dazu. Da wurde Potenzial mit vollen Händen verschenkt.
http://www.gmeiner-verlag.de/
Chaplet, Anne – Russisch Blut
Anne Chaplet gehört zu den besten Krimiautorinnen Deutschlands und hat sich seit ihrem Debüt „Caruso singt nicht mehr“ eine große Fangemeinde erschrieben. Der Krimi „Russisch Blut“, den |Piper| 2006 als Taschenbuch herausbringt, kommt ohne das bekannte Ermittlerduo Paul Bremer und Karin Stark aus, spielt aber ebenfalls in einer ländlichen Gegend.
Die junge Tierärztin Katalina Cavic flieht vor Erlebnissen ihrer Vergangenheit in den verschlafenen Ort Blanckenburg, der seinen Namen dem barocken Schloss verdankt, das majetästisch auf einem Hügel thront. Allerdings wohnt dort kein Adel mehr, sondern eine Gruppe neureicher Menschen, die so gar nicht dorthin passen wollen. Da wäre Alex Kemper, ein erfolgreicher Anwalt, der ein Verhältnis mit seiner Schwägerin, der Kunsthistorikerin Sophie hat, Peer Gunderson, ein ein Banker, Erin, die Frau Kempers und die gute Seele Alma mit ihrer halbwüchsigen Tochter Noa.
Katalina, die erstmal im Schloss einen Schlafplatz findet, bevor sie in die alte Praxis im Ort ziehen kann, merkt sehr schnell, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Neben dem Verhältnis zwischen Alex und Sophie bereitet ihr vor allem eine Sache Kopfzerbrechen: Mysteriöse Lichtzeichen in einem stillgelegten Trakt des Schlosses. Schon bald findet sie heraus, dass Schloss Blanckenburg einen Bewohner mehr hat als geahnt und dass dieser, obwohl er sich gebrechlich gibt, es faustdick hinter den Ohren hat. Doch wie faustdick?, muss sie sich fragen, als der angesehene Archäologe Sigurd Rust, der auf Blanckenburg wertvolle Schätze vermutet hat, stirbt. Was treibt einen so angesehenen Wissenschaftler überhaupt nach Blanckenburg? Und was hat Kempers nervöse Friesenstute damit zutun?
Haben wir es hier wirklich mit einem „Kriminalroman“ zu tun? Gerade zu Anfang wirkt es doch ganz anders. Im ersten Teil des Buches wird nämlich zweistrangig erzählt. Neben Katalinas Perspektive, die sie bei ihrem Einzug und ihren ersten Schritten auf Schloss Blanckenburg begleitet, erzählt ein Mädchen namens Mathilde, das sich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs auf der Flucht befindet, von ihrem Alltag und von ihrer Zuflucht auf Schloss Blanckenburg. Allerdings gibt es zwischen diesen beiden Strängen keinen Knotenpunkt, was das Ganze etwas halbseiden erscheinen lässt.
Glücklicherweise konzentriert sich das Buch im weiteren Verlauf auf die aktuellen Geschehnisse rund um Katalina. Es geht dabei zumeist weniger um die Kriminalhandlung als um das Leben der Tierärztin und wie sie in dem neuen Ort aufgenommen wird. Die eine oder andere delikate Entdeckung der Vorgänge auf Blanckenburg und der Mord bringen etwas Würze ins Spiel. Allerdings verläuft die Handlung ein wenig im Sande. Die Spannungskurve will nicht so, wie sie soll, anders als man das sonst von Chaplet gewöhnt ist. Das könnte daran liegen, dass dieses Motiv mit dem Schloss und den Zugezogenen, die nicht ganz koscher sind, nicht gerade als neu bezeichnet werden kann.
Die Mischung aus Geschichte und Gegenwart ist auch nicht gerade frisch, hat allerdings in anderen Büchern schon besser funktioniert. Hier fehlt letztendlich einfach der Bezug der beiden Stränge, so dass der Leser das Buch nicht wirklich befriedigt schließen kann.
Was ebenfalls enttäuschend ist, sind in diesem Roman die Personen. Ich vermisse doch sehr die Tiefe und Persönlichkeit, die ich von der Autorin gewohnt bin. Stattdessen serviert sie uns besonders bei der Schlossbevölkerung das eine oder andere Klischee, was nun mal nicht die beste Leseempfehlung ist.
Der Schreibstil dagegen ist so lockerluftigleicht wie gewohnt und beschert ein sommerliches Lesevergnügen – wenn die Handlung und die Personen doch etwas besser gelungen wären …
http://www.piper.de
Peter Sander – Tod bei Tisch

Peter Sander – Tod bei Tisch weiterlesen
Massey, Sujata – Japanische Perlen
Ein Restaurant zu eröffnen, ist gar nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Diese Erfahrung muss auch Rei Shimura machen, die junge Halbjapanerin, die in Sujata Masseys Büchern die Hauptrolle spielt.
Allerdings ist es nicht Rei, die das Restaurant eröffnet. Rei, die mit ihrem Verlobten Hugh in Washington wohnt, seit sie ein Einreiseverbot in Japan hat, unterhält einen kleinen Antiquitätenhandel und bekommt den Auftrag, bei dem neuen asiatische Restaurant „Bento“ die Inneneinrichtung zu übernehmen. Froh über die Beschäftigung, wirft sie sich in die Arbeit und ist sehr zufrieden, als sie mit ihrer Cousine Kendall, einer eifrigen Spendensammlerin für den demokratischen Senator Harp Snowden, am Eröffnungstag dort speist. Allerdings verläuft der Abend anders als geplant. Als Kendall zum Telefonieren in den Hinterhof geht, wird sie entführt. Sie kann zwar unbeschadet befreit werden, aber die negativen Schlagzeilen interessiert das nicht.
Doch das ist nicht das Einzige, was im „Bento“ im Argen liegt. Eines Tages kommt die Angestellte Andrea auf Rei zu und bittet sie um Hilfe. Weil sie mitbekommen hat, wie gut Rei bei der Entführung ihrer Cousine gehandelt hat, glaubt sie, dass sie die Richtige wäre, um ihr bei der Suche nach ihrer asiatischen Mutter zu helfen. Sadoko, so der Name von Andreas Mutter, verschwand eines Tages spurlos, nachdem sie ihre zweijährige Tochter mit der Begründung, sie müsse schnell zum Arzt, bei Nachbarn abgegeben hatte. Man fand ihre Klamotten am Fluss, der durch ihren Wohnort floss, und Andreas Vater, ein amerikanischer Soldat, der seine Frau während des Vietnamkriegs kennen gelernt hatte, heiratete sehr bald eine alte Schulfreundin und gab Andrea zu Pflegeeltern.
Nun ist die junge Frau auf der Suche nach ihrer Mutter, die offiziell als vermisst gemeldet ist und von der man annimmt, dass sie verstorben ist. Doch Andrea glaubt nicht, dass es da mit rechten Dingen zugeht, und Reis Ermittlernase kann es nicht lassen, die Spur aufzunehmen. Ehe sie es sich versieht, steckt sie tiefer in mysteriösen Machenschaften drin, als ihr lieb ist…
„Japanische Perlen“ ist bereits das sechste Buch Masseys mit Rei Shimura. Sie bietet darin einen leicht bekömmlichen Mix aus fernöstlicher Exotik, Kriminalroman und Frauenlektüre. Ersteres basiert natürlich auf dem Thema des Buchs und auf Reis Herkunft. Ihre Mutter ist zwar Amerikanerin, aber Rei hat lange Zeit in Tokyo gewohnt und kennt sich mit der dortigen Kultur sehr gut aus, was auch immer wieder in die Geschichte einfließt. Zudem kommt in der Geschichte ihre Tante Norie zu Besuch, eine ältere, sehr hilfsbereite Dame, die sich mit der amerikanischen Kultur konfrontiert sieht und für das eine oder andere verschmitzte Grinsen sorgt.
„Kriminalroman“ steht nicht nur vorne auf dem Buch, sondern zeigt sich auch in der Handlung. Allerdings haben wir es hier weniger mit einem knallharten Ermittlerkrimi zu tun als viel mehr mit einem „Alltagskrimi“. Das spricht auf der einen Seite für die Autorin, weil es bedeutet, dass sie sehr authentisch schreibt. Auf der anderen Seite muss man aber auch damit rechnen, dass wir es hier nicht mit einem geladenen, actionreichen Buch zu tun haben, in dem auf jeder zweiten Seite Mord und Totschlag herrschen. Das sowieso nicht, denn Massey kommt ganz ohne Leiche aus. Ob das der Grund ist, dass es an einigen Stellen an Spannung fehlt? Allerdings ist es auch sehr erleichternd, dass Shimura-San keine übertriebene Ermittlerin, sondern auf dem Boden geblieben ist.
Was das Buch aber letztendlich zu einem Pageturner macht, ist der Frauenfaktor. Massey schreibt aus der Ich-Perspektive Rei Shimuras mit einer sehr einfachen und schönen Sprache, die subjektiv und manchmal humorvoll gefärbt ist. Sie spiegelt die japanische Freundlichkeit sehr schön wider und lässt dem Innenleben ihrer Protagonistin viel Raum, manchmal vielleicht sogar zu viel. Immerhin erspart sie uns übertriebene Sexszenen, auch wenn die Verlobung der guten Rei nicht zu kurz kommt. Sie schafft es, die Seiten so dicht zu füllen, dass sie zum Weiterlesen einladen und dazu noch nicht mal eine reißerische Menge Blut brauchen.
Letztendlich ist „Japanische Perlen“ wohl eher gute Unterhaltung als ein wirklicher Kriminalroman. Dazu erinnern die Protagonistin und der Schreibstil der Autorin zu sehr an einschlägige Frauenromane. Jedoch wird das Buch angenehm frei von Klischees gehalten, so dass es sich leicht lesen lässt und dank des Schreibstils auch mit einer geringen Menge Spannung auskommt, um dem Leser zu gefallen.
http://www.piper.de
Laymon, Richard – Insel, Die
Acht Reisende machen mit einer Jacht eine Urlaubsfahrt durch die Südsee. Plötzlich explodiert ihr Boot durch eine unbekannte Ursache. Dabei kommt offenbar Wesley, der an Bord gewesen ist, ums Leben. Der Rest von ihnen befand sich gerade zum Picknicken auf einer einsamen, nahe gelegenen Insel. Die Gruppe besteht aus Familie Collins und ihrem Anhang. Vater Andrew ist ein wohlhabender, pensionierter Marineoffizier, der trotz seiner sechzig Jahre noch relativ fit geblieben ist. Aus seiner ersten Ehe stammen die beiden Töchter Thelma und Kimberley. Die mollige und biedere Thelma ist Wesleys trauernde Witwe. Kimberley dagegen ist eine rassige Schönheit, der man ihr indianisches Blut ansieht. Sie ist verheiratet mit Keith, einem gut aussehenden Erfolgstypen. Billie ist Andrews zweite Frau, mit der er gerade den zwanzigsten Hochzeitstag feiert. Für ihr Alter ist die sehr weibliche Billie noch höchst attraktiv und dabei von sehr herzlicher Natur. Die Jüngste im Bunde ist Connie, die achtzehnjährige Tochter von Billie und Andrew, die zwar ebenfalls hübsch ist, aber weder die Attraktivität noch die Herzlichkeit ihrer Mutter besitzt. Den Abschluss bildet Connies Freund Rupert, den sie gerade an der Uni kennen gelernt hat. Obwohl die beiden ein paar Dates hatten, sind sie nicht richtig zusammen und streiten sich viel.
Auf der Insel versuchen die Überlebenden, sich so gut wie möglich mit ihren geborgenen Utensilien auszustatten, um bis zur Rettung durchzuhalten. Der literarisch ambitionierte Rupert beginnt gleich nach ihrer Ankunft, ein Tagebuch zu schreiben, das ihm später als Basis für einen Abenteuerroman dienen soll. Trotz der Katastrophe genießt der unerfahrene junge Mann das enge Beisammensein mit den schönen Frauen. Vor allem Kimberley und Billie faszinieren ihn, auch wenn er sich bemüht, seine Gefühle vor den anderen zu verbergen. Die Gruppe richtet sich ein Lager ein, fängt Fische und wechselt sich in der Nacht bei der Wache ab.
Am zweiten Tag jedoch geschieht ein Unglück: Keith ist während seiner Wache verschwunden. Nach kurzer Suche finden sie ihn aufgeknüpft im Dschungel, grausig zugerichtet und zweifelsfrei ermordet. Bis auf Thelma sind alle davon überzeugt, dass Wesley mit der Explosion seinen Tod nur vorgetäuscht hat und jetzt Jagd auf sie macht. Die Gruppe bewaffnet sich – doch kurz darauf wird erneut jemand aus ihrem Kreis ermordet. Ist es wirklich Wesley, der dahinter steckt? Was steckt als Motiv hinter den Morden? Wer von ihnen wird überleben? Für die Gestrandeten beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel auf Leben und Tod im tückischen Südseedschungel …
Eine Insel in der tropischen Südsee mag ein malerischer Schauplatz sein – allerdings nicht, wenn Richard Laymon die dazugehörige Handlung schrieb. Seine action- und gewaltgeladenen Horrorthriller werden derzeit endlich auch von deutschen Genrefans entdeckt und machen der |Heyne-Hardcore|-Reihe alle Ehre. Das galt bereits für [„Rache“ 2507 und erst recht für seine noch stärkere „Insel“, auch wenn kleine Mängel den Gesamteindruck trüben.
|Straffe Handlung, Spannung bis zum Schluss|
Mit einem „Heute ist die Jacht explodiert“ wird der Leser von der ersten Zeile an hineingerissen in eine turbulente Handlung, die an keiner Stelle Längen aufweist. Den Protagonisten bleibt kaum ein Moment zum müßigen Verweilen, jede Situation wift neue Fragen auf. Zunächst darf gerätselt werden, wie sie ihre Notlandung auf der offenbar unbewohnten Insel meistern; bald darauf folgt der erste Mord, der Schock, Verstörung und Unsicherheit nach sich zieht, wenig später der zweite Todesfall, die Jagd auf den Mörder, Lügen, Intrigen und Kämpfe ums nackte Überleben. Dem Leser stellt sich eine Reihe von Fragen, die ihn bei der Stange halten: Wer ist der kaltblütige Mörder, was für ein Motiv lässt ihn die Taten begehen, nach welchem Prinzip mordet er die Überlebenden, wer wird als nächster an die Reihe kommen, wird es Überlebende geben oder werden sie zuvor gerettet? Kaum etwas ist gewiss in diesem Strudel aus Wahnsinn, Gewalt und Grauen. Immer wenn man glaubt, dass sich eine ruhigere Phase ankündigt, wird man aufs Neue belehrt und eine überraschende Wendung wirft die Ereignisse wieder durcheinander. An Atempausen ist kaum zu denken, stattdessen hetzt man mit den Charakteren durch die grüne Hölle, ohne zu wissen, was hinter der nächsten (Handlungs-)Ecke lauert. Dabei bleiben die Geschehnisse aber erfreulicherweise stets übersichtlich. Es existieren keine Nebenschauplätze, keine Zweighandlungen, die den Leser verwirren könnten, so dass es bei aller Hektik keine große Konzentration braucht, um den Ereignissen zu folgen. Die Spannung wird bis zur letzten Seite gehalten. Bis dahin ist völlig unklar, wie das Schicksal der Gestrandeten endet und wer von ihnen die Katastrophe überlebt – falls überhaupt einer überlebt, denn nicht einmal dessen kann man gewiss sein. Schließlich basiert die Handlung auf Tagebuchaufzeichnungen, die theoretisch jederzeit enden könnten …
Das Prädikat „Heyne Hardcore“ steht für schockierende Inhalte, die nicht mit Gewaltdarstellungen geizen. War aber bereits „Rache“ schon kein Extremfall für den durchschnittlichen Horrorleser, so schocken die Gewaltmomente in der „Insel“ noch weniger. Natürlich passieren hier Morde, doch dem Leser wird meist das Endergebnis präsentiert, statt sich in seitenlanger Schilderung des Vorgangs zu ergehen. Lediglich kurz vor Schluss geht es extrem blutig zur Sache, aber auch hier dürften allenfalls sehr zarte Gemüter verstört reagieren. Grundsätzlich ist „Die Insel“ sicherlich ein harter Stoff, der aber nicht schwerer zu verdauen ist als das meiste andere der aktuellen Thriller- und Horrorliteratur auch. Die dichte Dschungelatmosphäre tut ihr Übriges, um den Leser zu fesseln. Es verbinden sich zwei interessante Ausgangspositionen: Die Gestrandeten müssen im fremden Dschungel überleben und gleichzeitig einen Mörder unter sich entlarven. Die tropische Hitze, die schwindenden Vorräte, Moskitoplagen und die Furcht vor wilden Tieren oder Verletzungen in dem unwirtlichen Gelände sorgen für zusätzlichen Zündstoff, wenn sie auch nicht ausgereizt werden. Diese Faktoren beinhalten durchaus noch ungenutztes Konfliktpotenzial, hätten die ohnehin sehr straffe Handlung allerdings womöglich überladen. Zum schnellen Tempo der Handlung passt der flüssige Stil, der sich leicht und locker lesen lässt. Rupert schreibt weder zu flapsig noch zu formell, sondern findet die ideale Mischung, um ein fließendes Lesevergnügen zu kreiieren.
|Mal Sympathie, mal Antipathie|
Eine von Laymons besonderen Stärken liegt in der Darstellung der Hauptfiguren, die dem Leser nie uneingeschränkt sympathisch sind. Zwar ist Rupert, der Tagebuch schreibende Student, ein netter Kerl, dessen Gedanken man weitestgehend nachvollziehen kann. Aber immer kurz bevor man ihn als Sympathieträger einstufen will, leistet er sich einen gedanklichen oder handlungsweisenden Fehltritt und offenbart abstoßende Charakterzüge. Denn trotz aller Sorge um das Heil seiner Mit-Gestrandeten hegt er gegen manche von ihnen deutliche Abneigungen, denen er in seinen Aufzeichnungen Luft macht. Obwohl er Keith keinen brutalen Tod gegönnt hat, kann er sich nicht eines kleinen Triumphgefühls erwehren, schließlich war ihm die Überlegenheit dieses aalglatten Supermanns schon lange ein Dorn im Auge. Parallel dazu erkennt Rupert mit dem Verstand natürlich an, dass sie alle darauf hoffen sollten, so schnell wie möglich gerettet zu werden. Doch gleichzeitig genießt der unerfahrene junge Mann die Gesellschaft so attraktiver Frauen. Egal wie ernst die Lage der unfreiwilligen Robinsonaden auch ist, für Rupert ist der Anblick der knapp bekleideten Ladys eines der Highlights seines spätpupertierenden Lebens.
Durch die gesamte Geschichte zieht sich dieses Spannungsverhältnis von Vernunft und Primitivität in Ruperts Charakter. Manches Mal fühlt man mit seinen Gedankengängen und kann sich nur zu gut in seine Not hineinversetzen. Andere Male fühlt man sich von seiner Lüsternheit und seiner Sensationsgier abgestoßen. Doch gerade dieser Zwiespalt in Ruperts Charakter macht ihn so authentisch, mehr als es ein heroischer Saubermann je könnte.
Auch die anderen Charaktere lassen sich kaum in ein festes Schema einordnen. Connie ist die meiste Zeit zickig, beweist aber zwischendurch auch ihre sensible Seite, Thelma ist unberechenbar in ihrer Parteinahme für Wesley und Andrew übernimmt in herrischer Befehlsmanier das Kommando. Die Gefahrensituation lässt zudem in jeder Person die Extreme hervorschnellen. Misstrauen greift um sich, die Charaktere entwickeln eine Hass-Liebe zueinander. Vor allem zwischen den Familienmitgliedern brechen alte Konflikte auf, die die Anspannung verstärken. Wer von ihnen ist wirklich so, wie er sich gibt, und wem kann man trauen – das sind zwei der Fragen, die sich Rupert wiederholt stellen muss.
|Schwächen in der Tagebuchform|
Grundsätzlich birgt die formale Umsetzung der Handlung ins Tagebuchformat einige Stärken, vorneweg das ungewisse Ende, denn niemand garantiert dafür, dass Rupert seine Aufzeichnungen zu einem vernünftigen Schluss bringt. Theoretisch könnte er früher sterben und das Manuskript mittendrin abbrechen. Auch ergeben sich ständig neue Erkenntnisse zu den Ereignissen. Wenn Rupert Vermutungen anstellt, kann der aktuelle Stand ein paar Tage darauf wieder ganz anders aussehen. Die Schwäche liegt jedoch in der unglaubwürdigen Umsetzung. Vor allem in der ersten Hälfte sind Ruperts Aufzeichnungen außerordentlich durchdacht und sehr ausführlich. Bis ins kleinste Detail erinnert er sich an die Dialoge, an die Mimiken und Gestiken seiner Inselmitbewohner. Besonders auffallend ist seine Strukturierung, die er sehr literarisch gestaltet, anstatt, wie es erwartenswert wäre, die Ereignisse auf den Punkt zu bringen, um seinen Emotionen Luft zu verschaffen.
Stattdessen formuliert er seine Gedanken, als gäbe ihm seine Situation jede Menge Zeit und Muße dazu. Erst in der zweiten Handlungshälfte weicht er etwas von diesem Schema ab. Seine Aufzeichnungen werden ein wenig wirrer und ungeordneter, sind aber immer noch viel zu ausführlich für ein Inseltagebuch, das unter enormen Druck verfasst wird. Tagebuchformen bringen immer das Problem mit sich, dass authentisch wirkene Aufzeichnungen meist nicht systematisch genug sind, um einen Leser zu fesseln. Trotzdem wäre es vorteilhaft und wünschenswert gewesen, Ruperts Extremsituation mehr in seine Art der Fixierung einfließen zu lassen. Die eingeschobene Erwähnung, dass Rupert literarische Ambitionen hegt und das Tagebuch später als Basis für einen Abenteuerroman nutzen will, erscheint eher als halbherziges Alibi statt als überzeugendes Argument.
|Mangelnder Realismus|
Offensichtlich wird dies auch, wenn Rupert sich bis zum Schluss immer wieder ironische und humorvolle Gedankengänge erlaubt, auch wenn sie angesichts der Lage unpassend sind. Das Gleiche gilt auch für seine sexuellen Phantasien, die er in den unangebrachtesten Momenten verspürt und zu Papier gibt. Diese Überbetonung des Triebhaften ist typisch für Laymon und gibt seinen Werken einen B-Movie-Charakter – glücklicherweise hält sich diese Tendenz jedoch in „Die Insel“ in Grenzen. Unangebrachte Reaktionen gibt es nicht nur von Ruperts Seite aus, sondern auch bei den anderen Figuren. Vor allem bei den Frauen wird zu gefasst auf die dramatischen Entwicklungen reagiert. Nur Thelma verfällt in eine realistische Krise, als sie vom mutmaßlichen Tod ihres Mannes Wesley erfährt. Kimberly und Billie dagegen beweisen während des ganzen Romans über eine außerordentliche Festigkeit und Stärke, in vielen Augenblicken halten sie sich tapferer als Rupert selbst, der als Einziger der Beteiligten keinen Angehörigen verliert und sich somit eigentlich am gefasstesten verhalten müsste. Zusammenbrüche weiblicher Protagonisten können zwar mitunter nervtötend sein, aber es wäre adäquater gewesen, zumindest phasenweise ihr Leiden und ihre Ängste stärker zu zeichnen. Schade ist zudem die ungenutzte Möglichkeit, die Täter-Verdächtigungen noch weiter zu streuen. Zu früh legt man sich auf einen bestimmten Täter fest, zu dem sich später ein zweiter hinzugesellt. Noch prekärer hätte man die Lage gestalten können, indem innerhalb der verbliebenen Gruppe stärkeres Misstrauen zum Vorschein gekommen wäre – um die Schlinge um Rupert so eng wie möglich zu ziehen …
_Als Fazit_ bleibt ein durchgehend spannender und unterhaltsamer Horror-Roman, der die Robinson-Crusoe-Thematik mit einer Mörderjagd verbindet. Von der ersten bis zur letzten Seite ist der Leser gefesselt von den dramatischen Ereignissen und überraschenden Wendungen. Weitere Pluspunkte sind die abwechslungsreichen Charaktere und der flüssige Stil. Kleine Schwächen liegen in der Tagebuchform, die nicht wirklich authentisch wirkt, und den teilweise zu harmlosen Reaktionen der Protagonisten. Von diesen Mängeln abgesehen, bietet sich ein Lesevergnügen für alle Freunde der Horrorliteratur.
_Der Autor_ Richard Laymon wurde 1947 in Chicago geboren und ist einer der meistverkauften Horrorautoren der USA. Er studierte englische Literatur und arbeitete unter anderem als Lehrer und Bibliothekar, ehe er sich dem Schreiben widmete. Im Jahr 2001 verstarb er überraschend früh und hinterließ eine Reihe von Romanen, die vor allem wegen ihrer schnörkellosen Brutalität von sich Reden machten. Nur ein kleiner Teil davon ist bislang auf Deutsch erhältlich. Zu seinen weiteren Werken zählen u.a. „Rache“, „Parasit“, „Im Zeichen des Bösen“ und [„Vampirjäger“. 1138
Mehr über ihn gibt es auf seiner offiziellen [Homepage]http://www.ains.net.au/~gerlach/rlaymon2.htm nachzulesen.
http://www.heyne-hardcore.de
Meyer, Deon – Herz des Jägers, Das
Thobela „Tiny“ (= winzig) Mpayipheli, ein Zwei-Meter-Mann vom Stamm der Xhosa, führt ein friedliches, unauffälliges Leben. Er arbeitet als Hausmeister in einem Motorradladen und genießt ansonsten das Familienglück mit seiner Freundin Miriam und deren Sohn Pakamile in einem kleinen Haus in einem Vorort Kapstadts. Doch Thobela hat ein Geheimnis: Während der Apartheid arbeitete er als Auftragskiller unter dem Decknamen „Der Jäger“ für den KGB.
Seine Vergangenheit holt ihn ein, als die Tochter eines Freundes aus alten Tagen um seine Hilfe bittet: Ihr Vater Johnny Kleintjes, ein ehemaliger Regierungsbeamter, ist gekidnappt worden, weil er eine Festplatte mit belastendem Material besitzt. Falls die Festplatte den Entführern nicht innerhalb von 72 Stunden in Lusaka/Sambia übergeben wird, drohen diese mit dessen Ermordung. Thobela übernimmt widerstrebend den Auftrag, denn er schuldet Johnny diesen Gefallen.
Doch schon am Flughafen wird er vom südafrikanischen Geheimdienst abgefangen. Es gelingt ihm, die beiden Geheimdienstbeamten zu entwaffnen und zu fliehen. Auf einem Motorrad jagt er nun quer durch das Land – verfolgt von einem Militär-Kommando des südafrikanischen Geheimdiensts und der CIA. Diese wollen unter allen Umständen die Übergabe der Festplatte verhindern, denn die Festplatte enthält Informationen über einen Doppelagenten, der für den ANC und die Amerikaner arbeitet.
„Das Herz des Jägers“ ist ein literarisches Roadmovie. Thobelas Reise quer durch den südafrikanischen Kontinent ist zugleich eine Reise in die eigene Vergangenheit und die seines Landes.
Thobela, der Sohn eines Predigers, hatte als siebzehnjähriger den Weg der Gewalt gewählt – sehr zum Entsetzen seines pazifistisch gesonnenen Vaters. Doch Thobela fühlte sich der kriegerischen Tradition seines Stammes verpflichtet und schloss sich der Befreiungsbewegung an. Hier wurde er zu einem „Umzingeli“, zu einem gnadenloser Jäger, ausgebildet. Seine Talente wurden auch vom KGB erkannt und er arbeitete viele Jahre als Auftragskiller. Nach dem Ende der Apartheid kehrte Thobela nach Südafrika zurück, aber keiner seiner ehemaligen Freunde bot ihm eine Chance zu einem zivilen Leben. So arbeitete er als Knochenbrecher für einen Gangsterboss und erst die Liebe zu Miriam und Pakamile waren für ihn der Anlass, mit seiner Vergangenheit zu brechen.
Als Thobela von Monica Kleintjes um Hilfe gebeten wird, träumt Thobela noch von einem neuen Leben auf einer Farm mit seiner kleinen Familie. Thobela ahnt nichts von den Gefahren, auf die er sich einlässt. Aber auch seine Verfolger ahnen nichts von seinen Talenten und seiner gewalttätigen Vergangenheit. Je härter sie Thobela zu setzen, umso mehr erinnert sich Thobela seiner antrainierten Automatismen und Fähigkeiten als Krieger.
Thobelas Überzeugung, seine Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben und ein neuer Mensch zu sein, sowie sein Ringen darum, unter allem Umständen nicht in die Reflexe des früheren Kriegers Thobela zurückzufallen, machen einen großen Teil des Reizes dieses Romans aus.
Deon Meyer gelingt darüber hinaus die kritische Analyse des Post-Apartheid-Südafrikas. Trotz allem wirken die Schrecken der Apartheid fort. Viele ehemalige Freiheitskämpfer und Apartheid-Kämpfer haben ihren Platz in der neuen südafrikanischen Gesellschaft noch nicht gefunden. Zugleich kämpfen neue Eliten um Macht und Einfluss, möglicherweise ohne dass hierbei die Hautfarbe eine große Rolle spielt, aber nicht weniger brutal und schmutzig als in früheren Zeiten. Eingebettet in die rasante, spannende Verfolgungsjagd entblättert Deon Meyer Schicht um Schicht des neuen Südafrikas.
Deon Meyer hat einen komplexen Plot für seinen Roman konstruiert, voller Wendungen und Überraschungen. Meyer besitzt ein ausgeprägtes Gespür für Timing, Spannungsbögen und -aufbau. Glaubwürdige Charaktere sowie der genaue Blick für Orte, Menschen, Situationen und Geschichte belegen das meisterhafte Handwerk des Autors und seine Figuren besitzen eine große emotionale Tiefe. Momente der Ruhe und der Reflexion wechseln ab mit Szenen knisternder, atemloser Spannung. Damit gelingt es Deon Meyer meisterhaft, den Leser in seinen Bann zu ziehen – bis hin zu einem furiosen und überraschenden Finale. Ein intelligenter, perfekter Pageturner mit Tiefgang!
„Das Herz des Jägers“ wurde mit dem Deutschen Krimipreis 2006, Kategorie International, ausgezeichnet und von der Chigaco Tribune zu den zehn besten Thrillern des Jahres 2004 gewählt. Auf seine weiteren Romane darf man zu Recht sehr gespannt sein.
© _Claus Kerkhoff_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de/ veröffentlicht.|
409 Seiten – 21,5 × 12,5 cm
Aus dem Englischen von Ulrich Hoffmann
http://www.deonmeyer.com/
Brac, Virginie – In den Nächten brütet still der Tod
In Frankreich ist Virginie Brac mit ihrer Heldin, der Kriminalpsychiaterin Véra Cabral, schon längst keine Unbekannte mehr. In Deutschland kennt man sie bislang noch nicht, doch der Rowohltverlag dachte sich, dass es an der Zeit wäre, dies zu ändern und bringt deshalb „In den Nächten brütet still der Tod“ heraus.
Véra, eine attraktive Mitdreißigern, arbeitet im psychiatrischen Kriseninterventionszentrum, dessen Aufgabe darin besteht, bei Geiselnahmen und Ähnlichem für Deeskalation zu sorgen, wenn die Polizei nicht mehr weiterkommt.
Eines Nachts, nachdem sie ihre Nachtschicht beendet hat, wird Véra zu einem Fall gerufen, der selbst für sie keine Routine ist. Fred, der Sohn ihres Chefs Edouard Russel, hat im Drogenrausch seine Freundin zerstückelt und Russel will eine Expertenmeinung hören.
Ohne Hintergedanken tut Véra, wie ihr geheißen wird. Selbst als Russel sie zur persönlichen Psychiaterin ihres Sohns macht, riecht sie keine Lunte. Sie glaubt an das Gute, doch je mehr sie sich selbst mit dem Fall beschäftigt, um Freds Schuldunfähigkeit zu beweisen und anhand ihrer psychiatrischen Fähigkeiten erklären zu können, desto mehr stellt sie fest, dass in der Familie Russel das eine oder andere Geheimnis bewahrt wird und dass nicht jeder in dieser schicksalhaften Nacht die Wahrheit gesagt hat …
Véra Cabral ist eine ziemlich sympathische Romanheldin. Ihre Ich-Perspektive ist sehr beschwingt geschrieben, mit richtig Biss in Form von frechem, manchmal derbem Humor. Trotzdem gleitet die sehr subjektiv gefärbte Perspektive nie ins Ordinäre ab, sondern bewegt sich auf hohem literarischem Niveau, das eine authentische, junge Frau präsentiert. Einziger Wermutstropfen: Das obligatorische düstere Geheimnis von Véra ist doch etwas überzogen.
Doch das ist nicht das Einzige. Die Inspektorin Sanchez, welche die Ermittlungen im Fall Russel führt, ist eine einzige aufgeblasene Comicfigur. Es ist schwer zu begreifen, wie sich eine solche Gestalt in einen „seriösen“ Thriller verirren konnte. Das sehr beleibte Mannsweib steht kurz vor der Pension, trägt eine mit Klebeband geflickte Brille und Blümchenkleider und lebte bis vor kurzem immer noch mit seiner Mutter zusammen. Sie ist ein echtes Raubein, mit einer vorgefertigen Meinung und einer unschlagbaren Geheimwaffe, mit der sie sich lästige Kollegen vom Leib hält und Aufrührer bestraft: ihre Darmwinde.
Das wäre dann aber auch der einzige Schwachpunkt in der Besetzung. Alle anderen Personen sind gut ausgearbeitet, auch wenn sie teilweise einen leichten Hang zum Klischee haben, wie zum Beispiel Véras portugiesische Großfamilie.
Mit der Handlung verhält es sich ähnlich. Sie hat ihre guten, aber auch ihre schlechten Seiten. Auf der einen Seite ist sie kurzatmig und geht zügig voran, bringt fast in jedem Kapitel neue Erkenntnise. Auf der anderen Seite ist sie für dieses Vorgehen überraschend unspannend. Die Handlung tritt trotzdem oft auf der Stelle, was damit zusammenhängt, dass es sehr oft zwischen Véras Analyse von Fred und der eigentlichen Handlung keinen großen Zusammenhang gibt. Im Gegenteil wirkt es so, als ob Fred mit der Zeit so sehr in den Hintergrund rückt, dass er nur noch Statist in seinem eigenen Fall ist. Überhaupt ist das Psychologische, das doch vermutlich im Vordergrund stehen sollte, auffällig wenig vorhanden.
Vielmehr präsentiert sich „In den Nächten brütet still der Tod“ des Öfteren als Krimi, der seinen Tiefgang nur aus dem Seelenleben der Protagonistin bezieht. Trotzdem ist das Buch lesenswert, da die fehlenden Spannungsbausteine bei dem frischen, linearen Schreibstil nicht so sehr ins Gewicht fallen.
Katzenbach, John – Anstalt, Die
Massachusetts um 1980: Der einundzwanzigjährige Francis Petrel wird gegen seinen Willen in das psychiatrische Klinikum Amherst eingewiesen. Schon seit vielen Jahren hört er Stimmen in seinem Kopf und gilt als Exzentriker. Eines Tages eskaliert ein Streit mit seinen Eltern, er greift nach einem Küchenmesser und bedroht erst seine Familie und anschließend sich selber. In der Klinik wird er durch Medikamente ruhig gestellt. Zunächst ist Francis verzweifelt, da er sich wie ein Gefangener fühlt, doch nach und nach lernt er, mit seiner Situation umzugehen. Sein bester Freund unter den Mitpatienten wird Peter, der wie alle Insassen und Mitarbeiter einen Spitznamen trägt: „the Fireman“, ein ruhiger, intelligenter Mann, der viel zu vernünftig für seine Umgebung erscheint. Francis erhält den Spitznamen „C-Bird“, in Anspielung auf seinen Nachnamen. Außerdem ist da zum Beispiel noch Nappy, der dank seiner Vorliebe für Napoleon alles aus der Lage des 18. Jahrhunderts betrachtet; die übergewichtige Cleo, die sich als Königin Kleopatra sieht und unermüdlich Tischtennis spielt; Newsman, der alle Schlagzeilen auswendig lernt und jedem ungefragt mitteilt, und der schlacksige Lanky, der hinter jedem Neuling den Teufel wittert. Der herrische Psychologe wird Dr. Evil genannt und das nette schwarze Pflegerbrüderpaar ist als Big Black und Little Black bekannt.
Eines Nachts erschüttert ein dramatischer Zwischenfall die Klinik, als die junge Lernschwester „Short Blond“ brutal ermordet aufgefunden wird. Der Verdacht fällt sofort auf Lanky, der erst kurz zuvor eine Auseinandersetzung mit ihr hatte und ihr Blut an seinen Kleidern trägt. Lankys Beteuerungen, dass der „Engel des Todes“ den Mord begangen und ihn anschließend umarmt habe, schenkt niemand Glauben und der verwirrte Mann wird festgenommen. Nur Peter und Francis behalten ihre Zweifel an seiner Schuld. Kurz darauf taucht die Untersuchungsrichterin Lucy Jones in der Klinik auf. Sie berichtet von weiteren Morden nach dem gleichen Schema durch einen unbekannten Täter. Gemeinsam mit Peter und Francis, die ihr durch ihr Insiderwissen helfen sollen, stellt sie nähere Nachforschungen in der Klinik an. Doch es folgen weitere Morde …
Zwanzig Jahre später: Die Anstalt ist seit einigen Jahren geschlossen, Francis wurde entlassen. Noch immer hört er Stimmen, doch die Medikamente halten sie unter Kontrolle. Da erhält er eine Einladung für ehemalige Patienten zu einem Aktionstag an der Klinik. Durch die Rückkehr nach Amherst werden die Erinnerungen in Francis wieder lebendig. Aufgewühlt von den damaligen Ereignissen beginnt er, alle Geschehnisse nochmal zu durchleben und auf seinen Wohnungswänden niederzuschreiben. Wer war der „Engel des Todes“ – eine Schreckensphantasie oder lebendige Wirklichkeit … ?
Die weiße Hand, die im Dunkeln dem Betrachter bedrohlich entgegenstrahlt, ist nicht nur ein nettes Gimmick auf dem Cover, sondern sie verheißt auch Nervenkitzel pur. Dass der Inhalt Ambitionen besitzt, die über einen normalen Schocker hinausgehen, lässt sich weder an der Aufmachung noch am eher reißerischen Klappentext ausmachen. Einschüchterungen in einer Nervenheilanstalt, Widerstand gegen Bevormundungen der Betreuer, Aufstände der Insassen – kein Zweifel, „Einer flog über das Kuckucksnest“ lässt grüßen und damit auch Ankläge an ein sozialkritisches Drama. Tatsächlich ist „Die Anstalt“ mehr als bloß ein Psychothriller, sondern der Roman vereint zudem gesellschaftskritische Elemente durch das Vorhalten eines sozialen Spiegels.
|Von Irren und weniger Irren|
In Francis Petrel findet der Leser einen sympathischen Protagonisten und Ich-Erzähler, der zwar gewöhnungsbedürftig, dafür aber auch umso vielschichtiger ist. Francis hört Stimmen, die ihn mal zu Agressionen, mal zur Zurückhaltung anstacheln. Bis zu seiner Einlieferung führte er das Leben eines Außenseiters, doch auch in der Klinik hat er nicht annähernd das Gefühl, zuhause zu sein. Stattdessen empfindet er seine Lage als Gefangenschaft, hilflos dem zynischen Arzt Dr. „Gulp-a-pill“ Gulptilil und dem Psychologen Dr. „Evil“ Evans ausgeliefert.
Obwohl seine psychischen Defizite offenkundig sind, scheint er nicht in die Welt von Amherst zu passen, eine Welt voller Verrückter unterschiedlichster Arten, die ihm die Eingewöhnung schwer machen. Da er auch in der „normalen“ Welt keinen Anschluss findet, erscheint Francis als zerrissener Charakter, dessen mühevolles Leben dem Leser nah geht. Umso erfreulicher liest sich seine Freundschaft mit Peter the Fireman, der mit seinem scharfen Verstand und seiner besonnenen, weitsichtigen Art absolut nicht in den überdrehten Klinikalltag passen will. Immer wieder sinniert Francis darüber nach, wie qualvoll erst das Leben von Peter sein muss, der zwar ein schweres Verbrechen begangen hat, jedoch tatsächlich kein psychisch Kranker ist, der sich noch fremder als Francis an diesem Ort der Verrücktheit fühlen muss. Seine ruhige Ausstrahlung beeindruckt nicht nur Francis, sondern auch den Leser. Peters Dasein in der Anstalt bedeutet einen Hoffnungsschimmer in all der Trostlosigkeit, Symbol des Kämpfers gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung, eine sympathische Auflehnung gegen die Allmacht der Klinikleiter. Peter gibt nicht nur seinem speziellen Freund Francis den nötigen Rückhalt, er unterstützt auch die anderen Insassen, beispielsweise in den Gruppensitzungen bei seinem Erzfeind Dr. Evans. Obwohl er offiziell nur die zweite Geige in der Handlung spielt, ist Peter ein fast noch interessanterer Charakter als der Protagonist Francis selbst.
Die dritte zentrale Gestalt ist die Staatsanwältin Lucy Jones, eine faszinierende Schönheit; nach außen hin willensstark und um jeden Preis entschlossen, den Mörder zu fassen, insgeheim jedoch auch gebeutelt von einem traumatischen Erlebnis, das die Kämpferin in ihr gegen das Verbrechen erst geweckt hat. Lucy, die vor allem gegen Ende des Romans an Bedeutung gewinnt, ist kein so schillernder oder fesselnder Charakter wie Francis und Peter, bietet aber ein passables Gleichgewicht zu den beiden Hauptcharakteren.
Der Makrokosmos der Gesellschaft zeigt sich im Mikrokosmos der Anstaltsbewohner. Wie im realen Leben existieren auch hier die unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Glücklicherweise wird auf ein reines Schwarz-Weiß-Schema verzichtet. Zwar sind die obersten Leiter und Verantwortliche unsympathisch und dominant, dafür überzeugen einige der Pflegekräfte, allen voran die „Black-Brüder“, durch Menschlichkeit und viel Verständnis für ihre Patienten – angenehmerweise ohne wiederum zu lässig oder solidarisch zu sein. Big Black und Little Black machen keinen Hehl aus ihrer Sympathie für Francis, ohne dabei in ein rein freundschaftliches Verhältnis zu verfallen, denn bei aller Wertschätzung und allem Mitgefühl bewahren sie ihre berufsmäßige Professionalität. Unter den Patienten finden sich apathisch Retardierte, kindlich Zurückgebliebene, Brutal-Aggressive und eine Reihe liebenswerter Charaktere mit belustigenden Spleens, allen voran Napoleon, die temperamentvolle Cleo und das wandelnde Lexikon Newsman.
|Spannung trotz Weitschweifigkeit|
Die Grundidee weiß zu fesseln: Eine Nervenklinik und ihre merkwürdigen Insassen bieten immer Stoff für eine interessante Handlung, ebenso wie eine Mörderjagd. Spannung bis zum Schluss wird dem Leser geboten, denn während der Lektüre tun sich eine Menge Fragen auf: Allen voran steht natürlich die Suche nach dem geheimnisvollen Täter, der mehrere Morde auf dem Gewissen hat. Ist es tatsächlich der zurückgebliebene Lanky, den die Polizei sofort dankbar in Gewahrsam nimmt? Was ist mit seinen Beteuerungen über den „weißen Engel“, existiert er wirklich oder ist er ein Gespinst seiner Phantasie? Ist es ein Insasse, ein Mitarbeiter, ein Außenstehender, der sich hier unter den Hunderten von Bewohnern tarnt? Welches Motiv verfolgt der Killer, was verbindet seine Opfer – oder bilden sie bloß die Vorstufe zu einem höheren Ziel?
Fragen gibt es unzählige, Antworten nur wenige. Immer wieder nehmen Peter, Francis und Lucy neue Fährten auf, werden aber allzu oft in die Irre geleitet und enden in seiner Sackgasse. Als zusätzliches Spannungselement kommt der Zeitfaktor ins Spiel. Es gilt nicht nur, einem Mörder rechtzeitig das Handwerk zu legen, bevor er erneut zuschlägt – Lucy soll aufgrund mangelnder Erkenntnisse von ihrem Posten abgezogen werden und die Ermittlungen einstellen; Peter wird von seiner Vergangenheit eingeholt und steht vor der zweifelhaften Wahl zwischen Gefängnis und Verlegung in eine andere Anstalt.
Der Leser sieht sich mit einer Kombination aus kriminalistischen und zwischenmenschlichen Aufhängern konfrontiert; sowohl das Rätselraten um die Identität und Motivation des Mörders als auch die Entwicklung der Schicksale der einzelnen Charaktere gewinnen seine Aufmerksamkeit. Sicher: Es braucht definitiv keine 750 Seiten, um die Handlung angemessen darzustellen; weniger wäre in diesem Fall um einiges mehr gewesen. Dies nicht nur, weil den wenigen actionreichen Handlungsmomenten viele ruhige gegenüberstehen, sondern auch, weil zahlreiche Gedankengänge und Situationen sich mit gegebenenfalls leichten Variationen wiederholen; Kürzungen von 200 bis 300 Seiten hätten dem Werk gut getan.
|Irritierender Perspektivenwechsel|
Am grundlegenden Stil des Autors gibt es nichts zu bemängeln; Katzenbach liest sich locker und flüssig, mal eher neutral und auf schnellen Genuss ausgerichtet, wie es typisch ist für Spannungsliteratur, mal eher mit blumigen Formulierungen, wenn es gilt, Francis‘ wirre Gedankengänge darzustellen. Auffallend und leider mit Mängeln versehen ist allerdings die Struktur, die den Roman in zwei Teile gabelt: Da ist zum einen die Handlungsebene, die in der Jimmy-Carter-Ära spielt, als der junge Francis in die Klinik eingeliefert wird. Und da ist zum anderen die Ebene der aktuellen Handlung, in der ein zwanzig Jahre älterer, aber immer noch Stimmen hörender Francis sich mit der Vergangenheit auseinander setzt.
Die aktuelle Handlung wird in der Ich-Form geschildert und ist zur besseren Übersicht kursiv gesetzt; die Vergangenheit – die den Hauptanteil des Romans ausmacht – besteht aus dem Text, den Francis auf seine Zimmerwände schreibt. Die Idee dieser Art der Vergegenwärtigung ist originell und passt zum psychotischen Charakter des Protagonisten, bleibt in der Umsetzung aber unglaubwürdig. Zum einen sind Francis‘ Ausführungen so ausführlich – eben ein ganzer Roman – und detailliert bis in die kleinste Abschweifung, zum Beispiel bei der Beschreibung von Örtlichkeiten und Mimiken, dass man ihm nicht abnimmt, dass er die Ausdauer besitzt, ein solches Mammutwerk auf die Wohnungswand zu kritzeln. Zum anderen übernimmt Francis in der Er-Form die Perspektive eines personalen Erzählers und gibt auch Situationen wieder, in denen er nicht selber anwesend war, bis hin zu ausführlichen Gedankengängen von Peter oder Lucy. Zwar wird diese Wiedergabe von Dingen, die Francis tatsächlich gar nicht – in diesem Umfang – wissen kann, anfangs einmal damit begründet, dass er sich bei seiner Verschriftlichung Freiheiten herausnimmt und seine Mutmaßungen spielen lässt. Dennoch bleibt der Eindruck zurück, dass dem Roman bei weitem besser damit gedient gewesen wäre, die Ich-Perspektive bzw Francis‘ Wandschreibereien zu streichen und sich auf die Perspektive eines personalen Erzählers zu beschränken. Francis‘ Vorgehensweise ist einfallsreich, aber nur eine Alibi-Strukturierung.
|Schwächen in der Glaubwürdigkeit|
Dem Roman ist zugute zu halten, dass er sich nicht auf sein Thrillerdasein beschränkt, sondern sich auch mit der Behandlung der Patienten auseinander setzt, die auch in der Realität, vor allem in der damaligen Zeit, in vergleichbaren Kliniken zu wünschen übrig lässt. Gemeinsam mit Francis sinniert der Leser über die Würde, die einem innerhalb der Anstaltsmauern noch bleibt – sofern man um sie kämpft. Ruhigstellung mit hochdosierten Medikamenten und Abschiebung in die Isolierzelle sind die Maßnahmen, an die sich die Ärzte halten, die Menschlichkeit bleibt auf der Strecke.
Trotz dieser lobenswert kritischen Darstellung schleichen sich Mängel in die Umsetzung ein. Zu leicht erscheint das Abkommen, dass Francis und Peter als Amateur-Ermittler der Staatsanwältin Lucy Jones zur Seite stehen dürfen. Beide sind mehr als bloße Insider-Informanten; vielmehr präsentieren sie sich als gleichberechtigte Komplizen, die zuweilen die offizielle Ermittlerin sogar in den Hintergrund drängen, als eine Art Detektiv-Duo, das sich gegenseitig die Erkenntnisse wie Bälle zuspielt. Sehr fraglich ist die Reaktion von Klinikleitern und Polizei, als sich ein Todesfall ereignet, den sie als Selbstmord klassifizieren – ungeachtet einiger Details, die deutlich darauf Hinweisen, dass hier eine zweite Person mit im Spiel gewesen sein muss. Am Schluss des Buches und der Entlarvung des Täters scheiden sich die Geister: Einerseits ist das Ende nicht leicht vorherzusehen, andererseits wäre wünschenswert gewesen, einige zusätzliche Andeutungen einzubauen, denn die Identität des Mörders dürfte für viele Leser eine eher enttäuschende Überraschung bilden.
_Unterm Strich_ ist „Die Anstalt“ ein unterhaltsamer und lesenswerter Psychothriller, der sich nicht auf eine Mörderjagd beschränkt, sondern auch interessante Einblicke in das Leben von Psychiatriepatienten liefert. Vor allem dank der gut dargestellten Charaktere versetzt sich der Leser in die Geschichte hinein, nimmt Anteil am Geschehen und am Schicksal der Hauptfiguren. Schwächen gibt es dagegen in der unnötigen Weitschweifigkeit, der Zweiteilung der Perspektive und einiger Unglaubwürdigkeiten in der Handlung, zu denen auch das recht weit hergeholte Ende gehört.
_Der Autor_ John Katzenbach war vor seiner Schriftsteller-Karriere als Gerichtsreporter für die „Miami News“ und den „Miami Herald“ aktiv. 1982 erschien seiner erster Roman, „In the Heat of the Summer“, für den er eine Edgar-Award-Nominierung erhielt. Es folgten mehrere Bestseller, unter anderem „Der Sumpf“, „Die Rache“ und „Das Tribunal“.
http://www.john-katzenbach.de/
http://www.knaur.de
Stucke, Angelika – Gute Gründe
Dass sie lange fackeln würden, kann man von keiner der Heldinnen in Angelika Stuckes zweitem Erzählband „Gute Gründe“ behaupten. Ganz im Gegenteil, hier wird kurzer Prozess gemacht und am Ende der meisten Erzählungen bevölkert ein Mann weniger diesen Planeten. Was Angelika Stucke in ihrem [Erstlingswerk 2143 angefangen hat, setzt sie im zweiten Teil ihrer als Trilogie geplanten Erzählreihe fort: Sie lässt Frauen morden – und das mitunter ziemlich zielstrebig, konsequent und ohne zu zögern.
Dreizehn Erzählungen umfasst „Gute Gründe“. Dreizehn Morde, in denen vernachlässigte Hausmütterchen, hintergangene Ehefrauen und pummelige Mauerblümchen Rache nehmen und sich gegen die Ungerechtigkeiten des Lebens im Allgemeinen und der Männerwelt im Speziellen zur Wehr setzen. Dabei findet jede Täterin ihren ganz individuellen Stil. Mal wird der Golfschläger zur Mordwaffe, mal wird ein Unfall vorgetäuscht, mal wird Gift ins Essen gemischt – bei der Wahl der Waffen lassen sich die Damen durchaus etwas einfallen.
Noch kreativer werden die Mörderinnen gar, wenn es darum geht, ihre Taten zu verschleiern. Da werden Leichen beseitigt und Spuren verwischt. Und auch darin, ihre Taten anderen in die Schuhe zu schieben, beweisen die Täterinnen Einfallsreichtum. Angelika Stuckes Erzählungen fallen allesamt recht kurz, aber teils auch pointiert aus.
Stucke spielt offensichtlich gerne mit Klischees. Das zeigt sich schon an der biederen Namensgebung, die in einem herrlichen Kontrast zur Mordlüsternheit der Frauen steht: Gundula, die Giftmischerin, Grete, die „Schmiergelpapier-Mörderin“, Hertha, die zur Schrotflinte greift, oder Edeltraut, die beherzte „Golfschläger-Schwingerin“. Sie alle wirken, als wären sie dem plattesten Klischee entnommen – bieder, mittelschichtig, langweilig, nur um den Leser dann mit ihrer konsequenten und rabiaten Art zu überraschen.
Insgesamt sind die kurzen Geschichten in „Gute Gründe“ außerordentlich „klolektürengeeignet“. Kurze, knappe Erzählungen, die als kleines Krimihäppchen zwischendurch wunderbar tauglich sind. Teils mit einem Augenzwinkern erzählt, erweisen sich viele Geschichten als recht unterhaltsame Lektüre. Stucke nimmt ihre Figuren und deren Taten nicht allzu bierernst, und so mag sich manch einer vielleicht über den fehlenden Realismus der Figuren beklagen.
Tatsächlich haben sämtliche der versammelten Damen eine äußerst niedrige Hemmschwelle, wenn es darum geht, sich unliebsame Mitmenschen nicht nur längerfristig, sondern vor allem möglichst endgültig vom Hals zu schaffen. Das setzt dann allerdings hier und da auch schon mal die Grenzen der Logik außer Kraft. Manche Tat scheint zu unnötig und unüberlegt, als dass die Erzählung wirklich überzeugend unterhalten könnte. Da runzelt man dann eher die Stirn, als dass man über die Skrupellosigkeit der Täterinnen schmunzeln mag.
Dass bei dreizehn Erzählungen nicht jede ein absoluter Kracher sein kann, leuchtet allerdings auch ein. Zwangsläufig gibt des da qualitative Schwankungen, die nicht nur bei Publikationen weniger bekannter Verlage an der Tagesordnung sind, sondern auch bei Werken sog. großer Autoren häufig vorkommen. Fakt ist, „Gute Gründe“ enthält auch ein paar gut konzipierte Erzählungen, deren Pointe zu überzeugen weiß. Besonders dann, wenn bei den Taten etwas schief geht, wenn es Missverständnisse gibt, die sich erst später aufklären, kann Stucke besonders überzeugen.
Lediglich eine Erzählung bleibt wirklich negativ im Gedächtnis haften und zwar jene, in der Stucke von ihrem Schema der mordenden Frauen abweicht. Die Mordphantasien des Außenseiterkindes mit der Vorliebe für Ballerspiele am PC hat doch ein sehr faden Beigeschmack. Wer denkt da nicht an das Schulmassaker von Erfurt vor ein paar Jahren?
Alles in allem ist „Gute Gründe“ nicht unbedingt herausragende, aber dennoch durchaus solide Unterhaltung für zwischendurch. Ein Buch, das sich schnell lesen lässt und auch gerade als leichte Kost zur Urlaubszeit durchaus brauchbar ist. Zielgruppe von „Gute Gründe“ dürften, wen wundert’s, in erster Linie Frauen sein, vorzugsweise mit einem etwas schwarzen Sinn für Humor.
Doug Allyn – Schwarzwasser
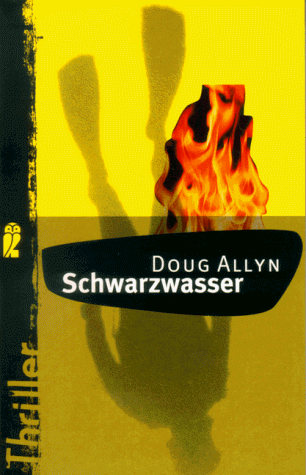
Dieses Mal ist es ein versunkenes Auto, das im schwarzen Wasser des Odawa Rivers entdeckt wurde. Es ist beladen mit Gepäck, aber ohne Fahrer – und Michelle hat es bereits gesehen. Einige Tage zuvor war Jimmy Calderon ins „Krähennest“ gekommen, um sie nach Owen McClain, einem örtlichen Geschäftsmann, auszuhorchen. Der ist angeblich sein Bruder, wie wenig später Ray Calderon verkündet, der auf der Suche nach seinem Halbbruder just in Huron Harbor eintrifft, als dessen Wagen aus dem Wasser gezogen wird.
Wendy Morgan – Von schwarzem Herzen
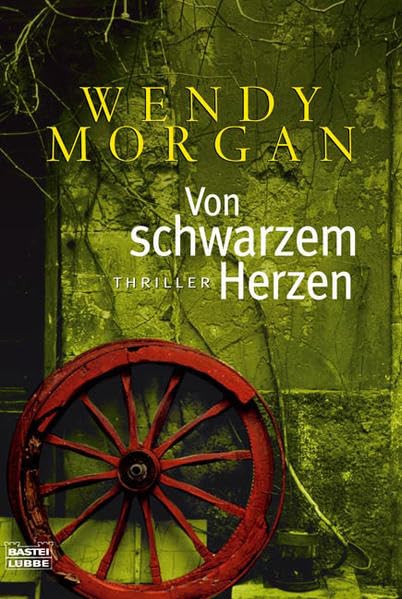
Tom Bradby – Der Gott der Dunkelheit
Im Juni des Jahres 1942 stürmen die Truppen Hitler-Deutschlands an allen Fronten scheinbar unaufhaltsam vor. Unter dem Kommando Generals Rommel treiben die Nazis in Nordafrika die britischen Verteidiger vor sich her. Nur noch Stunden steht das Afrikakorps vor Kairo, der letzten Bastion. Die Briten sind demoralisiert an der Front und gefährdet in der Etappe. Vor einigen Monaten haben sie König Faruk von Ägypten abgesetzt und regieren das Land seither ganz unverhohlen als Kolonie. Die Ägypter haben das nicht vergessen. Separatisten und Terroristen blieben bisher erfolglos, doch Rommels Nahen lässt sie Oberwasser gewinnen. In den Straßen Kairos macht sich eine gefährliche Stimmung gegen die Briten und für Hitler breit.
In diesem Chaos versucht Major Joe Quinn, Chefermittler des Special Investigation Branch in der Kriminalabteilung der Royal Military Police, einen brutalen Mord aufzuklären. Im Garten seiner Dienstwohnung fand man die Leiche von Captain Rupert Smith, die Kehle durchschnitten, der Körper an einem Baum aufgeknüpft, auf der Brust die Figur von Seth, Gott der Finsternis und des Chaos, eingeritzt, darunter das Wort „Befreiung“. Dies weist auf die Täterschaft der „Arabischen Bruderschaft“ hin, einer besonders aktiven ägyptischen Befreiungsorganisation. Alarmierend ist weiterhin die Tatsache, dass Smith als hoher Offizier der Einheit Movement Control Kenntnis über Position und Kampfstärke jeder britischen Fronteinheit hatte. Wurde dieses hochgeheime Wissen womöglich an die Nazis verraten? Tom Bradby – Der Gott der Dunkelheit weiterlesen
Goergen, Ilse – Blut im Schuh
Der sympathische kleine |Bookspot|-Verlag mit dem knuddeligen Maskottchen Booky-Bär veröffentlicht mit „Blut im Schuh“ bereits den zweiten Krimi aus Ilse Goergens Feder. „Blut im Schuh“ stellt dabei eine in sich abgeschlossene Fortsetzung von Goergens Romandebüt „Genau sein Kaliber“ dar und lässt sich problemlos ohne Kenntnis des ersten Krimis lesen.
Julia Brenner arbeitet als Polizistin in Trier und lebt mit einem dunklen Geheimnis. Vor zwanzig Jahren wurde ihre kleine Schwester vom damaligen Freund ihrer Mutter erstickt; dieses Trauma hat Julia nie ganz überwunden. Als sie zu Beginn des Buches in einem Hotelzimmer zu sich kommt und den ermordeten Killer ihrer Schwester vor sich findet und bemerkt, dass er von ihren eigenen Polizeihandschellen gefesselt ist, bleibt Julia nur ein Schluss übrig, nämlich dass sie nun selbst zur Mörderin geworden ist. Doch eine Gedächtnislücke quält Julia sehr, denn sie kann sich an die Tat überhaupt nicht erinnern.
In Berlin macht Tatjana Szykman sich Sorgen um die Treue ihres Ehemannes, denn ihre Schwester Sieglinde liefert ihr handfeste Beweise und Indizien für Günther Szykmans Untreue. Gleichzeitig bietet sie ihrer kleinen Schwester an, die Sache zu klären, wie sie dies vor Jahren mit ihrem eigenen untreuen Exfreund getan hat, der bei einem mysteriösen Autounfall ums Leben gekommen ist. Tatjana ist verstört, insbesondere als sie einen Anruf der Polizei Trier erhält, die einen toten Mann gefunden hat, neben dem Günthers Portemonnaie gefunden wurde. Tatjana soll nach Trier reisen, um die Leiche zu identifizieren. Tatjana ist fassungslos und kann nicht glauben, dass ihre Schwester ihre Drohung in die Tat umgesetzt und Günther ermordet hat.
Und richtig, Sieglinde hat ganz andere Pläne, denn ihre Laufbahn als Prostituierte neigt sich dem Ende zu, ohne dass Sieglinde finanziell ausgesorgt hat, folglich will sie den wohlhabenden Günther erpressen. Doch etwas geht schief, nach einem Schäferstündchen mit Günther verschwindet dieser und lässt Sieglinde alleine zurück, die die Welt nicht mehr versteht, als sie von ihrer Schwester hört, dass Günther ermordet worden ist …
Zunächst erzählt Ilse Goergen zwei völlig voneinander separierte Geschichten. Wir lernen kurz die verstörte Julia Brenner kennen, die neben einer Leiche erwacht und sich nicht mehr daran erinnern kann, den Mann ermordet zu haben. Gleichzeitig sprechen alle Indizien aber eindeutig gegen Julia. Auf der anderen Seite treffen wir auf die heruntergekommene Sieglinde und ihre naive Schwester Tatjana, die sich problemlos lenken lässt und völlig blind gegenüber Günthers Untreue und den Intrigen der eigenen Schwester ist. Dass Günther einigen Dreck am Stecken hat, wird spätestens klar, als er mitten in der Nacht zu einem mysteriösen Ausflug startet und Sieglinde im schmuddeligen Hotelzimmer zurücklässt.
Ilse Goergen zieht ihre Erzählung anhand der beiden Erzählstränge auf, die erst gar nichts miteinander zu tun haben, die dann aber immer mehr miteinander verwoben werden. Am Ende erfährt der Leser natürlich die genauen Zusammenhänge, aber es besteht auch genug Gelegenheit für eigene Spekulationen. Ganz vereinzelt lässt Goergen versteckte Hinweise einfließen, die andeuten, wie die Familie Szykman in den Mordfall von Trier verwickelt ist. Hierdurch fesselt die Autorin ihre Leser immer mehr an ihr Buch und baut stetig mehr Spannung auf.
Besonders die Charaktere gefallen sehr gut an diesem authentischen Krimi. Wir lernen die unterschiedlichsten Menschen kennen, die aber alle irgendwo menschlich und realistisch wirken und eine Vielzahl von Identifikationsmöglichkeiten bieten. Im Mittelpunkt des Buches stehen drei Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, obwohl zwei davon sogar Schwestern sind. Da wäre einmal die hübsche, aber völlig naive Tatjana, die aus einfachen Verhältnissen stammt, aber durch ihre Heirat ausgesorgt hat – zumindest solange die Ehe funktioniert, denn dank des Ehevertrages würde sie im Falle einer Scheidung leer ausgehen. Umso größer ist ihre Sorge, als sie ahnt, dass Günther wohl doch nicht ganz so treu ist, wie sie immer gehofft hatte. Als zweites lernen wir Sieglinde kennen, die voller Neid gegenüber ihrer Schwester ist, da sie selbst keinen Mann abbekommen hat und ihren Lebensunterhalt als Prostituierte verdienen muss. Sieglinde ist abgehalftert und hat nichts von der Attraktivität ihrer Schwester – ein Punkt, der ihren Neid nur noch weiter steigert. In Trier schließlich treffen wir auf Julia Brenner, die auf Seiten der Frauen wohl die meisten Sympathien ernten dürfte. Julia ist erfolgreich und verletzlich, sie kann ihre traurige Vergangenheit nicht vergessen und daher auch keinen Mann lieben. Dies macht besonders ihrem Kollegen Heiner zu schaffen, der in sie verliebt ist. Insgesamt kann man sich in Ilse Goergens Figuren hervorragend einfühlen, da sie so lebensnah geschildert sind.
Ilse Goergen erzählt ihren Krimi geradlinig und ohne viele Schnörkel, sie beschränkt sich in ihrem nur 171-seitigen Buch auf das Wesentliche und unterhält ihre Leser dabei auf solide Art und Weise. Zwar kann sie nicht an den Nervenkitzel von manch einem Krimibestsellerautor heranreichen, dennoch verleitet einen „Blut im Schuh“ durchaus zum Lesen des Vorgängerromans und zum Warten auf einen möglichen Nachfolger. Nachteilig wirkt sich allerdings aus, dass in dem schmalen Büchlein wenig Platz für genügend Charaktere ist. So ist der Kreis der Tatverdächtigen ziemlich klar abgesteckt und kann am Ende daher auch nicht mehr für große Überraschungen sorgen.
Unter dem Strich bleibt ein positiver Eindruck zurück, der höchstens durch einige Tippfehler mehr als üblich getrübt wird, doch inhaltlich gibt es kaum etwas auszusetzen an Ilse Goergens aktuellem Mosel-Krimi. Insbesondere in ihrer authentischen und glaubwürdigen Figurenzeichnung weiß sie zu überzeugen. Darüber hinaus gefällt die Erzählung in den beiden Handlungssträngen mit dem steten Spannungsaufbau sehr gut. Hier hält das |Bookspot|-Maskottchen Booky-Bär einen durchaus überzeugenden Krimi für zwei, drei unterhaltsame Lesestunden bereit.
Hillerman, Tony – Skelett-Mann, Der
Nach längerer Zeit kommt mir wieder ein neuer Hillerman ins Haus geflattert, und nachdem ich bislang nur positive Erfahrungen mit dem Meister des Ethno-Thrillers habe machen können, hatte ich die Hoffnung, dass der Autor auch ein Vierteljahrhundert nach seinem Debütwerk noch immer ähnlich begeisternde Kost abliefern würde wie einst solch starke Romane wie „Das Labyrinth der Geister“ oder „Dunkle Kanäle“. Leider aber wurde die Hoffnung im Falle von „Der Skelett-Mann“ ein wenig getrübt. Hillerman zeigt sich zwar bei der Vermengung traditioneller Riten und gehobener kriminalistischer Elemente nach wie vor sehr geschickt, konstruiert aber bei seinem neuesten Werk eine allzu vorhersehbare Story, die lediglich für sich beanspruchen kann, den Leser wegen eventueller neuer Eigenheiten nicht vor den Kopf zu stoßen. Hillerman ist sich nämlich in jeglicher Hinsicht treu geblieben, schafft es halt nur diesmal nicht so ganz, eine ständig ansteigende Spannungskurve aufzubauen. Und das ist doch schon sehr ungewöhnlich.
_Story_
Billy Tuve, ein naiver junger Hopie, der bei einem Unfall in seiner Kindheit einige geistige Schäden hat davontragen müssen, gerät plötzlich in Verdacht, den Besitzer eines Juweliersladens überfallen und niedergestreckt zu haben. Begünstigt wird diese Vermutung dadurch, dass Tuve versucht hat, einen weitaus wertvolleren Diamanten für nur 20 Dollar zu versetzen, was die Ermittler auf die Spur eines lange Zeit vergessenen Juwelentransports aus dem Jahre 1956 bringt.
Während Tuve nämlich erst mal in Untersuchungshaft kommt, wird die Herkunft des Diamanten mit einem Flugzeugabsturz aus genau jenem Jahr in Verbindung gebracht, bei dem ein gewisser Mr. Clarke einen ganzen Koffer mit Diamanten an seine Hand gekettet trug, bevor seine Maschine über dem Grand Canyon mit einem anderen Flugzeug kollidierte und alle Insassen in den Tod führte.
Clarkes damals noch nicht geborene Tochter hat nach dem Tod ihrer Mutter einen Brief zugesteckt bekommen, in dem von diesen Diamanten die Rede ist; sie erfährt, dass ihr Vater diesen Koffer um seine Hand trug und sieht in der Entdeckung seines verstümmelten Körpers für sich selber die letzte Hoffnung. Clarkes Besitz ist nämlich damals nach seinem Ableben einer Stiftung zugute gekommen, weil im Nachhinein nicht nachgewiesen werden konnte, dass die junge Dame, Joanna Craig, tatsächlich seine Tochter ist. Jahrelang hat sie vergeblich um ihr Erbe gekämpft, doch erst jetzt, wo endlich wieder eine Spur der verschollenen Diamanten aufgetaucht ist, sieht sie einen Weg, die Überreste ihres Vaters zu entdecken und den Beweis anzutreten, dass sie seine leibliche Tochter ist.
Ihr Weg führt sie in das Gebiet des Grand Canyons, wo Officer Jim Chee und sein Freund Cowboy Dashee sich längst des Falles um den angeklagten Tuve, Dashees Vetter, angenommen haben. Vor Ort sammelt sie Informationen, erkundigt sich nach dem Wissensstand der Ermittler und versucht schließlich auf eigene Faust, das Vermächtnis ihrer Familie aufzuspüren. Doch auch Stiftungsboss Plymale schickt seine Leute heraus, um zu verhindern, dass Joanna Craig die Wahrheit aufdeckt und endlich an den ihr zustehenden Besitz gelangt. Chee, der kurz vor der Ehelichung seiner Freundin Bernie Manuelito steht, hat alle Hände voll zu tun, Tuve vor dem Gefängnis zu bewahren, zwischen den Diamantensuchern zu vermitteln und seine angehende Gattin bei Laune zu halten. Die einzige Möglichkeit, all diese Probleme zu lösen, besteht für Chee darin, selber in den Canyon abzusteigen und vor den anderen die Diamanten aufzuspüren …
_Meine Meinung_
Hillermans neuer Roman bietet dem erfahrenen Leser kaum Neues. Wieder sind knapp zwei Jahre ins Land gezogen, in denen sich auch bei den Hauptfiguren einiges, wenn auch nichts Wesentliches verändert hat. So ist die Beziehung zwischen Jim Chee und Bernie Manuelito mittlerweile derart gereift, dass ihre Hochzeit schon fest eingeplant ist. Jim Leaphoren, der ‚Legendary Lieutnant‘ hingegen fristet seinem Dasein im Ruhestand und agiert nur noch als Komplize im Hintergrund, der nur geringfügig an der Aufklärung des Falles beteiligt ist. Und ansonsten ist alles wie gehabt im Gebiet der Four Corners, bis vielleicht auf die Ausnahme, dass Trading Post-Besitzer Shorty McGinnis, Leaphorns ehemaliger Informant, für tot gehalten wird.
Ein Problem bei dieser Geschichte ist, dass Hillerman seine Geschichte zu sehr um seine Hauptfiguren herum aufbaut. Steif hält er an ihren Werten fest und gibt ihnen kaum Raum zur Weiterentwicklung, was natürlich dazu führt, dass man aufgrund der bekannten Wesenszüge immer wieder vieles vorab erahnen kann. Besser wäre sicher gewesen, den Plot selber in den Mittelpunkt zu rücken und um ihn herum erst die Personen einzuflechten. Doch dies hat der Autor klar verpasst. Und so beginnt die Erzählung fast schon wie eine exakte Kopie vorangegangener Thriller, nur eben mit anderen Gegnern, neuen Verbündeten und einer variierten Ausgangssituation.
Hinsichtlich der Lösungsmöglichkeiten indes greift Hillerman auf Bekanntes zurück; gleich mehrmals fühlt man sich dabei an seinen Roman „Das Labyrinth der Geister“ erinnert, welcher ebenfalls auf einen Showdown im Canyon hinausläuft und auch auf ähnliche Weise abgeschlossen wird. Einziger Unterschied: Statt Joe Leaphorn übernimmt Jim Chee nun die Rolle des Hauptermittelnden. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es keinen Spaß macht, dem Mann bei der Darstellung seiner Geschichte über die Schulter zu schauen, aber wenn man bereits einige seiner Bücher intus hat, ist das Bedürfnis nach Frischem ziemlich groß, kann aber hier ganz klar nicht gesättigt werden.
Im Hinblick auf die eingespeisten Elemente der Navajo-Kultur zeigt sich der Autor aber dann wieder in Normalform. Sehr häufig erwähnt er Traditionen, Bräuche und Sitten der dort ansässigen Indianerstämme und nimmt sich auch entsprechend viel Zeit, um sie dem Leser näher zu bringen, ohne dass der Fluss der Handlung hierdurch ins Wanken gerät. Dadurch, dass die Protagonisten des Romans partiell einer anderen Sippe angehören, kann Hillerman hier auch wieder neues Wissen anbringen und es mit den Fakten um die bekannten Stämme kombinieren. So gelingt es ihm auch sehr gut, die feinen Unterschiede zwischen den Navajos und ihren ganzen Sub-Kulturen zu verdeutlichen, was mitunter sicher gar nicht mal so einfach ist. Schade lediglich, dass die Qualität des gesamten Romans dadurch nur unwesentlich verbessert wird.
Wenn man von einem typischen Hillerman spricht, dann nur im Bezug auf die stets tollen Umschreibungen und summa summarum hinsichtlich seines sehr eigenwilligen Schreibstils. Blickt man hingegen auf die Handlung und ihre Entwicklung, so fehlt es hier einfach zu sehr an fortschrittlichen Motiven und neuen Ideen. Das macht das Buch zwar auch ‚typisch Hillerman‘, aber eben nicht auf die Art und Weise, wie man es sich erhofft hätte. In diesem Sinne möchte ich „Der Skelett-Mann“ auch nur Komplettisten uneingeschränkt empfehlen. Die Neugier auf Ethno-Thriller kann das Buch entgegen früheren Ausgaben nicht wecken.
http://www.rowohlt.de
Bresching, Frank – Ruf der Eule, Der
Der sechzehnjährige Alexander, von seinen Freunden bloß Alex genannt, meldet sich zu einem Schüleraustausch nach Cambridge in England an. Für zwei Wochen geht es zu einer Gastfamilie. Anschließend soll der Sohn der englischen Familie im Gegenzug bei ihm in Deutschland unterkommen. Nicht nur Alex, auch einige seiner Klassenkameraden machen bei dem Austausch mit, darunter auch sein bester Freund Dominik.
In Cambridge wird Alex von Familie Taylor aufgenommen, die aus der Mutter Kathryn und den beiden Jugendlichen Patricia und Marc besteht. Gleich bei seiner Ankunft erfährt Alex, dass Familienvater William vor zwei Jahren ums Leben gekommen ist. Kathryn bittet ihn, nicht mehr auf dieses schmerzhafte Thema zu sprechen zu kommen. Kathryn ist eine attraktive Frau um die Vierzig, die die meiste Zeit außer Haus ist, da ihr Job in einem medizinischen Unternehmen sie sehr fordert. Marc und Pat sind Zwillinge, ansonsten aber unterschiedlich wie Tag und Nacht. Marc ist ein rothaariger, ruhiger, zurückhaltender Junge, der immer darauf bedacht ist, es seinem Gast recht zu machen. Alex versteht sich gut mit ihm, verspürt aber auch eine gewisse Distanz. Pat hingegen ist nicht nur eine dunkle Schönheit, sondern strotzt auch vor Selbstbewusstsein und Laszivität. Ihre Ausstrahlung bringt Alex in Verwirrung, zumal er nicht ersehen kann, ob sie ihn leiden kann oder nicht.
Nach den ersten Tagen kommen sich Alex und Pat jedoch näher. Alex ist überglücklich, dass seine schöne Gastschwester sich ernsthaft für ihn zu interessieren scheint, obwohl er sich nach wie vor nicht ganz sicher ist, wie sie wirklich zu ihm steht. Aber kaum dass Alex sich eingewöhnt hat, warnt ihn eine alte Nachbrain vor der Familie, vor allem vor Kathryn. Ein düsteres Geheimnis scheint den Tod von William Taylor zu umgeben. Unheimlich wird es, als Alex herausfindet, dass Kathryns Firma sich mit Leichenkonservierung zur eventuellen Wiederbelebung befasst.
Wie hängt diese Entdeckung mit William Taylors Tod zusammen? Was für eine Bedeutung hat die Gedenkstätte im Keller des Hauses? Und warum träumt Alex in letzter Zeit ständig von seinem verstorbenen Großvater, der ihm offenbar etwas zu sagen versucht? Bald weiß Alex nicht mehr, ob er sich etwas zusammenphantasiert oder sein Verdacht gerechtfertigt ist. Die Atmosphäre im Haus der Taylors wird immer angespannter. Kann Alex ihnen trauen oder schwebt er wirklich in Gefahr? Immer tiefer verstrickt sich der Junge in ein Netz aus Todes- und Jenseitserfahrungen, grausigen Experimente und dunklen Prophezeihungen, aus dem es kaum ein Entrinnen gibt …
Was kommt nach dem Tod? – Das ist die zentrale Frage, um die sich dieser Thriller dreht und mit der er den Leser konfrontiert. Eine Frage, die bereits vor Beginn der eigentlichen Geschichte aufgeworfen und im Verlauf der Handlung immer bestimmender wird.
|Protagonist als Identifikationsfigur|
Sympathischerweise präsentiert sich der Ich-Erzähler als normaler Durchschnittsjugendlicher, mit dem sich der Leser identifizieren kann. Alex ist, im Gegensatz zu seinem Freund Dominik, weder im schulischen Bereich noch bei den Mädchen oder im Sport ein absoluter Überflieger. Lediglich sein Englisch ist überdurchschnittlich gut, ansonsten offenbart er angenehme Unsicherheiten, die man nachvollziehen kann. Enorm schwer tut er sich bei der Einschätzung von Patricias Gefühlen, obwohl er nicht gänzlich unerfahren in Sachen Mädchen und Beziehungen ist.
Trotzdem versteht es seine Gastschwester, ihn immer wieder aufs Neue zu verwirren, seine Gedanken durcheinander zu bringen, so dass seinem besten Freund sehr bald auffällt, dass Alex rettungslos verliebt ist. Auch die Unsicherheitlichen bezüglich seiner Gastfamilie sind gut dargestellt. Mehrere Punkte sprechen dafür, dass sich Alex wirklich in Gefahr befindet, dass sich Marc und vor allem Kathryn ihm gegenüber verändert haben, dass ihre Blicke dafür sprechen, dass er sich mitten in einer Verschwörung gegen sich befindet. Doch es fehlen ausschlaggebende Beweise, so dass Alex in seiner Einschätzung hin und her schwankt. Dem Leser ergeht es ähnlich, denn alles ist möglich: Vielleicht erweisen sich Alex‘ Verdächtigungen als haltlos, aber vielleicht steuert er auch direkt auf eine Katastrophe zu …
|Dichte Handlung|
Die Handlung ist straff gespannt und erlaubt sich keine unnötigen Abschweifungen. Zwar werden kleine Rückblicke in die Vergangenheit zu Alex‘ verstorbenem Opa eingebaut, doch diese sind von zentraler Bedeutung für den weiteren Verlauf, wie sich bald herausstellt. Der Spannungsbogen steigert sich konsequent, bis man mit dem Protagonisten mitfiebert und sich eine Antwort auf all die Fragen herbeisehnt, die sich durch all die merkwürdigen und beunruhigenden Ereignisse ergeben haben. Dabei deutet, bis auf einen kurzen, düsteren Rückblick, zunächst nichts in der Haupthandlung auf eine ungewöhnliche Entwicklung hin.
Ein Schüleraustausch nach England, eine nette Gastfamilie, eine kleine Liebelei zwischen Teenagern bilden den harmlosen Einstieg, der dementsprechend fast belanglos daherkommt. Nach und nach häufen sich jedoch die Vorfälle, die Alex misstrauisch werden lassen, angefangen bei den seltsamen Traum-Visionen über seinen verstorbenen Großvater bis hin zu den Warnungen der alten Nachbarin. Alex wird von Neugierde gepackt und stellt eigene Nachforschungen an – und das Ergebnis beunruhigt ihn zutiefst. Spätestens an diesem Moment ist der Leser gefangen und hofft gemeinsam mit dem Protagonisten, dass sich alles zum Guten weden möge.
Positiv sticht zudem heraus, dass sich der Roman gleichermaßen für Jugendliche als auch für Erwachsene eignet. Das Thema ist ernst und durchaus beängstigend, doch für Leser in Alex‘ Alter gut aufbereitet. Die wissenschaftlichen Details halten sich in Grenzen und die Jugendlichkeit des Protagonisten macht das Buch ideal für diese Altersklasse. Dazu passt auch der leichte, sehr dialoglastige Stil, der für eine flüssige Lesbarkeit sorgt. In spätestens zwei Tagen, unter Umständen auch schon an einem, hat mal als Schnellleser die gut 240 Seiten hinter sich gebracht. Aber auch wenn längere Pausen eingelegt werden, hat man keine Probleme, sich rasch wieder ins Geschehen einzufinden. Es gibt keine verwirrenden Handlungszweige, stattdessen ist der Roman klar strukturiert aufgebaut. Am Ausgang der Geschichte mögen sich die Geister scheiden, feststeht jedoch, dass der Autor Mut zur Konsequenz bewiesen hat. Die Pointe kommt recht unerwartet, fügt sich aber ins Gesamtbild ein und schlägt einen unkonventionellen Weg ein, was selbst derjenige honorieren sollte, dem das Ende inhaltlich nicht gefällt.
|Kleine Schwächen|
Trotzdem ist „Der Ruf der Eule“ nicht frei von Mängeln. Da ist einmal der sehr geraffte Beginn, der zwar das zügige Lesen fördert, aber an manchen Stellen etwas mehr Ausführlichkeit verdient hätte. Zwischen dem Entschluss von Alex, an dem Schüleraustausch teilzunehmen, und seiner Ankunft bei seiner Gastfamilie herrscht ein harter Bruch. Ohne Zwischenstation wird zu einer Szene übergeblendet, in der Alex in England am Küchentisch sitzt. Der Leser weiß die Namen „Kathryn“ und „Marc“ daher zunächst gar nicht einzuordnen. Erst zwei Seiten später folgt ein kurzer Rückblick zu seinem Empfang bei der Ankunft. Grundsätzlich hat man das Gefühl, dass es der Handlung gut getan hätte, sie in einen weitgefassteren zeitlichen Rahmen unterzubringen. Da Alex insgesamt nur einen Aufenthalt von zwei Wochen in England hat, erscheint die Entwicklung der Ereignisse zu überhastet und zu gedrängt. Schöner wäre gewesen, die Zeit des Austausches großzügiger anzulegen und dafür die Entwicklung gemächlicher zu gestalten.
Glaubwürdigkeit büßt der Roman dadurch ein, dass Alex offenbar während seines ganzen Aufenthaltes keinerleih Sprachprobleme zu bewältigen hat. Man erfährt zwar kurz vor seiner Anreise, dass er ein sehr guter Englischschüler ist, aber trotzdem erscheint es unrealistisch, dass er von da an jedes Gespräch wie ein Muttersprachler zu bewältigen scheint. Man vergisst geradezu, dass er sich in einem fremden Land befindet. Nur bei der Begrüßung durch Marc wird erwähnt, dass Alex ihn „in einem guten Englisch“ anspricht – von da an ist es selbstverständlich, dass er sich fließend mit allen Engländern unterhält. Natürlich sollen keine Verständnisprobleme vom Inhalt der Handlung ablenken, aber um Oberflächlichkeit zu vermeiden, wäre es eleganter gewesen, wenigstens ab und zu die Hauptfigur Alex ein wenig ins Nachdenken zu versetzen, anstatt ihm ein fließendes Englisch zu verpassen. Gerade bei den langen Dialogen, die er beispielsweise mit der alten Nachbarin führt, ist es wesentlich glaubwürdiger, wenn der Protagonist angesichts der Ungewöhnlichkeit der Ereignisse kurz innehalten und überlegen muss.
Während sich am Anfang die Geschehnisse in rascher Abfolge ereignen, wird an anderer Stelle die Ausführlichkeit übertrieben. Das ist vor allem in ausufernden wörtlichen Reden der Fall. Als Patricia Alex vom Tod ihres Vaters erzählt, beschreibt sie minutiös alle Vorgänge in epischer Breite. Anstatt sich darauf zu beschränken, den schlechten Zustand ihres Bruder wiederzugeben, erwähnt sie sogar, dass „kleine, feine Schweißtropfen“ seine Schläfen säumten, ganz wie ein allwissender Erzähler, der sich detailgenau jede seiner Figuren vornimmt, was in einer wörtlichen Rede aber zu viel des Guten ist.
Insgesamt ist das Buch sauber lektoriert, wenn sich auch ein paar kleine Fehlerteufel eingeschlichen haben – so verzichtet der Verlag grundsätzlich auf das übliche Leerzeichen vor den Auslassungspunkten, mal werden Anführungszeichen oben statt unten oder fälschlicherweise vor den Satzpunkt gesetzt, aber diese Schludrigkeiten kommen nur vereinzelt vor und fallen nicht weiter auf.
_Unterm Strich_ ist „Der Ruf der Eule“ ein lesenswerter und unterhaltsamer Thriller, der sich sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche eignet. Nach harmlosen Beginn wird der Verlauf der Handlung immer mystischer und bedrohlicher bis hin zu einem überraschenden Ende. Kleine Schwächen in zu hastiger Erzählweise und Glaubwürdigkeit mindern das Lesevergnügen, doch dank des flüssigen Stils bietet sich eine leicht zu konsumierende Lektüre für alle Freunde der Spannungsliteratur.
_Der Autor_ Frank Bresching wurde 1970 geboren. Er verfasste zunächst einige Kurzgeschichten, bevor 1996 sein Debütoman „Der Teddybär“ erschien. Der Autor lebt mit seiner Familie bei Koblenz.
June Thomson – Alter Sarg für neue Leiche
Auf einem brachliegenden Feld in der englischen Grafschaft Dorset graben Archäologen eine Leiche aus, die nur noch Skelett, doch ganz und gar nicht historisch ist. Chief Inspector Finch übernimmt einen seltsamen Fall, denn der tote Mann wurde zwar ermordet, aber nach seinem Ende vom Mörder sorgfältig aufgebahrt und in eine Wolldecke als Leichentuch gehüllt; sogar ein Kruzifix als Grabbeigabe wird entdeckt.
Das einsame Grab liegt auf der Grenze zwischen den Ländereien zweier nicht gerade befreundeter Bauern. George Stebbing ist ein scheinheiliger Schwätzer, der seine Nase allzu gern dorthin steckt, wo sie nichts zu suchen hat, Geoff Lovell ein grimmiger Sonderling, der seine Schwägerin Betty und seinen geistig zurückgebliebenen Bruder Charlie auf dem Hof gefangen zu halten scheint.
Villatoro, Marcos M. – Minos
Neue Ermittler-Helden sprießen wie Pilze aus dem Boden und selten ist eine Person mit wirklich Substanz dabei. Anders Romilia Chacón, die temperamentvolle Latina aus der Feder von Marcos M. Villatoro, die sich schon alleine aufgrund ihres ethnischen Hintergrunds von den Tempe Brennans dieser Welt abhebt.
Romilia stammt eigentlich aus El Salvador, doch sie lebt schon seit längerem in Amerika und hat dort auch studiert. Sie arbeitet als Detective in Nashville, wo sie zusammen mit ihrem kleinen Sohn Sergio und ihrer Mutter in einer kleinen Wohnung lebt. Romilia ist dafür bekannt, gerne mal die Nerven zu verlieren und auszurasten. Sie ist alles andere als frei von Fehlern und eigentlich nur von einer Aufgabe getrieben: den Mord an ihrer älteren Schwester Catalina von vor sechs Jahren zu rächen. Damals fand man sie, zusammen mit ihrem verheirateten Geliebten, aufgespießt in ihrem Bett, in eindeutiger Stellung. Der Mörder wurde niemals gefasst, obwohl er noch zwei weitere, bestialische Morde verübte.
Wir schreiben den Winter 2001, als er beschließt, erneut zu morden. Romilia ist gerade zur lokalen Heldin geworden, weil sie den gefürchteten Jadepyramidenmörder dingfest gemacht hat. Dabei hat sie einen Fan gewonnen, den sie lieber wieder loswerden möchte. Tekún Umán, der Drogenboss, verdankt ihr sein Leben und empfindet außerdem tiefere Gefühle für sie, die sie aber niemals zulassen würde, nachdem er einen ihrer Informanten, eine sechzehnjährigen Jungen, gefoltert hat. Zum Dank hackt er sich in die Datenbanken des FBI und besorgt Romina Informationen zum Mörder ihrer Schwester. Sie erfährt, dass es weit mehr Opfer gegeben hat als angenommen und außerdem muss sie ohnmächtig mitansehen, wie „Minos“, wie sie ihn wenig später taufen wird, weil er sich an Holzstichen von Dante orientiert, weitermordet. Ihr sind die Hände gebunden, denn wie sollte sie erklären, dass sie an solch wohlgehütetes Material kommt? Und doch geht sie aufs Ganze, von der Rache und dem Zorn angetrieben, bis sie eines Tages einen Schritt zu weit geht …
Romilia Chacón besticht. Sie ist eine starke Frau, eine Powerfrau, eine Sportskanone. Und sie ist intelligent. Und schlagfertig. Und eine temperamentvolle Latina, wenn es sein muss. Hm. Klingt ja fast so wie eine dieser perfekten Ermittlerinnen, deren Namen wir jetzt nicht nennen wollen, deren Charaktere so aalglatt gestaltet sind, dass man schon auf den ersten Seiten darauf ausrutscht.
Ob es daran liegt, dass hier ein Mann am Werke war? Marcos M. Villatoro hat es jedenfalls geschafft, eine sehr authentische Frauenfigur zu basteln, die durch und durch Mensch ist. Trotz der oben erwähnten Charaktereigenschaften ist sie alles andere als perfekt. Sie ist sehr auf dem Boden geblieben, schon alleine durch ihre Rolle als alleinerziehende Mutter, die nicht immer für ihren Sohn dasein kann. Romilia hat viel in ihrem Leben verloren, aber sie beweist, dass sie eine Kämpferin ist.
Auch die anderen Charaktere können sich sehen lassen. Sie sind liebevoll ausgearbeitet, auch wenn Romilias Mutter wohl ein wenig dem Klischee der lateinamerikanischen Matrone entspricht. Tekún dagegen ist weder ganz böse noch ganz lieb und seine „Beziehung“ zu Romilia ist alles andere als einfach. Und zuletzt wäre da noch der Mörder, der immer wieder ein Kapitel zwischen Romilias Ich-Perspektiven einschieben darf. Seine Charakterisierung unterscheidet sich kaum von denen anderer „Psychopathen“, doch da seine Auftritte selten sind, fällt das kaum auf.
Villatoro lässt den Leser virtuos ins Buch einsteigen, indem er den Mörder von den letzten Stunden vor dem Mord an Romilias Schwester erzählen lässt. Was genau passiert ist, erfährt man erst viel später, als Romilia die geheimen FBI-Daten von Tekún liest. Folglich gibt es keine blutrünstige, detailreiche Ausschlachtung der Morde, sondern der Fokus liegt beinahe völlig auf Romilias Ermittlerarbeit.
Trotzdem ist das Buch weit davon entfernt, langweilig zu sein. Spannung wird beinahe in jedem Kapitel aufgebaut und wenn nicht, gibt es ja immer noch unsere Ich-Erzählerin, die durch eine schöne, manchmal flappsige Sprache besticht. Villatoro verzichtet glücklicherweise auf lange Denkphasen oder ausschweifende private Ausrutscher, wodurch die Handlung wunderbar straff ist. Villatoro lässt uns nicht durchatmen. Er peitscht uns bis zum Ende des Buches, wo wir einem fulminanten Abschluss entgegenfiebern dürfen.
Bei der Schwemme von Neuveröffentlichungen, die im Bereich Thriller jeden Monat auf den Markt kommen, ist es kein Wunder, dass vieles wie von der Stange wirkt. „Minos“ hat sicherlich einige Elemente, die ebenfalls „von der Stange“ wirken, doch im Großen und Ganzen begeistert der Autor mit einem Buch, das durchgehend spannend ist und eine wirklich tolle Ermittlerin und Frau im Mittelpunkt zu stehen hat. „Minos“ ist ein Pageturner erster Güte und es ist schön zu hören, dass dies nicht das einzige Buch mit Romilia Chacón bleiben soll.
http://www.knaur.de