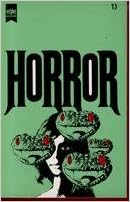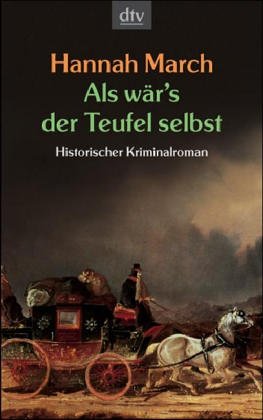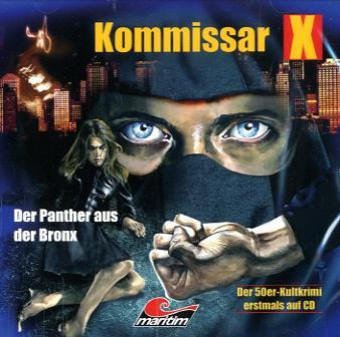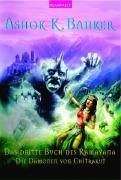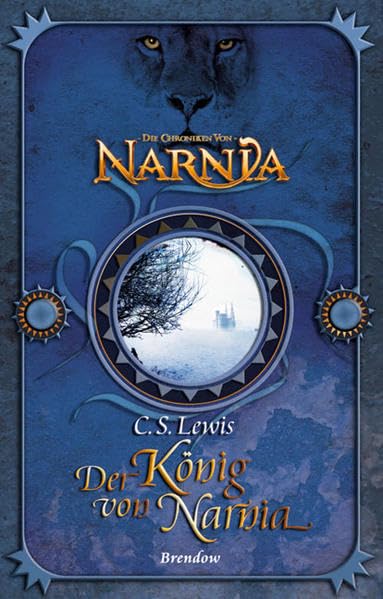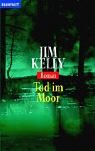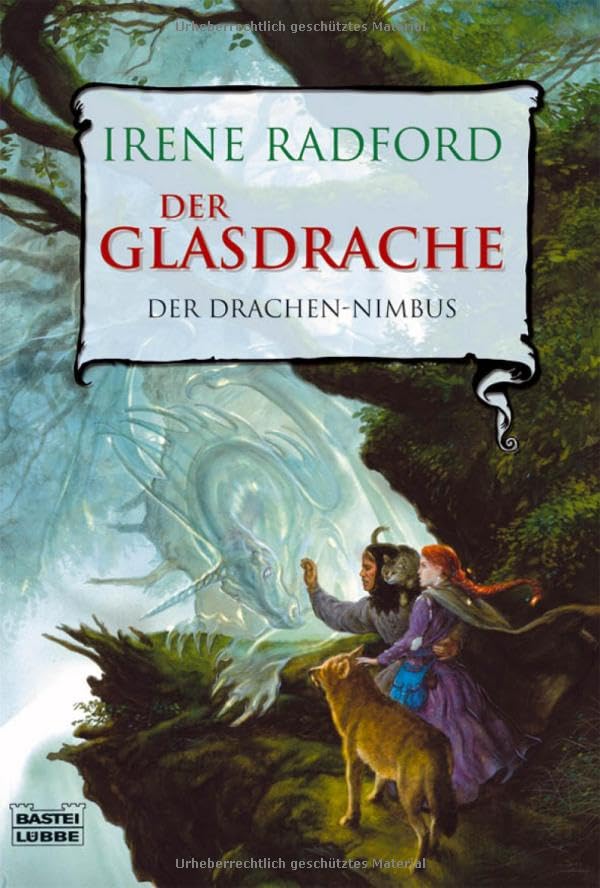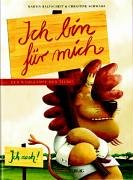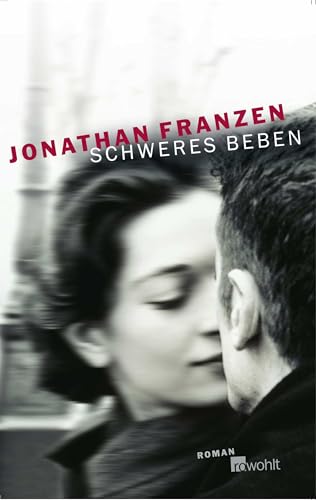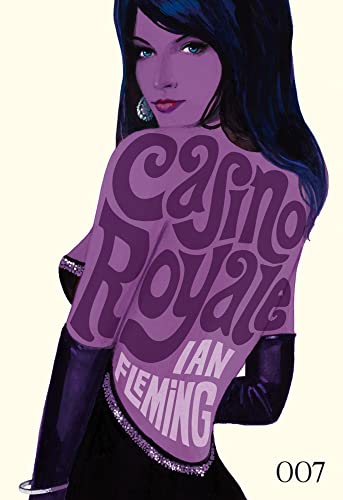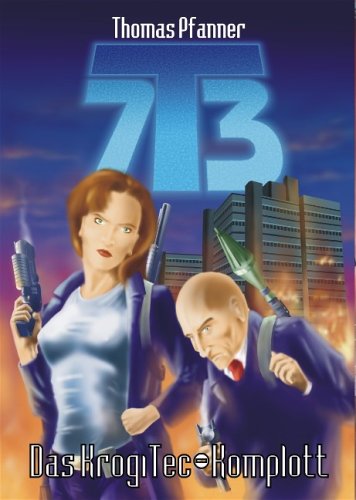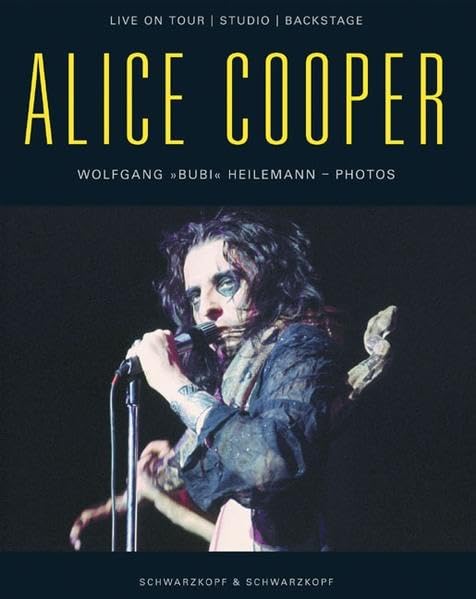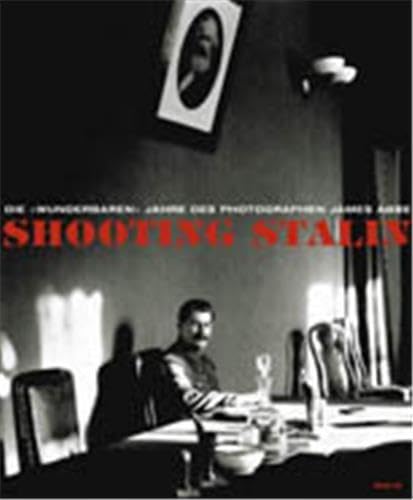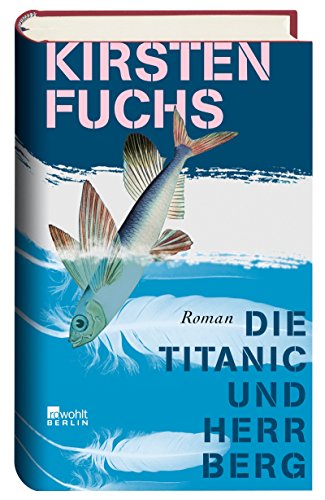Wieder einmal gerät ein Buch in die Schlagzeilen, das laut einigen Kritikern besser und spannender sein soll als „Der Herr der Ringe“ oder „Harry Potter“, doch den Vergleich gegen das große Werk von J.R.R. Tolkien haben vor Sergej Lukianenkos „Wächter der Nacht“ schon andere Bücher verloren. In Russland allerdings ist Lukianenkos Trilogie tatsächlich erfolgreicher als das meistverkaufte Fantasybuch, und auch der zugehörige [Film]http://www.waechter-der-nacht.de schlägt dort alle Rekorde. Inwiefern dieser Vergleich zwischen den verschiedenen Fantasybüchern überhaupt gerechtfertigt ist, wollen wir uns nun ansehen.
_Lichtgestalten_
In Moskau leben die Lichten und die Dunklen in einem wackligen Waffenstillstand, die Lichten sorgen als Wächter der Nacht in den dunklen Stunden für Ordnung, während die Dunklen tagsüber die Wache übernehmen. Anton arbeitet als lichter Magier bei der Nachtwache und muss eines Nachts beobachten, wie eine Vampirin den 12-jährigen Jegor anlockt, um dessen Blut zu trinken. Doch dies ist verboten, und so kann Anton gerade noch rechtzeitig einschreiten, doch sowohl der Junge als auch die Vampirin können fliehen. Viel beunruhigender sind allerdings andere Ereignisse: Auf seiner nächtlichen Runde hat Anton in der U-Bahn eine Frau beobachtet, die einen bedrohlichen schwarzen Wirbel über ihrem Kopf schweben hat. Im Grunde genommen sind solche Wirbel alltäglich und werden durch Flüche hervorgerufen. Die verfluchte Person wird nun einige Unglücke zu verkraften haben, doch der besagte Wirbel über dem Kopf der unbekannten Frau ist anders. Anton schafft es nicht, ihn aufzulösen, der Wirbel nimmt eher noch dramatischere Ausmaße an.
Antons Chef beschließt daraufhin, den schwarzen Wirbel von seiner Nachtwache aufhalten zu lassen, muss aber zusehen, wie dieser größer und größer wird und schließlich eine Höhe von über dreißig Metern annimmt. Dies würde eine Katastrophe bedeuten, die große Teile von Moskau zerstören und viele Menschenleben kosten würde. Schließlich kommt es zum Showdown, bei dem Anton eine große Rolle spielen wird.
_Der neue Tolkien?_
Vergleiche mit J.R.R. Tolkien versprechen immer einen Anstieg der Verkaufszahlen, auch wenn sie in den seltensten Fällen angebracht sind. Lukianenko schreibt zwar ebenfalls im Fantasygenre wie sein berühmter Vorgänger, doch da hören die Ähnlichkeiten fast schon auf. Während Tolkien mit Mittelerde eine ganz eigene Welt entworfen und seinen Elben sogar eine eigene Sprache verpasst hat, greift Lukianenko auf das bekannte und existente Moskau zurück und lässt dort lediglich die Anderen auf den Plan treten. Die Anderen sind Lichte oder Dunkle mit magischen Fähigkeiten, die zwar auf unterschiedlichen Seiten des Rechts kämpfen, doch beide ihre Schattenseiten haben. Das Zwielicht – die Schattenwelt – ist das Reich, in dem sie sich bewegen und wo sie unbeobachtet durch normale Menschen bleiben können. Lukianenko greift also auf das bekannte Erfolgsmuster zurück, nämlich auf den Kampf zwischen Gut und Böse, wobei allerdings die Grenzen in diesem Fall stark verwaschen sind. In „Wächter der Nacht“ haben auch die Lichten ihre dunklen Seiten. So intrigiert sogar der Chef der Nachtwache gegen seine eigenen Wächter. Und auch Anton tut nicht nur Gutes. Um an eigene Kraft zu gelangen, muss er Menschen ihre Freude nehmen. Bei Sergej Lukianenko gibt es erfreulicherweise also keine Schwarzweiß-Zeichnungen, auch wenn die Sympathien dennoch klar verteilt sind. Die gesamte Geschichte ist nämlich aus Antons Sicht erzählt, sodass er der Sympathieträger schlechthin ist.
„Wächter der Nacht“ hat weder mit dem „Herr der Ringe“ noch mit „Harry Potter“ viel gemeinsam, daher erscheint dieser Vergleich weit hergeholt. Dennoch muss sich Lukianenko nicht verstecken, sein Buch weiß zu unterhalten und präsentiert uns eine spannende Welt jenseits der uns bereits bekannten. Der unsichere Waffenstillstand zwischen Licht und Dunkel birgt genug Lesestoff für den langen ersten Teil der Trilogie, es werden uns insgesamt drei Episoden erzählt, in denen stets Anton, Swetlana – die Frau mit dem schwarzen Wirbel – und der kleine Jegor im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Welche Rolle diese drei Figuren im Gesamtkontext einnehmen, erahnen wir dabei erst nach und nach. Lukianenko versteht es gekonnt, uns zunächst im Dunkeln zu lassen und einige falsche Fährten auszulegen.
Die Welt, die Sergej Lukianenko uns präsentiert, ist düster und erscheint nahezu hoffnungslos. Wenn sich schon die Lichten und die Dunklen gegenseitig bekriegen, obwohl sie doch den Frieden bewahren sollen, wie soll es dann weitergehen? Viele Szenen spielen sich nachts ab, wenn die Wächter der Nacht ihren Dienst antreten – solcherart zeichnet Lukianenko ein bedrohliches und furchteinflößendes Bild Moskaus. „Wächter der Nacht“ kommt ganz ohne friedliche Oasen im Sinne des Auenlandes aus und auch märchenhafte Figuren wie die Elben fehlen völlig. Das vorliegende Buch wirkt dadurch auf der einen Seite realistischer, auf der anderen Seite fehlt ihm aber ein wenig vom magischen Glanz eines „Herr der Ringe“. Dennoch halte ich beide Bücher weiterhin für nicht miteinander vergleichbar, beide stehen nicht in Konkurrenz zueinander, da sie sich stark voneinander unterschieden und Lukianenko seine ganz eigene Fangemeinde um sich scharen wird.
_Einsamer Held_
Der erste Teil der Trilogie um die Anderen in Moskau ist aus Sicht Antons geschrieben, der seinen Dienst bei der Nachtwache angetreten hat, aber gleich vor große Aufgaben gestellt wird. Seine magischen Fähigkeiten sind zwar schon gut entwickelt, doch kann sein Chef bereits sehen, dass Anton nie über den zweiten Grad hinauskommen wird, die Laufbahn eines großen Magiers ist Anton also verwehrt. Trotzdem wird er mit wichtigen Aufgaben betraut, die die Zukunft der Lichten beeinflussen werden. Wir begleiten Anton dabei stets auf seinen Wegen, erfahren aber nicht alle seine Pläne. In der dritten Episode erfährt er Dinge über das Schicksalsbuch, die er uns vorenthält, und auch über sein Vorhaben lässt er uns im Dunkeln. So lernen wir Anton zwar kennen und freunden uns mit ihm an, eine gewisse Distanz wird dabei aber nie überbrückt. Nichtsdestotrotz mag ich mir gar nicht vorstellen, dass die nächsten beiden Teile der Trilogie vielleicht nicht mehr aus seiner Sicht erzählt sein könnten, denn dann würde mir definitiv etwas fehlen. Gerade durch seine kleinen Fehler und Eigenarten wirkt Anton authentisch und sympathisch. Manchmal ist er ein Einzelkämpfer, obwohl es neben ihm doch viel mächtigere Magier gibt. Dennoch versucht Anton manchmal das Unmögliche, hat dabei aber stets das Gute im Blick und möchte ebensolches bewirken.
Neben Anton spielen Jegor und Swetlana eine wichtige Rolle, doch tauchen sie in diesem Band noch nicht so häufig auf, werden aber sicherlich in den Folgebüchern noch größeres Gewicht erhalten. Sowohl Swetlana als auch Jegor bleiben für uns undurchsichtig, auch wenn Teile ihrer Zukunft deutlich dargelegt werden. Aber es scheint, als habe sich ihr Schicksal noch nicht entschieden, und so dürfen wir gespannt sein, wie sich Swetlana und Jegor in der Trilogie weiterentwickeln. Zumindest eines ist klar: Auch sie erhalten einen Teil der Lesersympathien, auch wenn sie uns lediglich aus Antons Sicht geschildert werden und wir die beiden daher nicht gut genug kennen lernen.
_Mehr davon_
„Wächter der Nacht“ ist der Auftakt zu einer Trilogie, die sich dem Schattenreich Moskaus widmet und bereits viele Fragen aufwirft. Das Buch ist zwar in sich abgeschlossen, dennoch erklärt es am Ende nicht alles und lässt uns mit einigen Spekulationen zurück. Schon jetzt dürfte daher die Ungeduld der Leser auf die zu erwartende Fortsetzung groß sein. Sprachlich bedient Sergej Lukianenko sich einfacher Mittel, schmückt aber mit ausführlichen Beschreibungen und fantastischen Details seine Geschichte aus. Man merkt dem Text an, dass kein wortverliebter Literaturprofessor am Werke war, sondern ein kreativer Autor, der seine Leser dennoch zu fesseln weiß und an einigen Stellen viel Sinn für Humor beweist. Das Buch zu lesen, bereitet viel Freude, da man sich in einer ganz fremden Welt verlieren kann, außerdem macht es neugierig auf die Fortsetzung, die hoffentlich bald in deutscher Sprache erscheinen wird.
|Siehe ergänzend hierzu auch die [Rezension 1828 von Dr. Michael Drewniok.|