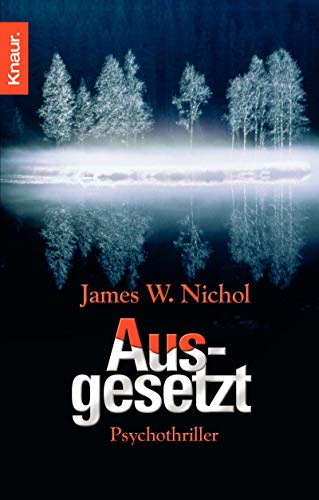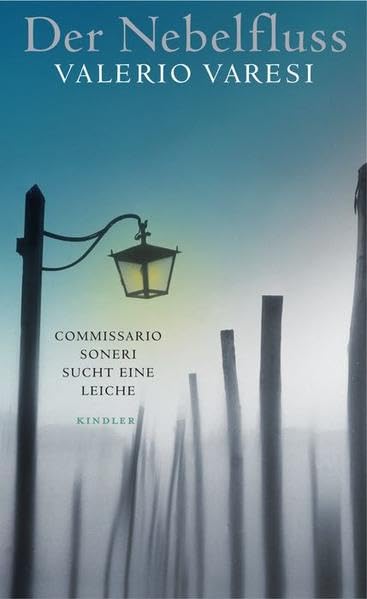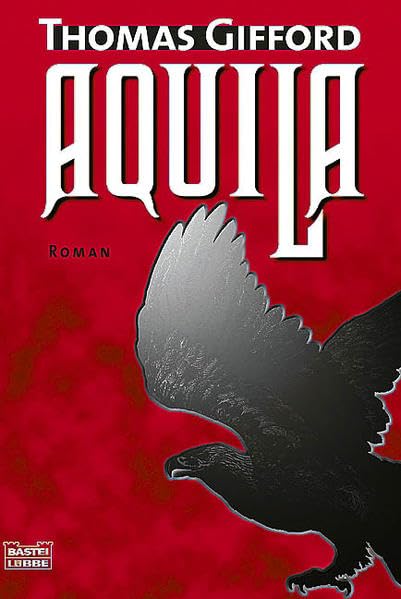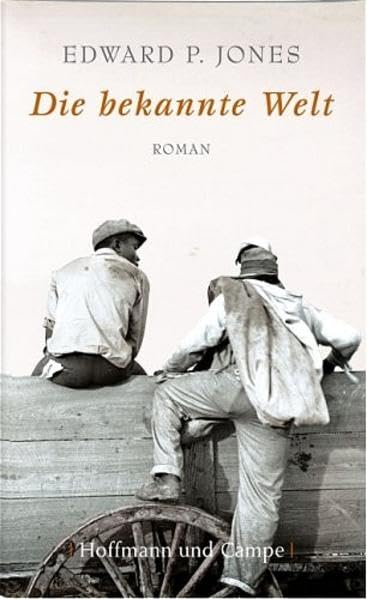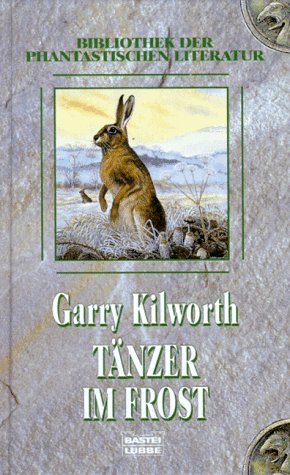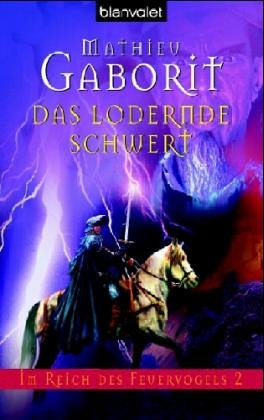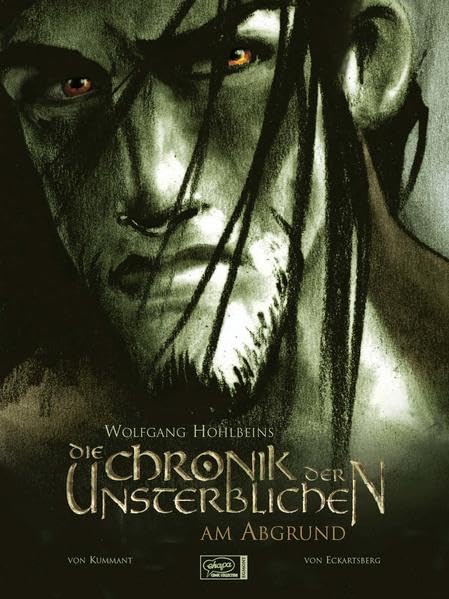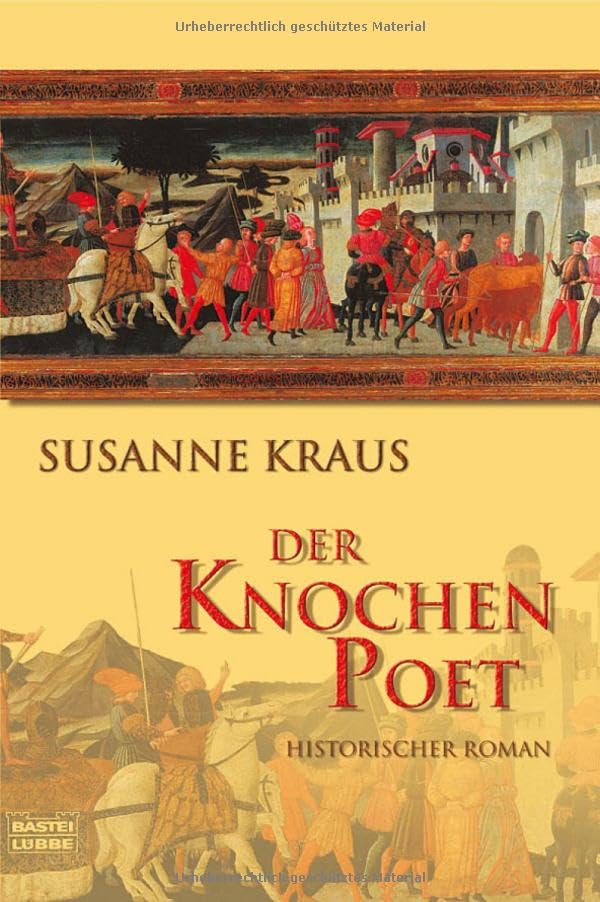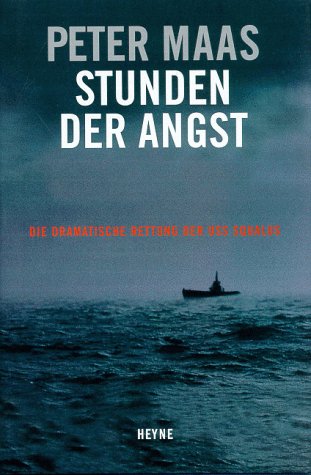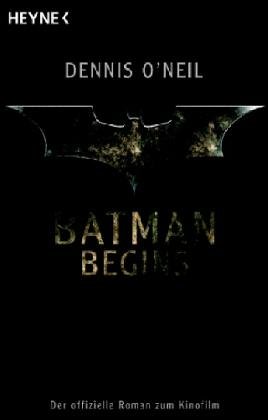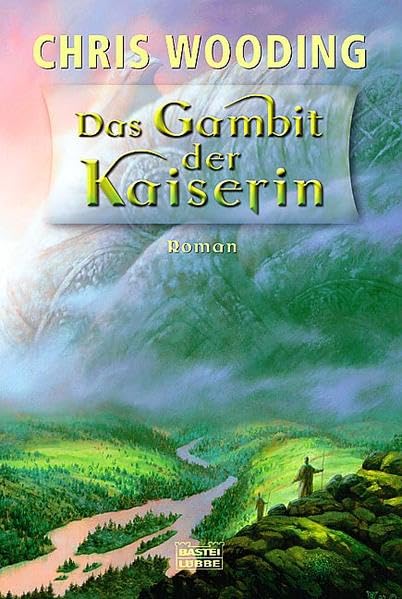Bei der _Rechtschreibreform_ kann von einer einheitlichen Schreibweise nicht mehr die Rede sein. Nunmehr gibt es drei verschiedene Schreibweisen: die der einstigen Rechtschreibkommission, die vom Rat der deutschen Rechtschreibung beabsichtigte Reform der Reformschreibung sowie die herkömmliche Rechtschreibung. Dennoch wurde dieses Chaos zum 1. August gesetzlich verbindlich gemacht, wie die Kultusministerkonferenz beschlossen hat. Der Vorstoß der CDU-regierten Länder, den Einführungstermin um ein Jahr zu verschieben, fand keine Zustimmung. Aus Rücksicht auf die Positionen des Rates für deutsche Rechtschreibung gilt für strittige Teile (vor allem Worttrennung und Interpunktion) eine „Toleranzklausel“. Am 31. Juli endete damit zunächst nur die Übergangsfrist für die Laut-Buchstaben-Zuordnung, die Schreibung mit Bindestrich sowie die Groß- und Kleinschreibung. Nach den Vorstellungen des Rates für deutsche Rechtschreibung soll in erster Linie der Sprachgebrauch die Richtschnur für die Formulierung von Schreibregeln sein. Der Zusammenschreibung wird gegenüber Getrenntschreibungen der Vorzug gegeben. Ende Oktober werden die Änderungsvorschläge abschließend erörtert und Ende November soll ein Beschluss fallen. Erst danach wird sich die Kulturkonferenz mit dem Gesamtpaket befassen. Die Forschungsgruppe Deutsche Sprache (FDS) hat mit den Stimmen des Verlegers Michael Klett und des Sprachwissenschaftlers Theodor Ickler (PEN-Vertreter im Rechtschreibrat) ihre grundsätzliche Ablehnung der Reform nochmals unterstrichen. Verlage, die sich an die neue Rechtschreibung halten wollen, müssen, obwohl die jetzigen Änderungen nur einen minimalen Teil des Wortschatzes betreffen, dennoch alle Titel durchsehen und an den entsprechenden Stellen ändern. Aus wirtschaftlicher Sicht ein Riesenaufwand und auch volkswirtschaftlich betrachtet ein Desaster. Eigentlich wird die neue Rechtschreibung nur bei Kinder- und Schulbüchern beachtet werden. Fast jeder sonstige Verlag überlässt es weiterhin jedem Autor, wie dieser schreiben will. Widersinniges und Unstimmiges wird also nicht zum Maßstab für literarischen Ausdruck werden. Die Verleger sehen überhaupt keinen Handlungsbedarf, solange alles weiterhin unsicher und strittig ist. Die 23. Auflage des „Duden“ war nach Inkrafttreten der Reform nach dem 1. August das einzige Wörterbuch, das dem verbindlich geltenden Stand der neuen Rechtschreibung entspricht, aber schon warf Bertelsmann zum 1. August mit dem „Wahrig“ ein Wörterbuch zu einem „Kampfpreis“ auf den Markt, das schon wieder etwas mehr von der Reform 2004 berücksichtigt hat. Im „Wahrig“ macht man es jetzt auch ganz taktisch klug, indem man neben der neuen auch die alte Rechtschreibung aufführt. Seit Jahren sind der „Duden“ und „Bertelsmann“ in harter Konkurrenz, mussten schon gedruckte Auflagen wegen Änderungen gleich einstampfen, verramschen ihre Titel oder verschenken sie an Schulen.
Selbst der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, sieht jetzt eine künftige „Zwei-Klassen-Schreibung“, da die neuen Gesetze nur für Schulen und Behörden verbindlich sind und ansonsten jeder Autor schreiben kann, wie er will.
Und es besteht noch anderweitig Verunsicherung, z. B. bei den Lehrern, die Deutsch für Ausländer unterrichten. Das Ausland versteht nicht, wieso die Deutschen sich nicht darauf einigen können, wie sie ihre Worte schreiben. Das Goethe-Institut geht deswegen einen wiederum ganz eigenen Weg und hält sich an die zuerst geplante Originalfassung der Reform, bis endgültige Klarheit über die strittigen Punkte herrscht. „Das kann man so oder so schreiben“ sei für Fremdsprachen-Lehrer zu schwierig. Die neue Gesetzeslage ist längst nicht das Ende eines langjährigen Kampfes zwischen unversöhnlicher Willkür auf der einen und Widerstand auf der anderen Seite. In NRW hat Jürgen Rüttgers nach dem Wechsel der Landesregierung sein Wahlversprechen wahr gemacht: „Die CDU wird nach einem Wahlsieg bei der Landtagswahl im Mai 2005 dafür sorgen, dass man zu den bewährten Regeln zurückkehrt“ und auch Bayern ist dem gefolgt. Zwei Länder sind zwei Wochen vor Eintritt der gesetzlichen Regelung ausgestiegen. Die Glaubwürdigkeit in der Politik lässt sich bereits an einem Wort der Rechtschreibreform festmachen. Diese hat versucht, den Unterschied zwischen „viel versprechend“ und „vielversprechend“ aufzuheben, indem es nur noch die getrennte Schreibweise zulassen wollte. Wenn man sich das ganze Geschehen anschaut, bleibt dieser Unterschied der beiden Begrifflichkeiten aber sehr offensichtlich.
Es wird viel darüber geklagt, wie viel Geld Wörterbuch- und Schulbuchverlage verloren haben durch all die jahrelangen Änderungen. Interessant ist da aber eine These, die in der „Jungen Freiheit“ vom 29. Juli aufgestellt wurde. Dort wird aufgezeigt, dass die Rechtschreibreform für Schulbuchverlage ein Milliardengeschäft war, finanziert durch die Steuerzahler. Nach Angaben des VdS Bildungsmedien, mächtigster Verband der Schulbuchverlage, schaffte die öffentliche Hand zwischen den Jahren 1996 und 2004 Schulbücher in reformierter Rechtschreibung im Wert von etwa zwei Milliarden Euro an. Eltern gaben allein im Jahr 2003 rund 200 Millionen Euro für Lernmittel aus. Gewisse Verbände haben eine Menge Geld eingesetzt, um der Reform zum Durchbruch zu verhelfen. So investierten die Schulbuchverlage rund eine halbe Million Mark, um den Volksentscheid in Schleswig Holstein im September 1998 zu beeinflussen, der aber für die Reformer dennoch verloren ging. „Zahlreiche Beamte in den Kultusministerien sind als Schulbuchverfasser privatgeschäftlich mit Verlagen verbunden“, erklärt der bekannteste Kritiker der Rechtschreibreform, der Erlanger Germanist Theodor Ickler. Im internen Bericht des Verbandes VdS Bildungsmedien für 2000 – das Jahr, in dem die „Frankfurter Allgemeine“ das Abenteuer Rechtschreibung beendete – heißt es: „Wir haben also nicht allein auf die Kultusminister, sondern auch auf alle Ministerpräsidenten der Länder massiv eingewirkt und diese in die Öffentlichkeit gezwungen mit klaren und unmissverständlichen Erklärungen zu einer Reformumsetzung“. Die „Junge Freiheit“ geht deswegen so weit, der Staatsanwaltschaft zu empfehlen, aufgrund offenkundiger Verdachtsmomente zu untersuchen, inwieweit bei der Durchsetzung der Rechtschreibreform auch Korruption eine Rolle spielt. Die Aufdeckung eines Bestechungsskandals wäre der Todesstoß für die Reform, würde aber auch aufgrund der Beteiligung von Regierungsbeamten eine Krise auslösen.
Am gefährlichsten für die _Preisbindung_ wird es immer, wenn ein neuer _Harry Potter_ erscheint und in Deutschland, wo diese gesetzlich festgesetzt ist, muss man immer sehr sorgsam nach den „schwarzen Schafen“ Ausschau halten. Anders in England, wo eine Preisbindung nicht existiert. Dort lag der Preis bei Vorbestellungen teilweise bei der Hälfte des empfohlenen Verkaufpreises von 16,99 Pfund und damit eigentlich beim Bezugspreis. 2003 hatte dort die Branche am ersten „Potter“-Verkaufstag elf Millionen Pfund an Nachlässen gegeben. Insgesamt wurde an jenem Tag ein Umsatz von 17,5 Millionen Pfund erzielt – mit 1,7 Millionen Exemplaren. Und bei der Premiere des 6. Bandes boomte es wie eh und je: In den ersten 24 Stunden wurden weltweit rund elf Millionen Exemplare verkauft. Zwei Millionen davon in Großbritannien, 6,9 Millionen in Amerika. In vielen Städten wird das Erscheinen eines neuen Harry Potters längst wie ein Ereignis von nationaler Bedeutung begangen. Auch in Deutschland war die Medienresonanz noch einmal höher als beim fünften Band vor zwei Jahren. So schnell auch gigantischer Umsatz gemacht wird, bleibt das Paradox, dass mit Potter nicht auch entsprechend verdient wird. Der Reinerlös ist mager, die Preise purzelten in den Keller und erreichten bisher ungeahnte Tiefen. In britischen Supermarktketten ging er für 7,25 Euro weg – also weit unter dem Einkaufspreis. Der empfohlene VK in Deutschland liegt bei 26,30 Euro, im Schnitt wird er aber für 19,90 Euro angeboten, am billigsten war er bei Mail-Order Kaiser für 14,99 Euro.
Die legalen „_Billig-Bibliotheken_“ laufen gut und gehen weiter. Die Lizenz für die „SZ“-Bibliothek ist ausgelaufen, aber der Süddeutsche Verlag konnte elf Millionen Bücher damit verkaufen. Die Restbestände wurden vom Barsortiment LIBRI erworben, das diese noch „weit über das Weihnachtsgeschäft“ hinaus an Buchhandlungen liefern wird. Auch Weltbild hatte mit seiner „Bild“-Bestseller-Bibliothek wie auch der Zeit-Verlag die Gewinnziele weit übertreffen können. „Die Zeit“ startet mit dem Partner Brockhaus zur Buchmesse eine zwanzigbändige wöchentliche Buchreihe zum Thema Welt- und Kulturgeschichte. Die „SZ“ plant ein Projekt Kinder- und Jugendbibliothek – Zielgruppe Sechs- bis Sechzehnjährige – ab September nach bewährtem Muster der „SZ-Bibliothek“ mit fünfzig Bänden, die jeweils 4,90 Euro kosten. Auch „Die Zeit“ wird im Frühjahr 2006 mit einer 15-bändigen Vorlesereihe mit Titeln, die als besondere Schätze der Kinderliteratur gelten, für Kinder von fünf bis zehn Jahren starten. Der Reinerlös aller verkauften Bücher fließt an die Stiftung Lesen, zur Förderung des Vorlesens. Sowohl „Bild“, „Weltbild“ und „FAZ“ bringen Comic-Bibliotheken. Die FAZ-Reihe „Klassiker der Comic-Literatur“ dürfte auch richtig lohnenswert werden bei einem Preis von 4,90 Euro pro Band. Es beginnt mit „Superman“ von 1938 und führt über „Spiderman“, „Batman“, „Prinz Eisenherz“, „Hägar“, „Peanuts“ und natürlich auch „Disney“.
Da das _Hörbuch_ mit unveränderten Zuwachsraten in Folge Geschichte schreibt, sind nun auch die letzten großen Belletristikverlage Diogenes und Holtzbrinck ins Hörbuch-Geschäft eingestiegen. Mittlerweile gibt es rund 400 Hörbuchverlage in Deutschland. Jetzt erwartet die Branche einen Lizenzwettbewerb, den es bislang so noch nicht gab. Von der Hörbuch-Edition der Frauenzeitschrift „Brigitte“ über Aktionen beim Discounter ALDI bis hin zum Focus-Magazin, das ein neues Download-Portal plant, ist das Hörbuch endgültig aus seiner Nischen-Position herausgetreten, mit allen Konsequenzen, die ein entwickelter Markt mit sich bringt. Es wird Verschiebungen geben, bei denen einige Labels auf der Strecke bleiben. Und „Random House Audio“ vertieft die Zusammenarbeit mit „Gruner + Jahr“. Nach der „Brigitte“-Audio-Edition „Starke Stimmen“ folgt nun eine zwölfteilige Hörbuchserie mit der Zeitschrift „Eltern“. Mit der Brigitte-Zusammenarbeit konnten eine Million Einzelexemplare verkauft werden.
_Amazon_ hat eine neue Sparte entdeckt: Verleihen statt verkaufen. Für 9,99 Euro werden drei DVDs im Monat verschickt, ohne zusätzliche Versandkosten, Leihfristen und Säumnisgebühren. Die Kunden müssen nur die geliehene DVD im versankostenfreien Umschlag zurückschicken, um umgehend den nächsten verfügbaren Film von der Ausleihliste zu erhalten. Es gibt darüber hinaus sogar verschiedene Tarifmodelle: Für 13,99 Euro kann man vier DVDs monatlich ausleihen (zwei davon gleichzeitig) und für 18,99 Euro sechs DVDS (drei Titel gleichzeitig). Das ist ein Testlauf dafür, ob man künftig auch Hörbücher und Bücher in die Vermietung einbeziehen wird.
_Suhrkamp_ bringt die im angeschlossenen _Deutschen Klassiker Verlag_ erschienenen Editionen deutscher Literatur ins Taschenbuch. Im Oktober erscheinen die ersten Bände, darunter Goethes Faust, „Sämtliche Erzählungen“ von Kleist und Grimmelshausens „Simplicissimus“ – jeweils Text und Kommentar. Die meisten der herstellerisch hochwertigen Bände sollen ca. 18 Euro kosten und in einer Auflage von 5000 Exemplaren erscheinen. Von den 200 Hardcoverbänden, die in 40 Editionen erschienen sind, will man 90 Titel im Taschenbuchformat in den Handel bringen. Ab Frühjahr 2007 sollen in der _Suhrkamp Studienbibliothek_ grundlegende philosophische Texte nebst Kommentar von Aristoteles bis Habermas erscheinen. Offensichtlich hat sich nach den Unruhen im Verlagshaus (wir berichteten intensiv) sehr viel geändert. Das sieht man deutlich am aktuellen Suhrkamp-Taschenbuchverlagsprogramm und der Werbung dafür, die im Gegensatz zur Tradition richtiges Marketing umfasst. Die Zeiten, wo die Vermarktung von Hermann Hesse ausreichte, scheint vorbei. Angefangen hat das vor einem Jahr mit der Neugestaltung der erfolgreichen Taschenbuchreihe mit dem Kürzel st. Die Titelzahl wird reduziert und die traditionell starke Backlist verkleinert.
Der Fachverlag _Max Niemeyer_ hat seine Eigenständigkeit verloren und wurde an _Thomson Learning_, die Bildungssparte des amerikanischen Fachinformationskonzerns _Thomson Corporation_, verkauft. Die Zustimmung durch das Bundeskartellamt muss aber noch erfolgen. Niemeyer fungiert künftig als Imprint der _K. G. Saur_ Verlagsgesellschaft, die bereits Ende 2000 von Thomson eingekauft wurde. Niemeyer gehört zu den führenden Geisteswissenschaftsverlagen Deutschlands. Das anspruchsvolle Profil soll erhalten und ausgeweitet werden. Die Arbeitsplätze der gegenwärtigen Mitarbeiter wurden von Thomson nun erst einmal für ein Jahr garantiert.
Die _Wissenschaftliche Buchgesellschaft_ in Darmstadt hat den Verlag _Philip von Zabern_ (Fachverlag für Klassische Archäologie, Kunst und Kulturgeschichte) übernommen. Zur Verlagsgruppe der WBG gehören bisher die Verlage Primus, Konrad Theiss sowie die Versandbuchhandlung Conlibro.
Anthroposophen brauche mitunter etwas länger für neue Technik, dafür umso berichtenswerter ist, dass nun auch der _Pforteverlag_ online ist und auf Besucher wartet. Die Seiten werden in den nächsten Wochen noch laufend ergänzt, doch lohnt sich jetzt schon auf alle Fälle ein Blick ins Angebot: http://www.pforteverlag.com.
_Indizierungen_ erreichen derzeit einen neuen Höhepunkt. Die neueste dahingehende Welle betrifft die deutschsprachige Hiphop- und Rap-Szene, deren sexualisierte Texte als jugendgefährdend beurteilt werden. Man kann sich darüber mühsam streiten, sicherlich geht manches an die Würde der Frau und überzeichnet ein menschenverachtendes Bild. Nun werden Sendeverbote in den Rundfunkanstalten gefordert, was bis zum immer wieder vorkommenden Wort „ficken“ reicht. Also Zustände wie in Amerika. Im ganzen Medienrummel schwingt auch die durchaus berechtigte Angst vor Rechts wieder hoch. Selbst einem Linksbündnis wird rechte Gesinnung mediengerecht unterstellt. Und damit das klar zum Ausdruck kommt, gelten nunmehr auch wieder die „Böhsen Onkelz“, die sich wiederholt von rechtem Gedankengut distanziert hatten, als Verbreiter rechter Propaganda. Auf ihrem Abschlusskonzert auf dem Lausitzring hatten sie vor über 100.000 Zuschauern noch einmal Songs ihres ersten Albums gespielt. Das Landeskriminalamt Brandenburg hat sofort gegen die Band Anzeige erstattet.
Nachdem es im letzten Jahr während der Frankfurter Buchmesse zu großem Unbehagen führte, dass die _Verleihung des Friedenspreises_ nach jahrelanger Ausstrahlung durch die ARD von diesen kurzfristig abgesetzt wurde, führte der Protest dagegen zum Erfolg. Ab diesem Jahr wird die Verleihung aus der Frankfurter Paulskirche nun wieder jährlich abwechselnd vom ZDF und der ARD übertragen. Die diesjährige Verleihung wird am 23. Oktober um 11 Uhr live vom ZDF ausgestrahlt.
|Das Börsenblatt, das die hauptsächliche Quelle für diese Essayreihe darstellt, ist selbstverständlich auch im Internet zu finden, mit ausgewählten Artikeln der Printausgabe, täglicher Presseschau, TV-Tipps und vielem mehr: http://www.boersenblatt.net/. |