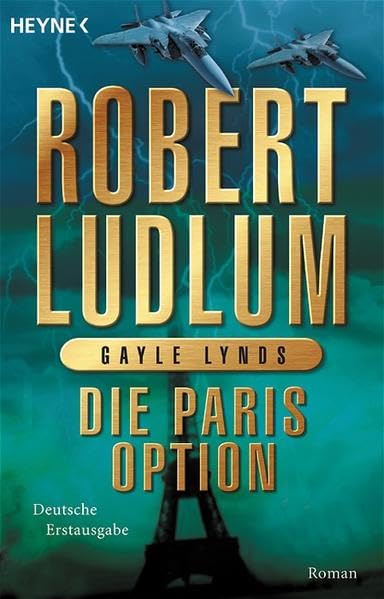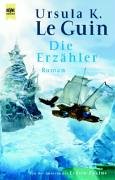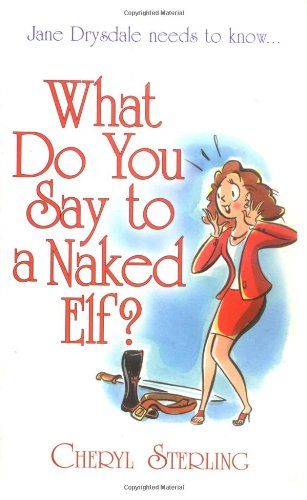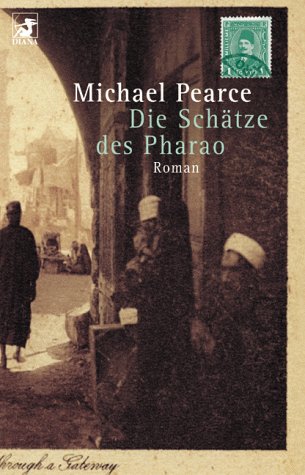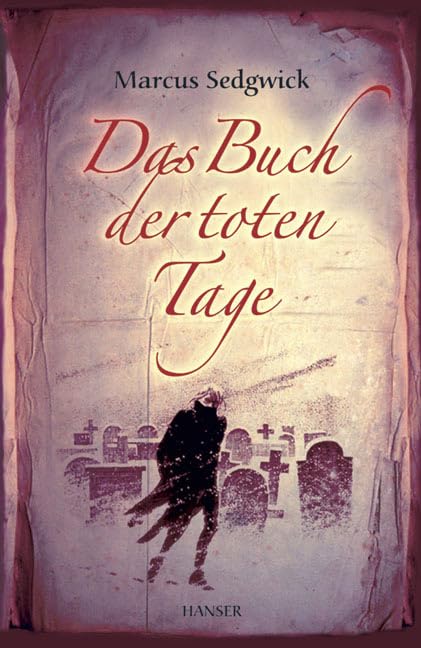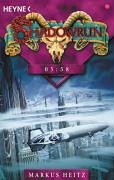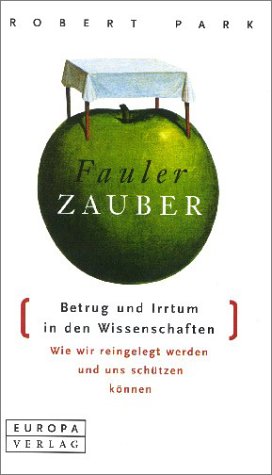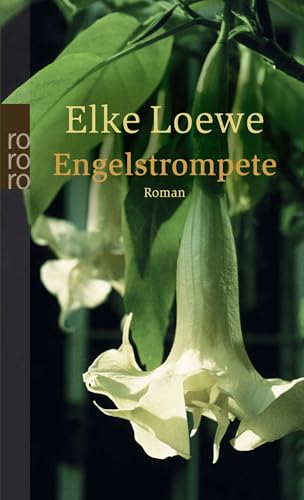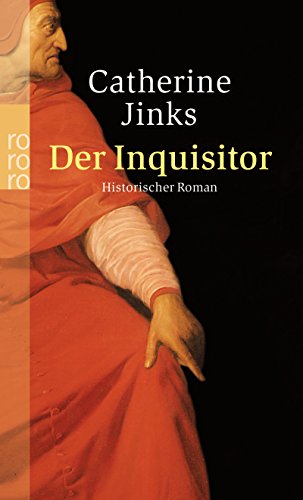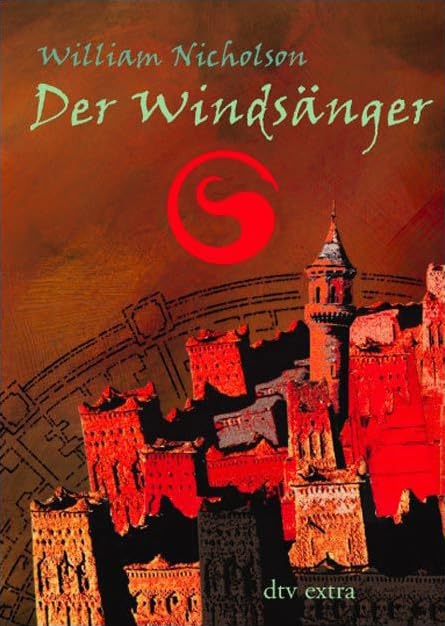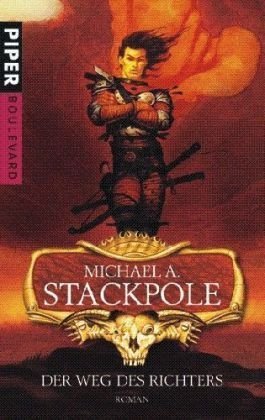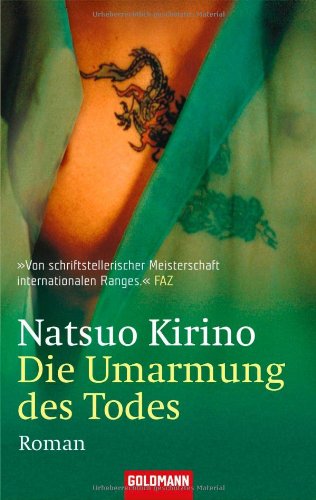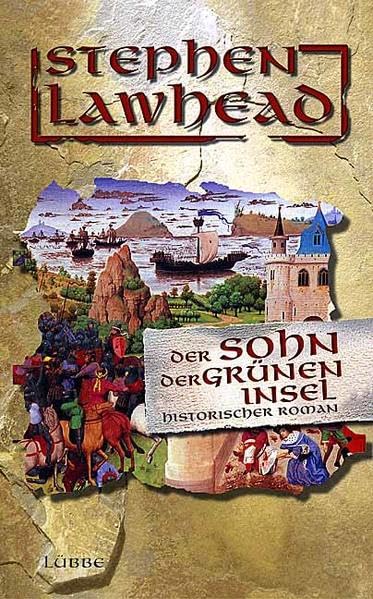_Mrs. Rambo und die Nackenbeißer_
Anita Blake’s Hauptberuf wäre für manche Leute schon Abenteuer genug, denn sie arbeitet als Animator, was bedeutet, dass sie auf Aufträge hin Tote als Zombies zum Leben erweckt. Wozu das gut sein soll? Nun – zum Beispiel, um rechtliche Nachlassstreitigkeiten zu regeln oder Versöhnungsgespräche mit Toten führen zu können. Wahrlich kein langweiliger Schreibtischjob. Doch nebenbei dient Anita auch noch der örtlichen Polizei in St. Louis als sachkundige Expertin in anderweltlichen Fragen und arbeitet als Vampirjägerin, ein Feld in dem sie sich den Beinamen „The Executioner“ erarbeitet hat.
Denn die USA haben zwar diverse untote und paranormale Lebensformen als legal anerkannt, diese Kräfte jedoch unter rechtlicher Kontrolle zu halten und dafür zu sorgen, dass Vampire, Werwesen, Ghoule, Zombies und andere mehr oder weniger menschliche Gestalten nicht außer Kontrolle geraten, ist für die Polizei zu einem echten Problem geworden.
So wird Anita denn auch hinzugerufen, als in St. Louis ein Mörder umgeht, der Vampire und selbst die besonders alten und mächtigen Meistervampire gnadenlos abschlachtet. Ins Jenseits befördert, wäre hier vielleicht der falsche Ausdruck. Nicht nur die Polizei heuert Anita an, sondern auch eine Gruppe um die örtliche Meistervampirin Nikolaos sichert sich durch Drohungen und Erpressungen ihre Arbeitsdienste in diesem Fall.
Die Ermittlungen führen Anita quer durch das Vampir-Vergnügungsviertel von St. Louis von der örtlichen Vampir-Strip-Bar „Guilty Pleasures“ über ein Treffen mit der Vereinigung „Menschen gegen Vampire“, ein Treffen mit dem Obervampir der „Kirche des Ewigen Lebens“ und auf eine Vampirfanparty. Schon bald glaubt Anita. einen ersten Hinweis zu haben, ihre Ermittlungen werden jedoch erschwert, als sie zwischen die Fronten eines Machtkampfes der Vampiranführerin Nikolaos mit dem Meistervampir Jean-Claude gerät.
_Autorin mit blutrotem Lippenstift_
Laurell K. Hamilton wurde in Heber Springs, Arkansas geboren, wuchs jedoch in einem kleinen Ort im Staat Indiana auf. Nach dem Tod ihrer Mutter 1969 wurde sie von ihrer Großmutter erzogen. Bereits im Alter von 13 Jahren beschloss sie nach der Lektüre von Robert E. Howards Geschichtensammlung „Pigeons from Hell“, dass sie selbst eine Autorin übersinnlicher Horrorstorys mit Fantasyelementen werden wollte. Sie hat einen Uni-Abschluss in Englisch und Biologie. Nach zahllosen Ablehnungen gelang ihr erstmals 1989 die Veröffentlichung einer Kurzgeschichte in Marion Zimmer Bradley’s |Fantasy Magazine|. Ihr erster Roman „Nighseer“ erschien 1992. Danach verfasste sie einen „Ravenloft“-Roman und einen „Star Trek“-Roman, bevor sie 1993 mit „Guilty Pleasures“, dem ersten Teil der Anita-Blake-Serie, den endgültigen Durchbruch erreichte. Die Serie verkaufte sich zunehmend besser und im Jahr 2000 kam der erste Band der zweiten, unabhängigen Serie, der Merry-Gentry-Reihe über eine Feen-Prinzessin, die als Privatdetektivin in LA arbeitet, auf den Markt. Beide Serien sind noch nicht abgeschlossen.
„Guilty Pleasures“ ist der erste Band der Anita-Blake–Serie. Die genauere Auflistung samt Übersetzungstiteln (soweit vorhanden, es sind noch längst nicht alle Titel übersetzt):
1. Guilty Pleasures (dt. Bittersüße Tode)
2. The Laughing Corpse (dt. Blutroter Mond)
3. Circus of the Damned (dt. Zirkus der Verdammten)
4. The Lunatic Café
5. Bloody Bones
6. The Killing Dance
7. Burnt Offerings
8. Blue Moon
9. Obsidian Butterfly
10. Narcissus in Chains
11. Cerulean Sins
12. Incubus Dreams
13. Danse Macabre (erscheint 2006)
_Bis an die Zähne bewaffnet_
Laurell K. Hamilton gelingt das seltene Kunststück, den Leser von der ersten Seite an zu fesseln. Vampirgeschichten, besonders wenn sie ins Grenzgebiet eines Genres namens |Vampire Romance| gehören, sind oft niederste Werke der Trivialliteratur. Hamilton erhebt sich hier angenehm von den billigen Plätzen und gewährt dem Vampirroman einen erstklassigen Logenplatz in der Spannungsliteratur. Dies schafft sie unter anderem dadurch, dass sie sich nur sehr selten auf die Spuren breitgetretener Klischees begibt und zudem gekonnt ihre nicht zu unterschätzenden Schreibkünste einsetzt. Zudem geizt sie wahrlich nicht mit Splattereffekten. Und obwohl das Buch durch seine mehr als nur unterschwellige erotische Stimmung durchaus zu den |Vampire Romances| gezählt werden kann, lässt sie sich beispielsweise nicht auf platte Liebesszenen ein. Weiter als ein paar – zugegebenermaßen tiefe – Küsse und Bisse kriegt der Leser in dieser Hinsicht zumindest nichts geboten, doch das reicht der Autorin, um eine schwindelerregende erotische Spannung fast durch das gesamte Werk hindurch aufrecht zu erhalten. Zudem konzentriert sie sich trotz der Knisterspannung auf den kriminalistischen Aspekt der Geschichte und die Horrorelemente und lässt die Geschichte nicht zu einer bloßen Sex-Klitsche verkommen. Der Leser will vor allem wissen, wer der Vampirmörder ist und wie Anita sich aus ihrer verfahrenen Situation herauswinden wird. Und an diesen Fragen arbeiten Anita und ihre Autorin hart und zur vollsten Zufriedenheit des Lesers.
Die Charakterisierung Anitas selbst ist sicher gelungen. Die Geschichte wird in der ersten Person aus ihrem Blickwinkel erzählt, dadurch erhält der Leser Einblick in ihre Gedanken und Ansichten. Als eine Mischung aus Stephanie Plum (mit dem weitreichenden Unterschied, dass Anita wirklich ein Profi ist, ihre Pistole nicht in der Keksdose aufbewahrt und auch stets bis an die Zähne bewaffnet durch die Lande kreuzt), Rambo und den Ghostbusters lässt sie sich von ihren zumeist überlegen erscheinenden Gegnern nicht unterkriegen und zaubert auch in der verfahrensten Situation immer noch ein Ass aus dem Ärmel. Dabei wirkt sie aber trotz ihrer Künste menschlich, mit ihren kleineren Schwächen und Fehlern. Gestört hat mich an ihr die etwas zu amerikanisch anmutende Denk- und Redeweise. Da wirken einige Sätze überzeichnet, zu „tough“, zu gekünstelt. Auch einige der zynischen Bermerkungen und Gags wiederholen sich hier ein wenig.
Ein aufwertender Aspekt des Buches ist es in meinen Augen unbedingt, dass Hamilton das Thema Untote und Vampire vielschichtig beleuchtet. So ist in Anitas Welt die Attraktivität der Kirche des Ewigen Lebens (einer Vampirkirche) nicht unlogisch damit begründet, dass die Menschen sich vor dem Tod und dem unbekannten „Danach“ fürchten. Auch wenn Anita sich fragt, was mit der Seele der Untoten, denen sie den letzten Rest gegeben hat, passiert, zeigt sich diese ambivalente Ansichtsweise. Die Vampire selbst werden ebenfalls vielfältig dargestellt: Da gibt es sowohl emotionslose Blutsauger als auch verständnisvolle Vertreter der Gattung, die in den Menschen um sie herum mehr sehen können als Blutspender. Nur so ist auch die aufregende Kombination aus Horror, Sado-Maso-Vampirismus und einer bittersüß-sinnlichen Anziehungskraft einzelner Vampire zu verstehen. Anitas Einstellung diesen Vampiren gegenüber ist ebenso gespalten. Denn obwohl sie sich nach ihrer Arbeit als Vampirjägerin immer wieder sagt, dass alle Vampire tote Monster sind, kann sie sich doch einer gewissen Anziehungskraft – insbesondere der langzahnigen Sahneschnitte Jean-Claude – nicht erwehren. Da der Leser in der Regel bereits wissen wird, dass es sich bei diesem Buch um den ersten Band einer Serie handelt, wird eine gewisse Erwartungshaltung in diese Beziehung hineingebaut, was die Folgebände betrifft.
Natürlich gibt es auch jede Menge normaler und paranormaler Nebenpersonen in der Geschichte. Leider sind einige dieser Charaktere nicht kräftig genug gezeichnet und erscheinen farblos, was durch die große Anzahl an Nebenprotagonisten noch unnötig betont wird.
Etwas vermissen muss der Leser auch einige Erklärungen zu der Welt, in der diese Geschichte spielt. Denn weder ist es eine fremde, konstruierte Welt in Fantasymanier, noch spielen die Romane in ferner Zukunft. Stattdessen könnte man von unserer Zeit und unserer Erde ausgehen, mit der Ausnahme, dass diese Alternativwelt von zahlreichen Untoten, Werwesen und anderen paranormalen Gestalten mitbewohnt wird.
Es gibt zu diesem Zeitpunkt keine richtigen Erklärungen für den Leser, welcher Umstand das Auftauchen der Untoten herbeigeführt hat und wo und wie sie vor ihren öffentlichen und legalen „Leben“ ihre Zeit verbracht haben. Und diese Zeit muss es ja gegeben haben, denn wenn die Vampirmeisterin Nikolaos mit ihren über eintausend Jahren auch ein geradezu antiker Sonderfall zu sein scheint, so sind doch einige der Langzähne schon seit hundert Jahren und mehr dem Vampirdasein verschrieben. Hierzu erhält der Leser keine Einführung, keine Erklärung und wird ohne lange Vorreden in diese Alternativwelt hineingeworfen.
Trotz einiger kleineren Kritikpunkte halte ich „Guilty Pleasures“ jedoch für einen gelungenen und vielversprechenden Einstieg in eine fesselnde Serie zwischen Horror, Sex und Crime.
|Originaltitel: „Guilty Pleasures“, Jove, 1993|
Homepage der Autorin: http://www.laurellkhamilton.org