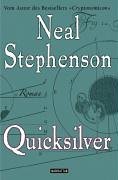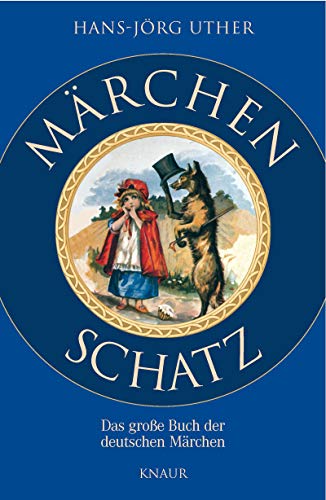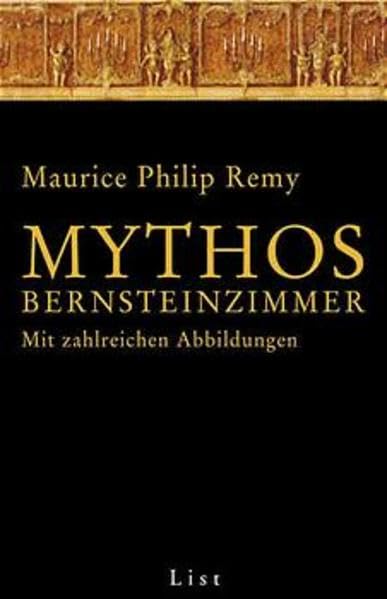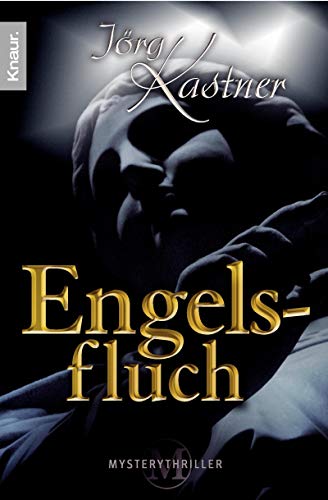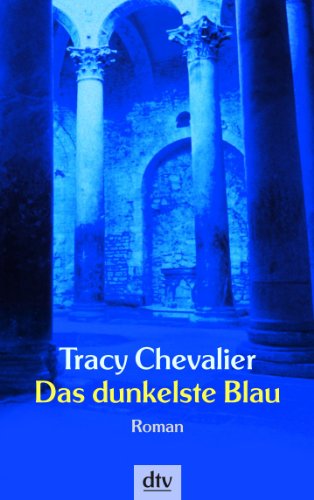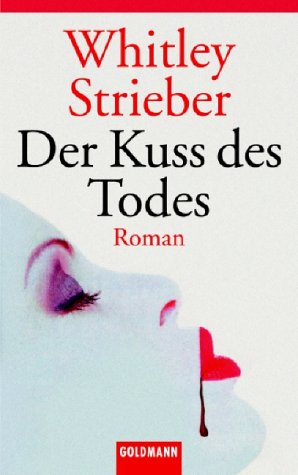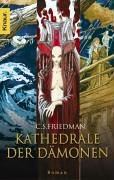Lloyd Biggle jr. – Spiralen aus dem Dunkel weiterlesen
Lowder, James – Prinz der Lügen, Der (Vergessene Reiche: Die Avatar-Chronik Band 4)
Einst erschütterte die Zeit der Sorgen das Gefüge der Welt. Die Götter waren von Ao verdammt worden, in den Reichen zu wandeln, um die Tafeln des Schicksals zurückzuholen. Einige Götter ließen dabei ihr Leben und Menschen nahmen ihren Platz im Pantheon ein: Mitternacht und Cyric. Einst Freunde, nun verhasste Feinde.
Die Götter sind zurück an ihrem angestammten Platz und wachen wieder über die Geschicke der Welt. Noch immer sind sich Mitternacht – nun Mystra, die Göttin der Magie – und Cyric – Gott der Lügen, Intrigen, des Todes und des Chaos’ – spinnefeind. Cyric plant gar, sich zum einzig wahren Gott aufzuschwingen. Sein Schwert, Götterfluch, leistet ihm dabei gute Dienste, denn es vermag Götter zu töten.
Cyric ist ein erbarmungsloser Gott, der keine Gnade kennt und selbst in seinem Totenreich Unmut hervorruft. Die Götter bitten Ao, Cyric zu bestrafen, doch Cyrics Handeln entspricht seinen Aufgabengebieten als Gott – er kann nicht bestraft werden.
Nur Mitternacht vermag scheinbar zu erkennen, wie gefährlich Cyric ist. Doch auch andere, verborgene Machtgruppen ziehen die Fäden im Hintergrund. Aber ihre genauen Ziele sind unbekannt.
Cyric scheint niemand aufhalten zu können. Er lässt ein magisches Buch schreiben, um alle Andersgläubigen auf seine Seite zu ziehen. Und er ist kurz davor, seine Rache an dem Mann zu vollenden, der ihm einst ebenbürtig war: Kelemvor. Doch dessen Seele wird von einer fremden Macht verborgen – selbst Mitternacht vermag ihren ehemaligen Geliebten nicht zu finden.
Der Prinz der Lügen – Cyric – ist kurz davor, alle seine Ziele zu erreichen …
Mit „Der Prinz der Lügen“ wächst die Avatar-Trilogie zur Avatar-Chronik heran und spinnt den Faden weiter, der in der Zeit der Sorgen seinen Anfang nahm. Denn gerade jetzt erleben die „Vergessenen Reiche“ eine spannende Zeit, die vor allem Fans der Reihe miterleben möchten. James Lowder weiß, zum Glück, die Vorlage der Trilogie gut zu nutzen.
Im Mittelpunkt steht der Konflikt zwischen Cyric und Mitternacht. Letztere nennt sich als Göttin der Magie Mystra und bildet einen Gegensatz zur Bösartigkeit Cyrics. Beide waren einst Menschen und vermögen über den Tellerrand der Göttlichkeit hinwegzuschauen. Und genau das macht sie gefährlich, den anderen Göttern gegenüber vielleicht sogar überlegen.
Cyric macht seinen Aufgabengebieten alle Ehre. Er metzelt alles nieder, kennt keine Skrupel und spinnt tödliche Intrigen. Dabei geht es oftmals brutal und blutig zu. Der Autor nimmt kein Blatt vor den Mund und stellt die entsprechenden Szenen sehr plastisch dar. Das ist dann allerdings Geschmackssache – wobei die Brutalität nicht Mittel zum Zweck ist, sondern Cyrics bösartigen Charakter aufzeigt.
Während sich Cyric in der Götterwelt schnell zurechtfindet, hat Mitternacht Anpassungsschwierigkeiten. Sie begreift nur langsam, was Göttlichkeit bedeutet und wie die anderen Götter die Welt wahrnehmen. Und das ist schlussendlich Mitternachts wahre Stärke im Kampf gegen Cyric. Das Charakterspiel der beiden Hauptfiguren und ihr greifbarer Konflikt sorgen für die nötige Spannung.
Überhaupt: Der Spannungsbogen steigt stetig an. Das wird hauptsächlich durch die vielen verschiedenen Handlungsebenen und Schauplätze erzielt – ohne den Leser zu verwirren. Man behält stets den Überblick und kann sich gut in die Figuren des Romans hineinversetzen. Sie sind sehr farbig und beleben das Bild, das James Lowder zeichnet.
Der Autor besitzt einen plastischen und detaillierten Stil, mit dem er die Geschichte packend transportiert. Gefesselt verfolgt man das Schicksal der Götter, der Menschen und der Halbmenschen. Obwohl diese den Göttern unterlegen sind, lassen sie sich nämlich nicht alles gefallen. Ganz im Gegenteil: Einige von ihnen wissen sich richtig zu wehren – selbst im Leben nach dem Tod.
Man merkt sehr schnell, dass Lowder gerne mit Überraschungen arbeitet. Intrigen und Verwirrspiele scheinen ihm zu liegen, aber auch große Wendepunkte werden vom Autoren gezielt eingesetzt. Sein Roman ist einfach fesselnd und sorgt für kurzweilige Unterhaltung. Fans der Reihe und Kenner der Reiche kommen an dem Buch jedenfalls nicht vorbei, behandelt es doch auch einen der wichtigsten Zeiträume der Buchreihe.
Die Schauplätze und Figuren überraschen übrigens durch ihre Kreativität und Vielfalt. So gibt es nicht nur Menschen und Götter, sondern unternimmt der Leser Ausflüge auf andere Ebenen, verfolgt die Erlebnisse einer getäuschten Seele und erlebt die Befreiung einer gefährlichen Bestie. Großartige Zaubereien, gefährliche Kämpfe und mechanische Kreaturen – Lowder kocht ein appetitliches Süppchen aus fantastischen Zutaten. Einfach wunderbar.
Auch die Aufmachung des Buchs ist gelungen. Das düstere Cover ist passend gestaltet, Titel und Detailangaben dynamisch angeordnet. Das Schriftbild ist klar und lässt sich gut lesen. Jedes Kapitel wird durch eine kurze Inhaltsangabe eingeleitet, über der sich das Symbol Cyrics befindet – immerhin wurde der Roman auch nach ihm benannt: Der Prinz der Lügen.
Das Buch schließt mit Verlagswerbung ab. Zum einen gibt es einen Ausblick auf den nächsten Teil der Avatar-Chronik (Band 5: Die Feuerprobe), zum anderen wird auch auf die weiteren Romane der „Vergessenen Reiche“ hingewiesen. Nicht fehlen darf die Information zum Rollenspiel „Dungeons & Dragons“, das von Feder & Schwert verlegt wird und die Grundlage der Romane bildet. Immerhin sind die „Vergessenen Reiche“ Bestandteil dieses Spiels.
Einzig wirkliche Schwachpunkte liegen im Lektorat, dem zwei große Fehler unterlaufen sind. So findet man an zwei auffälligen Stellen noch englische Begriffe. Da wäre das Wort Skyline, bei dem man aber getrost ein Auge zudrücken darf. Schlimmer ist jedoch, das Fürst Schach plötzlich Fürst Chess genannt wird. Das ist zwar nicht besonders schlimm, aber trotzdem auffällig und stört kurz ein wenig den flüssigen Lesefluss.
Unter dem Strich bleibt ein gelungenes Fantasy-Buch, das man gerne liest.
|Originaltitel: Prince of Lies
Übersetzung: David Raphael Flor
Lektorat: Oliver Hoffmann|
_Günther Lietz_ © 2005
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de veröffentlicht.|
Reginald Hill – Die rätselhaften Worte
Mid-Yorkshire in der gleichnamigen englischen Grafschaft zum Schau- und Spielplatz des bizarren und in Serie mordenden „Wordman“. So nennen die Journalisten mit der für ihre Spezies typischen Begeisterung jenen offenbar geistesgestörten aber wohl organisierten Unhold, der damit beginnt, die örtliche Prominenz nach einem seltsamen Schema auszurotten. Zunächst bringt niemand den ersten „Dialog“ mit dem ungeklärten Tod eines Handwerkers in Verbindung, der offenbar einem Unfall zum Opfer gefallen ist. Der Text liegt in einem prall gefüllten Postsack, der in der Mid-Yorkshire-Stadtbibliothek eintrifft. Dort hat man die einheimischen Freizeit- und Nachwuchs-Literaten aufgefordert, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Gesucht wird die beste Kurzgeschichte, und das hat den Wordman auf den Plan gerufen.
Erst Mord Nr. 2 ruft Detektiv Superintendent Andrew Dalziel, Chief Inspector Peter Pascoe und Sergeant Edgar Wield vom Mid-Yorkshire Criminal Investigation Departments auf den Plan: Jax Ripley, Nachrichtenredakteurin eines regionalen Senders, wird zur Hauptperson seines zweiten „Dialoges“, was für die ehrgeizige Frau das Todesurteil bedeutet. Reginald Hill – Die rätselhaften Worte weiterlesen
Stephenson, Neal – Quicksilver (Barock 1)
_Vorspann_
Das ausgehende 17. Jahrhundert war besonders für Europa eine erbauende Zeit – auch wenn die richtig großen Fortschritts-Schübe noch eine Weile auf sich warten lassen sollten. Die Nachwehen des 30jährigen Kriegs wurden allmählich überwunden. Wirkliche Demokratie war noch ein ganzes Stück entfernt, dazu verbrauchten sich die untereinander eng verwandten europäischen Monarchen in endlosen Kleinkriegen. Aber dennoch begann die Aufklärung durch die Lande zu leuchten. Das, was die Heutigen als „Wissenschaft“ („Science“) wahrnehmen, das nahm ganz allmählich heute noch vertraute Formen an. Und deswegen sollten Erzählungen vor diesem historischen Hintergrund auch für die Heutigen durchaus verständlich und spannend sein. Besonders für Leute aus dem angelsächsischen Sprachraum, denn vor gut 300 Jahren lebte in England mit Isaac Newton eine der wichtigsten Gründungsfiguren moderner Wissenschaft. Und dazu erhob sich ganz allmählich eine ernst zu nehmende englische Seemacht. Und in dieses Umfeld begibt sich Neal Stephenson mit seinem monumentalen Roman „Quicksilver“.
_Neal Stephenson_
… gilt seinen zahlreichen Verehrern als herausragender Science-Fiction–Autor. Er wurde 1959 geboren und lebt in der Nähe von Seattle. „Science““hat er sicher schon als Kind mitbekommen, entstammt er doch einer Familie, die bereits seit Generationen allerlei naturwissenschaftliche Professoren hervorgebracht hat. Er selbst studierte zuerst Physik, dann Geografie. Beides sollte sich für dieses Buch als hilfreich erweisen. Bereits mit Ende zwanzig konnte er erste Erfolge im Feld der „Fiction“ aufweisen. Auf sein Konto gehen vergnügt verschrobene Abenteuer-Erzählungen wie der Erstling „Zodiac“ (1988) oder „The Diamond Age“ (1995). Dazu das bahnbrechend visionäre „Snow Crash“ (1992) und der erstaunliche Bestseller „Cryptonomicon“ (1999).
„Quicksilver“ ist der erste Teil seiner etwa zwischen 1670 und 1720 spielenden „Barock“-Trilogie. Er behauptet dazu weiterhin, nichts anderes als eben „Science Fiction“ zu schreiben. So mancher Leser mag sich allerdings eher im historischen Roman oder einem schön altmodischen Mantel- und Degen-Epos wähnen. Keine Raumschiffe hier, auch keine Computer (nur frühe Ideen dazu).
_Das Buch_
„Quicksilver“ ist zunächst einmal rein haptisch ein überaus beeindruckendes Werk. Der im September 2004 als |Manhattan|-Buch im |Goldmann|-Verlag erschienene Schmöker wiegt 1,3 Kilogramm und hat (ohne Personenverzeichnis) satte 1130 Seiten Text, eng bedruckt. Wohl wegen des außerordentlichen Umfangs leistete sich der Verlag gleich zwei Übersetzer (Juliane Gräbener-Müller und Nikolaus Stingl). Die Ausstattung orientiert sich sehr eng am amerikanischen Original (habe mittlerweile die beiden Fortsetzungen gelesen). Sie ist hochwertig, den Preis von 29 Euro durchaus rechtfertigend. Aber warum wurde eigentlich der Titel (auf Deutsch „Quecksilber“) nicht übersetzt? Wird der nächste Teil dann auch „The Confusion“ heißen?
_Was passiert?_
Der Riesenwälzer besteht aus drei zeitlich und in der Handlung miteinander verwobenen „Büchern“, mit zahllosen Handlungssträngen und kurzen Gastauftritten allerlei bekannter Figuren der Zeit. Die Namen der Hauptfiguren jedoch dürften dem geneigten Fan schon aus „Cryptonomicon“ bekannt vorkommen.
Auftritt Daniel Waterhouse, Querdenker, Puritaner und Verächter der überkommenen Alchemie. Er teilt sich das College-Zimmer mit – Isaac Newton! – und befreundet sich nebenbei mit allen verfügbaren realen Geistesgrößen, von Hooke über Wren zu Pepys und Leibniz. Na ja.
Gleichzeitig: Jack Shaftoe wird vom Londoner Henkersgehilfen zum legendären König der Vagabunden. Er reitet und schwingt das Schwert, riskiert Leib und Leben für sein Glück und seine Liebe – und verliert durch die Syphilis schleichend den Verstand.
Gleichzeitig: Eliza, als Sklavin von einem finsteren, verdorbenen Fisch futternden französischen Admiral einst aus dem fiktiven Land ihrer Herkunft (irgendwo in Großbritannien) geraubt, hat es zur türkischen Haremsdame gebracht. Dabei ist sie noch nicht mal volljährig! Der Obertürke nimmt sie mit nach Wien, dort befreit Vagabundenkönig Jack die Holde. Auf geht es durch manches Abenteuer in deutschen Fürstentümern, bis nach Amsterdam. Dort erweist sich die Dame als Finanzgenie, sie bringt es schließlich an den Hof Ludwigs XIV, sie wird Mätresse, Spionin und Schachfigur in den Händen diverser königlicher Staatsoberhäupter.
Munter geht es hin und her, kurze Abstecher in das Massachusetts des Jahres 1714 eingeschlossen. Und immer, wenn eine der Hauptfiguren nicht mehr weiter weiß – hurra! da kommt ein gewisser Enoch Root um die Ecke. Und er hat natürlich immer die richtige Idee, kein Wunder, bei seiner Erfahrung …
Es wäre schlichtweg vermessen, alle Handlungsstränge hier nacherzählen zu wollen. Es sind zu viele. Schon ein wenig störend wirkt, dass keine der Plotlinien wirklich zu einem klaren Ende geführt wird. Der Kauf der Fortsetzungs-Romane des großen Zyklus wird da fast unvermeidbar. Immerhin bleibt es zumeist sehr unterhaltsam, und immer recht abenteuerlich.
_Worum geht es denn?_
Ja, bei Bedarf lässt sich hier eine Menge über Wissenschaftsgeschichte erfahren, über Sittengeschichte, Staatenwerdung, etc. Aber zum Stillen übermächtigen Wissensdurstes ist „Quicksilver“ dann doch nur bedingt geeignet. Auch wenn all die in umfassender Detaillierung geschilderten Alltagssorgen und –verrichtungen der Figuren weitgehend authentisch sein dürften – da gibt es Besseres (wie zum Beispiel das echte Tagebuch des echten Samuel Pepys). Obwohl der historische Rahmen weitgehend korrekt beschrieben scheint, dominieren doch die fiktiven Figuren. Und deren philosophische Tiefe scheint mir trotz allen Diskurses der edlen Herren von der „Royal Society“ dann doch arg begrenzt. Dies ist ein extra langer Abenteuer-Schmöker in Cinemascope, nicht weniger, aber auch nicht mehr.
_Und wie lässt es sich schmökern?_
Überaus vergnüglich. Stephenson hält eine mild ironische Tonlage locker durch. Die oft leicht antiquierte Schreibweise des Originals (uralte Verben, obsolete Rechtschreibung etc.) wurde durch die Übersetzer leider weitgehend getilgt. Schade eigentlich, steigert sie doch den Charme des Barock-Zyklus erheblich. Und barock, ja, barock geht es hier zu. Spielszenen werden eingeflochten, Spottgedichte, gelegentlich wandelt sich das Buch zum Briefroman. Immer aber gibt es flotte Action, Ehre und große Gefühle, erbauliche Details, manchmal etwas konstruiert anmutende Begegnungen – aber was soll’s. „Quicksilver“ ist mächtig unterhaltsam, und sehr schwer zur Seite zu legen. Auch wenn die Lektüre sicher einige Wochen Zeit beansprucht.
_Zum Abschluss_
In diesem Buch gibt es „Science Fiction“ nur im wörtlichen Sinne. Großzügig ausgeteilte Brocken Wissenschaftsgeschichte in einem herrlich dahinsprudelnen Abenteuerroman mit historischer Kulisse. „Quicksilver“ ist angenehmer Eskapismus. Die Helden sind nur selten eindimensional, meist liebevoll gezeichnet. Wärme und Humor durchströmen das Buch. Schön für lange Winterabende, schön als Urlaubslektüre.
Nur etwas schwer zu transportieren.
Homepage des Autors: http://www.nealstephenson.com
Metaweb des Autors: http://www.metaweb.com
Arnaldur Indriðason – Todeshauch [Erlendur 4]

Uther, Hans-Jörg (Herausgeber) – Märchenschatz
„Märchenschatz“ ist eine von mehreren Sammlungen, die Hans-Jörg Uther herausgegeben hat. Hier geben sich Märchen aus so ziemlich allen Teilen des deutschsprachigen Raumes ein Stelldichein, darunter allseits bekannte wie „Dornröschen“, „Aschenputtel“ oder „Die Sterntaler“, aber auch andere wie „Die Geschichte von der Metzelsuppe“, „Bruder Lustig“ oder „Der Bärenhäuter“, wobei manches Märchen, dessen Titel dem Leser unbekannt schien, sich beim Lesen unter Umständen als alter Bekannter entpuppt, der hier nur im Kleid einer lokalen, leicht variierten Version auftaucht. Zu dieser Gruppe der weiträumig und dabei leicht unterschiedlich erzählten Geschichten gehören unter anderen „Der Deserteur mit dem Feuerzeug“ (bei Grimms: „Das blaue Licht“), „Vom Vogel Fenus“ („Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“) und „Das Märchen vom Knüppel aus dem Sacke“ („Tischlein, deck dich“). Manch einem, der Preußlers „Krabat“ gelesen hat, mag der „Zauberwettkampf“ bekannt vor kommen. Am meisten überrascht hat mich aber das Märchen „Der arme Schuster“, das in abgewandelter Form eine Geschichte aus 1001 Nacht erzählt! Wie diese Geschichte aus dem Orient ins Donauland kam oder umgekehrt, wäre eine interessante Frage.
Die Unterschiede zu den allseits bekannten Versionen, die meist von den Gebrüdern Grimm aufgeschrieben wurden, reichen von kaum spürbar, wie bei „Hans Wohlgemut“ („Hans im Glück“), über deutlich, wie bei „Die Geiß mit ihren zehn Zicklein und der Bär“ („Der Wolf und die sieben Geißlein“), bis gravierend bei „Das kleine Rotkäppchen“.
In den meisten Fällen betreffen diese Unterschiede lediglich die Ausführung, ohne die zugrunde liegende Aussage zu verändern. Aber nicht immer: Das Märchen vom Rotkäppchen zum Beispiel endet hier ganz aprupt an der Stelle, an der das Rotkäppchen gefressen wird! Kein Happyend!
Nun sind Märchen nicht einfach nette Geschichten, die man sich eben erzählt. Märchen erfüllen einen bestimmten Zweck. Der eine ist der psychologische. Oft wurde den Märchen vorgeworfen, sie seien so grausam, und es wurde fleißig daran gebastelt, sie zu entschärfen. Heute sind Psychologen der Meinung, dass Märchen grausam sein sollen! Märchen helfen dabei, mit Ängsten fertig zu werden. Kinder empfinden es als ermutigend, wenn Hänsel und Gretel die böse Hexe besiegen, und das auch noch ganz allein.
Der andere ist der pädagogische. Märchen lehren, dass der Gute immer gewinnt, der Böse immer verliert, dass es sich also nicht lohnt, böse zu sein. Genau dieser Punkt ist aber bei der hier erzählten Rotkäppchenversion ausgehebelt! Kein Jäger kommt, um das – zugegebenermaßen ungehorsame und leichtsinnige – Rotkäppchen zu befreien. Der Grundtenor lautet eher: Geschieht ihr recht! Die unschuldige Großmutter bleibt dabei völlig unbeachtet. Dadurch erhält die Geschichte einen Touch von Struwwelpeter-Pädagogik, die inzwischen allerdings stark umstritten ist. Rotkäppchen hat keine Gelegenheit mehr, aus ihrem Fehler zu lernen. Und der Wolf, der doch noch viel böser ist als Rotkäppchen, kommt ohne Strafe davon.
Außer den klassischen Volksmärchen finden sich aber auch Tiergeschichten und Schwänke, so zum Beispiel „Der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel“ und „Die sieben Schwaben“. Allen Geschichten gemeinsam ist, dass sie in der typischen Märchensprache belassen wurden, die zum Flair eines Märchens einfach dazugehört. Das wirkt sich gerade bei den beiden vorgenannten äußerst positiv aus, da die wörtliche Rede teilweise sogar die entsprechende Mundart verwendet.
Natürlich lesen sich manche Passagen dadurch etwas umständlich. Das Buch in einem Rutsch durchzulesen, ist anstrengend. Kleine Kinder werden gelegentlich eine Erklärung brauchen, ältere Kinder, die selber lesen, möglicherweise auch, sofern sie nicht aus ihrer Vorlesezeit bereits Märchenerfahrung haben. Aber das gibt sich rasch.
Illustriert ist der Band mit einfachen Bleistiftzeichnungen, die aus dem 19. Jahrhundert stammen und sich vor allem durch Schlichtheit und einem Blick fürs Detail auszeichnen. Sie wurden von Otto Ubbelohde, einem hessischen Zeichner, für eine Ausgabe der Grimmschen Hausmärchen gefertigt und geben nicht nur Szenen aus den jeweiligen Märchen wieder, sondern auch Ausschnitte aus der damaligen Zeit, zum Beispiel in Kleidung und Einrichtung, und runden damit die Gesamterscheinung hervorragend ab.
Insgesamt eine interessante und schön gestaltete Ausgabe abseits der verwässerten und teilweise lieblos hingeklatschten Billigsammlungen, allerdings halte ich es für empfehlenswert, dass im Falle kindlicher Leser die Eltern mit den Kindern über das Gelesene sprechen. Aus eigener Erinnerung weiß ich, dass Kinder vieles gar nicht so deutlich und scharf empfinden wie wir Erwachsenen. Es sind aber auch nicht alle Märchen gleich einfach zu verstehen. Gerade im Falle von „Rotkäppchen“ oder auch der „Mär vom Marchandelbaum“ und der „Eiche am Elbufer“ wäre ein Erfragen des Gelesenen hilfreich, um zu sehen, wie die Kinder mit der Geschichte klargekommen sind.
Hans-Jörg Uther ist Professor für Literaturwissenschaft an der Uni Essen und außerdem in der Erzählforschung tätig. In der Liste der von ihm veröffentlichten Sammlungen finden sich auch „Sagenschatz“, „Märchen vom Glück“, [„Die schönsten Märchen und Geschichten zur Weihnachtszeit“ 775 und „Das große Buch der Fabeln“. Außerdem ist er Mitherausgeber der Zeitschrift |Fabula|.
Herbert, Brian / Anderson, Kevin J. – Kreuzzug, Der (Der Wüstenplanet: Die Legende 2)
„Der Kreuzzug“ ist die Fortsetzung von [„Butlers Jihad“, 827 zugleich der zweite Teil der Legenden des Wüstenplaneten und spielt ungefähr 25 Jahre nachdem Serena Butler den Denkmaschinen den heiligen Krieg, den Djihad im Namen ihres ermordeten Sohnes Manion erklärt hat.
Die Kämpfe sind seit einiger Zeit voll im Gange, doch immer wieder mussten die Menschen herbe Rückschläge gegen die Roboterarmeen von Omnius in Kauf nehmen. In der Zwischenzeit hat sich aber auch einiges geändert. Die Protagonistin, Serena Butler, hat sich mittlerweile fast ganz zurückgezogen und ihre Führungsrolle zugunsten ihrer Aufgabe als Priesterin aufgegeben. Iblis Ginjo, einst bei der Rebellion auf der Erde Anführer der menschlichen Streitkräfte, hat nun gewissermaßen ihren Posten eingenommen und sich selber den Titel Großer Patriarch verliehen. Und gerade dieser Iblis ist es auch, der im zweiten Buch der Legenden des Wüstenplaneten die Hauptrolle übernimmt. Mit seinen Entscheidungen und letztendlich auch mit seinen Intrigen steht und fällt die gesamte Geschichte. Derweil wird den beiden Kampfpiloten Xavier Harkonnen und Vorian Atreides im zweiten Teil weniger Platz eingeräumt. Xavier ist trotz etlicher Einsätze mehr und mehr zu einem Familienmenschen geworden, während Vorian auf dem fernen Planeten Caladan die große Liebe entdeckt hat.
Wenn man das erste Buch bereits gelesen hat, so kann man jetzt schon sehen, dass sich einschneidende Veränderungen abgespielt haben, die eigentlich von ihrer Wichtigkeit viel näher hätten beleuchtet werden müssen. Das ist nämlich einer der Kritikpunkte an „Der Kreuzzug“; zu viele wichtige Details aus der Vergangenheit werden dem Leser zunächst vorenthalten und auch anschließend nur bruchstückhaft erzählt. Die ganzen Schlachten, der Aufstieg von Iblis Ginjo, all das wird völlig ausgelassen und am Ende nur mit einer chronologischen Rückblende versehen.
An anderer Stelle ist hingegen fast gar nichts passiert; die Zeit scheint gerade im Sektor der Denkmaschinen stehen geblieben zu sein. Und auch die Situation der versklavten Zenschiiten hat sich über die Jahre keineswegs geändert. Umso verwunderlicher ist es, dass sich die Dinge im Buch dann plötzlich nach so langer Zeit auf kurze Dauer überschlagen. Ein tödlicher Sklavenaufstand hätte den Ereignissen des ersten Buches zufolge jedenfalls viel früher geschehen müssen. Desweiteren ist mir schleierhaft, warum der Wissenschaftlerin Norma Cenva plötzlich sämtliche Ideen aus dem Kopf schießen, die sich anscheinend in 25 Jahren nicht ergeben haben.
Ich könnte weitaus mehr Beispiele nennen, fest steht jedoch, dass wichtige Geschehnisse übergangen worden sind, und das ist für die Fortsetzung des Buches alles andere als förderlich. Doch es gibt noch mehr Kritik zu äußern: Der Schreibstil hat sich nämlich gravierend geändert, und manchmal scheint es tatsächlich so, als würden die beiden Autoren lediglich versuchen, die Seitenzahl zu strecken. Immer wieder werden Sachen wiederholt, die man als aufmerksamer Leser bereits einige Male zuvor ausführlich vorgestellt bekommen hat. Zudem werden wiederholend die Ereignisse aus dem ersten Band ins Gedächtnis gerufen, vielleicht ja auch, damit man das Buch auch unabhängig lesen kann, jedoch ist wohl davon auszugehen, dass man, sofern man sich für die Materie interessiert, beide Bücher durchliest.
Die Geschichte an sich verläuft hingegen weiterhin sehr spannend und nimmt besonders zum Ende hin einige sehr überraschende Wendungen, die das Ganze quasi noch einmal komplett auf den Kopf stellen. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber mit einem derartigen Ende war keinesfalls zu rechnen.
In der Kritik zum ersten Band hatte ich betont, dass ich die Enttäuschung mancher Kritiker über diese Serie nicht ganz verstehen kann, muss diese Behauptung jedoch jetzt teilweise zurücknehmen, da mir manche inhaltliche aber auch einige stilistische Elemente in „Der Kreuzzug“ nicht mehr so gut gefallen. Hat man sich durch „Butlers Djihad“ gekämpft, dann ist dieses zweite Buch sicherlich Pflichtlektüre, aber so ganz das, was man sich von „Der Kreuzzug“ erhofft hatte, ist es eben nicht geworden.
Sehr schade, wie ich finde, denn die Geschichte an sich hat eine ganze Menge Potenzial.
Dave J. Pelzer – Sie nannten mich »Es«

Stationen einer Kindheit
Das kurze und dünne Buch ist in sieben verschiedene Kapitel eingeteilt, die wichtige Stationen in Dave Pelzers Leben darstellen. Gleich zu Beginn erlebt der Leser Daves Rettung mit. Endlich haben die Schulkrankenschwester und der Schuldirektor genug gesehen von Daves blauen Flecken und Verletzungen, die selbstverständlich nicht von Unfällen stammen. Die beiden verständigen die Polizei und lassen Dave aus der Schule abholen. Zunächst muss er eine Aussage über seine Erlebnisse machen, anschließend ist er jedoch frei – frei von seiner gewalttätigen Mutter, die ihn permanent gequält hat.
Ian Watson – Feuerwurm
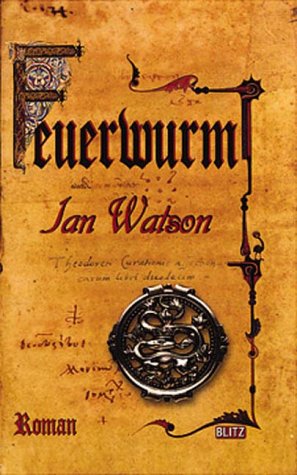
Lumley, Brian – Necroscope 2 – Vampirblut
„Vampirblut“, das ist der zweite Teil von Brian Lumleys Mammut-Vampirsaga „Necroscope“. Während im ersten Teil, [„Das Erwachen“, 779 hauptsächlich Figuren und Settings eingeführt wurden, geht in „Vampirblut“ nun endlich die Handlung los. Zunächst werden die Erzählungen der beiden Gegenspieler wieder aufgegriffen. Da wäre auf der einen Seite der Engländer Harry Keogh. Er selbst bezeichnet sich als Necroscope – als jemand, der mit den Toten reden kann. Da er weltweit offensichtlich der einzige Lebende mit dieser Gabe ist, sind die Toten geradezu wild darauf, mit ihm zu reden. Sie bezeichnen ihn als Freund und versuchen, ihm in schwierigen Situationen zu helfen. Demgegenüber steht der für den russischen Geheimdienst arbeitende Nekromant Boris Dragosani. Seit seiner Kindheit hat er einen außergewöhnlichen Mentor, nämlich den in seinem rumänischen Grab gefangenen Vampir Thibor Ferenczy. Dessen Weltübernahmepläne fangen langsam an auf seinen Schützling abzufärben, sodass Dragosani beschließt, seinen Vorgesetzten Borowitz aus dem Weg zu räumen, um das sowjetische E-Dezernat (eine geheime Einrichtung zur Spionage mittels übersinnlicher Fähigkeiten) selbst zu übernehmen.
Während im ersten Band die Geschichten um Keogh und Dragosani noch nebeneinander herliefen und keine Berührungspunkte aufwiesen, so wird dieser Makel in „Vampirblut“ mehr als behoben. Lumley flicht nämlich ein kompliziertes Netz von Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den englischen und sowjetischen Geheimdiensten und gibt der gerade startenden Handlung damit Pepp und Potenzial. Keogh beschließt, seinen Stiefvater Viktor Shukshin zu töten, der für den Tod von Harrys Mutter verantwortlich ist. Um diesen Mord nach seinen Wünschen ausführen zu können, trainiert er hart und wird während seiner Vorbereitung vom englischen E-Dezernat kontaktiert. Dessen Chef, Keenan Gormley, möchte Harry anwerben, da dessen Fähigkeiten einzigartig und herausragend sind.
Doch nun fängt der sowjetische Geheimdienst an dazwischenzufunken. Dragosani und sein neuer Partner Max Batu werden nach England geschickt. Sie sollen ebenfalls Shukshin elegant um die Ecke bringen, da es sich bei ihm um einen getürmten sowjetischen Spion handelt. Bei dieser Aktion stoßen sie allerdings unfreiwillig mit Harry Keogh zusammen, der somit die Aufmerksamkeit des sowjetischen E-Dezernats auf sich zieht. Als Dragosani dann auch noch Gormley beseitigen lässt, fühlt sich Harry persönlich beleidigt und beschließt, etwas gegen die sowjetischen Angriffe zu unternehmen …
„Vampirblut“ bietet für jeden etwas. Liebhaber von Spionage-Romanen werden hier geeignetes Lesefutter finden. Lumley verwebt englischen und sowjetischen Geheimdienst auf interessante Weise und die Beziehungen und Animositäten zwischen beiden werden in den zukünftigen Bänden sicher noch anwachsen. Mit der Idee des E-Dezernats gibt er den Geheimdiensten einen übersinnlichen Touch, um seine Figuren exotischer und abwechslungsreicher gestalten zu können.
Auch Fans des klassischen Horrors kommen auf ihre Kosten. In „Das Erwachen“ war von Vampiren ja noch nicht viel zu sehen, doch das ändert sich hier schlagartig. Thibor Ferenczy wird als Charakter weiter ausgebaut und Dragosani trifft auf einen rumänischen Vampirexperten, der Licht auf die Unklarheiten wirft, die der erste Band aufgeworfen hat. Lumley gelingt es, einen völlig entromantisierten Vampir zu präsentieren, indem er Vampirismus zu einer medizinischen Pathologie macht. Der Vampir selbst ist ein Parasit, ein ekliges Ding, das in seinem Wirt Eier legt und daraufhin im menschlichen Körper komplett neue innere Organe ausbildet. Diese Vorstellung ist gewöhnungsbedürftig, aber gleichzeitig originell. Vor allem führt sie auch dazu, dass man Thibor als Charakter kaum einschätzen kann. Lügt er Dragosani ständig an? Oder hat er vor, seine Versprechen zu halten?
Der dritte große Themenkomplex, der in „Das Erwachen“ ebenfalls nur angedeutet wurde, sind Mathematik und Physik. Harry scheint ein besonderes Interesse für Formeln und Zahlen zu besitzen und so macht er sich auf zum Grab des Mathematikers Möbius, um von ihm das Teleportieren zu lernen. Wie man dies mit Zahlen und Schleifen erreichen kann, wird zwar irgendwie erklärt, der Sinn hinter diesen Ausführungen wird den meisten Lesern aber sicherlich verborgen bleiben. Für Mathe-Analphabethen sind diese Passagen von „Vampirblut“ unverständlich und damit langatmig. Sie bringen die ansonsten spannende und zügige Handlung zu einem Stillstand und führen zu einigen Hängern in der Story.
Doch trotzdem kann man sich von „Vampirblut“ gut unterhalten lassen. Lumleys Erzählung gewinnt im zweiten Teil auffallend an Fahrt und Komplexität, was Hör-Spannung garantiert und für zukünftige Bände hoffen lässt. Natürlich verdankt das Hörbuch auch dem Sprecher Helmut Krauss, dass es beim Hörer den beabsichtigten Grusel erzeugt. Krauss ist unter anderem als deutsche Stimme von Marlon Brando bekannt und seine maskuline und selbstbewusste Stimme gibt dem Text andere Akzente als es sein Vorgänger in „Das Erwachen“ tat (dort sprach Joachim Kerzel). Gerade Thibor Ferenczy ist hier eher ein zweideutiger Charakter denn ein geradliniger Bösewicht. Auf die markanten und beunruhigenden Ausrufe Thibors („Ahhhhhh, Dragosaaaaani!“), die Joachim Kerzel im ersten Teil mit Spaß auf den Silberling brachte, hofft man hier allerdings vergebens. Ebenfalls trägt die Musik von Andy Matern zur Atmosphäre bei, der ein Thema auf immer wieder neue Weise variiert. Gut gelungen!
„Vampirblut“ ist der eigentliche Anfang der Serie um Harry Keogh, denn erst hier setzt die Handlung richtig ein. Die Story ist flott erzählt (der Roman wurde für die Hörbuchfassung leicht gekürzt) und endet mit einem echten Paukenschlag, der sofort Lust macht, sich den dritten Band vorzunehmen.
Remy, Maurice Philip – Mythos Bernsteinzimmer
Ein kundiger Blick auf das Bernsteinzimmer bzw. den Mythos, der sich nach dessen von Geheimnissen umwitternden Verschwinden in den letzten Tagen des II. Weltkriegs darum entwickelt hat, präsentiert in fünf Kapiteln:
„Spuren“ (S. 7-18) leitet mit der aktuellen Geschichte des Bernsteinzimmers ein. Um die Jahrtausendwende schien es, als ob dieser Schatz nicht nur noch existiere, sondern die Wiederentdeckung unmittelbar bevorstehe. Plötzlich tauchten diverse Bestandteile des komplexen Meisterwerks auf dem (schwarzen) Kunstmarkt auf und fügten dem bizarren „Nachleben“ des Bernsteinzimmers ein neues Kapitel an. Alte und neue Legenden schossen ins Kraut – für Maurice Philip Remy der Anstoß den Versuch zu wagen, den Mythos zu entkleiden und dahinter die Realität zum Vorschein zu bringen.
Er beginnt mit der gesicherten Geschichte: „Das Kunstwerk“ (S. 19-74) zeichnet den Weg des Bernsteinzimmers nach: Entstanden um 1705 im Auftrag des Preußenkönigs Friedrichs I., schmückte es die Wände des Schlosses Charlottenburg. Sein sparsamer Sohn, der „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I., schenkte es mit diplomatischen Motiven dem Zaren Peter I., der es einlagern ließ, bis es seine Tochter und Nachfolgerin Katharina die Große endlich einbauen ließ. 1755 landete es in ihrem Sommersitz in Zarskoje Selo, dem Zarendorf vor den Toren von St. Petersburg. Dort blieb es und verfiel allmählich, überlebte den Untergang des Zarenreiches und den Bildersturm der Bolschewisten
„Der Ortswechsel“ (S. 75-136) rekonstruiert den letzten Weg des Bernsteinzimmers. 1941 fiel es nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion den Nazis in die Hände, die es in die Ordensburg von Königsberg, der Hauptstadt Ostpreußens, schafften. Dort verliert sich in den Wirren der letzten Kriegswochen 1945 seine Spur. Die viel versprechenden Fährten greift der Verfasser auf, der die lückenhaften, einander oft widersprechenden Belege so interpretiert, dass die Bernstein-Kleinodien mit dem Königsberger Schloss zu Grunde gingen.
„In eigener Sache“ (S. 183-202) nennt Remy das letzte Kapitel, in dem er seine eigene Verwicklung in die „Geschichte“ des Bernsteinzimmers nach 1945 darlegt. Seine Erlebnisse, Fehlschlüsse und Erkenntnisse spiegeln die bizarre „Schatzsuche“ wider, die seit sechs Jahrzehnten von gestandenen Historikern, Lokalpolitikern, Träumern und Spinnern betrieben wird. Jeder versunkene Nazibunker, jeder gesprengte Stollen, jeder staubige Keller zwischen St. Petersburg und den Alpen wurde ausgegraben und durchwühlt – vergeblich, da vom originalen Bernsteinzimmer nur der Traum geblieben ist. Der ist freilich unverwüstlich.
Ein ausführlicher Anhang listet Fußnoten auf und legt die Quellen offen, aus denen Autor Remy schöpfte. Ein nützliches Register fehlt ebenso wenig wie ein Abbildungsverzeichnis und eine Karte. Zahlreiche, oft großformatige und farbige Abbildungen – moderne und zeitgenössische Fotos, Wiedergaben alter Stiche, Karten etc. – illustrieren den Text und ergänzen ihn gleichzeitig.
Das Bernsteinzimmer ist also dahin – wer dieses Buch liest, wird daran kaum mehr zweifeln – solange er oder sie sich offenen Geistes dem heiklen Thema widmen möchte oder kann. Wie der Titel des hier vorgestellten Buches deutlich macht, ist das Bernsteinzimmer nicht nur ein historisches Kunstobjekt hohen Ranges. Mehr noch ist es inzwischen ein Mythos geworden, von dem viele Mitmenschen nicht lassen können oder wollen. So schön ist es gewesen, dass es einfach nicht zerstört sein d a r f.
Die Wirren der Vergangenheit kommen dieser Sichtweise entgegen. Obwohl das Zimmer erst vor sechs Jahrzehnten verschwand, geschah dies auf eine Weise, die praktisch jeglicher Spekulation Tür & Tor öffnet. Dazu kommen die geeigneten Finsterlinge: die Nazis, hier verkörpert durch den dämonischen Gauleiter Erich Koch und seine Schergen. Aber auch in den Jahrhunderten zuvor tummelte sich allerlei Prominenz in den geschnitzten Bernsteinwänden. Friedrich Wilhelm I. von Preußen, sein Sohn – der „Alte Fritz“ -, Peter der Große, Katharina die Große – gekrönte Häupter und zwielichtige Gestalten verkörpern lebendige Geschichte sowie den Hang des Menschen zum romantischen Goldfieber!
Die historische Realität sieht weniger glanzvoll aus. Das prächtige Bernsteinzimmer wurde quasi auf Sand erbaut – Material sparend schnitt man den kostspieligen Bernstein in Scheiben und klebte ihn ganz prosaisch auf Gipsplatten. Außer hui, innen pfui, denn für das raue Klima Preußens oder gar Russlands war solch’ filigrane Kunst definitiv zu empfindlich. Schon kurze Zeit nach Fertigstellung fing das schöne Werk zu bröckeln an, was es fortan bis zu seinem Untergang fortsetzte. Die Ironie dabei: Das Bernsteinzimmer, das 1945 verschwand, war längst nicht mehr das Bernsteinzimmer von 1705 – man hatte es bereits mehrfach zur Gänze restaurieren müssen und dabei ständig verändert.
Nicht einmal eine Spitzenposition unter den Meisterwerken der Kunstgeschichte wollte man ihm zubilligen. Die Zeitgenossen gingen jeweils recht rüde mit dem Bernsteinzimmer um. Erst als es verloren war, wollte es jede/r haben. Dabei weiß Remy anschaulich zu machen, dass es egal ist, ob es nun verbrannt ist oder in einem Versteck überdauert hat: Feuchtigkeit und Kälte haben ihm ohne ständige Pflege längst den Garaus gemacht. Doch die Beweise für die Vernichtung im Königsberger Schloss sind überzeugend. Remy hat sich die Mühe gemacht, hinter Gerüchte und Legenden zu blicken. Vor allem ging er an die Originalquellen und förderte dabei Erstaunliches zutage. Es sind halt doch nicht alle Unterlagen verschwunden. Man muss sie nur suchen – und finden wollen! Dann verkünden sie die traurige Wahrheit, dass das Bernsteinzimmer nicht mehr existiert.
Was wiederum auch nicht stimmt: Im Katharinenpalast zu Zarskoje Selo kann es seit 2003 in seiner vollen Pracht besichtigt werden. Mehrere Jahre der Planung, der Arbeit und der Finanzkrisen hat es gekostet, aber dann war es wiedererstanden: das neue Bernsteinzimmer, eine Eins-zu-eins-Kopie des Originals, das selbst die meiste Zeit so großartig nicht ausgesehen hat.
Doch weiterhin wird viel Zeit und Geld in die Suche nach dem „richtigen“ Zimmer investiert. Jeder Strohhalm wird ergriffen. Ist Schliemanns Schatz von Troja, ebenfalls 1945 verschwunden, nicht unlängst unversehrt in russischen Museumsarchiven zum Vorschein gekommen? Ist das nicht der „Beweis“ dafür, dass es dem Bernsteinzimmer ebenso ergangen ist? Und so geht die Jagd weiter – mit neuen komischen und tragischen Kapiteln, die sich nahtlos an die Historie und die Histörchen reihen, die Verfasser Remy mit bewundernswerter Sachlichkeit zu präsentieren weiß.
Maurice Philip Remy wurde 1962 in München geboren. Nach Abitur und dem Studium der Kommunikationswissenschaften leistete er Pressearbeit für das Volkstheater München und arbeitete als freier Journalist. Später wechselte er zum Dokumentarfilm, wurde Redakteur, Aufnahmeleiter, dann Redaktionsleiter bei „Top Video Film- und Fernsehproduktion“. Der nächste Schritt: Remy schrieb und inszenierte selbst. Ihm verdanken wir u. a. Episoden unsterblicher (bzw. nicht umzubringender) TV-Dauerbrenner wie „Vorsicht Kamera“ und „Verstehen Sie Spaß?“
Für das Öffentlich-Rechtliche Fernsehen dreht Remy aber auch historische Dokumentationen, wobei er seine Themen meist im Umfeld des „Dritten Reiches“ und des II. Weltkriegs findet. Darüber hinaus veröffentlichte Remy diverse Publikationen; neben „Mythos Bernsteinzimmer“ die Bücher „Mythos Rommel“, „Mythos Widerstand“ und „Dimension PSI“.
Kastner, Jörg – Engelsfluch
Auch nach der Aufregung um das vom Geheimorden |Totus Tuus| verübte Attentat auf den neu inthronisierten Papst Custos hält dieser an seinem radikalen Kurs fest: Der Heilige Vater räumt mit verstaubten Traditionen auf und versucht, die katholische Kirche trotz anhaltender Widerstände aus konservativen Kreisen auf einen neuen, modernen Kurs zu bringen. Allerdings hat niemand damit gerechnet, dass die seinen revolutionären Bestrebungen entgegenschlagende Ablehnung in einem extrem radikalen Akt kulminieren würde – ein Teil des Klerus sagt sich von Rom los und gründet die „Heilige Kirche des wahren Glaubens“, welche über ein eigenes geistliches Oberhaupt (einen Gegenpapst) verfügt. Ein neuzeitliches Schisma spaltet also die katholische Gemeinschaft. Unsicherheit darüber, wer die richtige Lehre vertritt, greift unter den Gläubigen um sich.
Die innerkirchlichen Turbulenzen werden noch durch grausame Priestermorde angeheizt, die Rätsel aufgeben. Der ehemalige Schweizergardist Alexander Rosin und Commissario Donati, die beide Custos schon früher zur Seite standen, werden mit den Ermittlungen beauftragt. Rosin arbeitet inzwischen als Journalist und bildet zusammen mit der Reporterin Elena nicht nur im Privatleben ein Paar. Alexander, Elena und Donati versuchen Licht ins Dunkel der Gewalttaten zu bringen. Eine Spur, ein am Tatort aufgefundenes Silberkreuz, lässt vermuten, dass erneut – wie bereits beim Attentat – Mitglieder der Schweizergarde beteiligt sind. Ist Totus Tuus gar nicht zerschlagen? Ist die Garde wieder von dieser Organisation unterwandert? Hat der Geheimorden mit den Morden ein neues Zeichen gesetzt und steckt er vielleicht sogar hinter dem Schisma?
Als Elena in Borgo San Petro, dem Geburtsort des Gegenpapstes, recherchiert, trifft sie auf den Deutschen Enrico Schreiber, der dort nach seinem ihm unbekannten Vater sucht. Kurz nach ihrer Ankunft geschieht auch hier ein blutiges Verbrechen und die beiden werden in einen Strudel seltsamer Ereignisse hineingezogen. Übernatürliche Heilkräfte, ominöse Prophezeiungen sowie uralte etruskische Hinterlassenschaften spielen dabei eine Rolle. Und dann sind da noch Enricos ständig wiederkehrende Albträume, in denen ihn eine Zwittergestalt aus Dämon und Engel quält. Schließlich stellt sich heraus, dass ein Geheimnis von geradezu monströsen Dimensionen hinter all dem steht und dass die Tage der Welt, wie wir sie kennen, gezählt sein könnten …
Wie der kurzen Inhaltsangabe zu entnehmen ist, greift das kleine Wörtchen „Thriller“ auf dem Buchcover zu kurz, um diesen Roman korrekt zu charakterisieren. Die Bezeichnung „Phantastischer Thriller“ trifft den Sachverhalt schon besser. Für Krimi- & Thrillerleser, die es gerne halbwegs bodenständig und realistisch haben, ist dieses Buch daher weniger empfehlenswert. Eine weitere Einschränkung ergibt sich daraus, dass der „Engelsfluch“ die Fortsetzung von „Engelspapst“ ist. Deshalb empfiehlt es sich, zuerst letzteres Werk zu lesen. Prinzipiell ist zwar der besprochene Roman auch ohne Kenntnis des (in sich abgeschlossenen) Vorgängerbandes problemlos zu verstehen, weil dessen Inhalt zusammengefasst präsentiert wird. Falls man allerdings nur das aktuell besprochene Buch zu lesen beabsichtigt und dann vielleicht Lust auf den ersten Teil bekommt, birgt dieser keinerlei Überraschungen mehr in sich.
Die Leserschaft von „Engelspapst“ wird rasch erkennen, dass Jörg Kastner sein bewährtes Rezept beibehalten hat: Es gibt als Aufhänger ungeklärte, spektakuläre Mordfälle im Umfeld des Vatikans, eine kräftige Prise alter Rätsel mit übersinnlichem Inhalt, Intrigen und Täuschungsmanöver, eine zweite Erzählebene mit alten Aufzeichnungen, eine problematische Vater-Sohn-Beziehung etc. Es kommt also das gleiche Strickmuster zum Einsatz, nur will leider diesmal der berühmte Funke nicht so recht überspringen, vielleicht gerade weil die einzelnen Bestandteile und das Prinzip ihrer Verknüpfung bereits vertraut sind. So kann jeder, der ein bisschen aufmerksamer liest und sich seine eigenen Gedanken macht, viele Enthüllungen vorhersehen. Aus diesem Grund – und weil echte dramaturgische Höhepunkte über weite Strecken rar gesät sind -, kommt erst im letzten Viertel so richtig Spannung auf. Ein Grund für dieses Dahintreiben der Handlung könnte im Fehlen von eindrucksvollen Gegenspielern der Helden liegen. Die böse Macht im Hintergrund ist unfassbar und anonym, lange verleiht ihr niemand ein Gesicht, wodurch sie seltsam leblos und uninteressant bleibt (als der Oberschurke dann endlich in dieser Rolle die Bühne betritt, mangelt es ihm auch noch eklatant an Charisma). Außerdem wird leider die Schisma-Thematik überhaupt nicht vertieft und bleibt somit ein reiner Plakativ-Effekt.
Trotz der aufgezählten Schwachpunkte ist „Engelsfluch“ mit seinen fast fünfhundert Seiten ein angenehm zu lesender Schmöker, der einen zwar über weite Strecken nicht vor Spannung an den Fingernägeln knabbern lässt, aber dennoch diesseits der Grenze zur Langeweile bleibt. Wer sich ohnehin nur für einige Stunden in eine Welt der phantastischen Abenteuer entführen lassen will, ohne dabei alles kritisch zu hinterfragen, kann diesem Buch mit Sicherheit mehr abgewinnen als der Rezensent.
_Martin Weber_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de/ veröffentlicht.|
Roland Seim/Josef Spiegel (Hg.) – „Nur für Erwachsene“ – Rock- und Popmusik: zensiert, diskutiert, unterschlagen

Roland Seim/Josef Spiegel (Hg.) – „Nur für Erwachsene“ – Rock- und Popmusik: zensiert, diskutiert, unterschlagen weiterlesen
Isaac Asimov – Lucky Starr

Ein wenig untergegangen in dem Rummel um die Robotergesetze und seine Foundation-Trilogie ist eines seiner frühesten Werke überhaupt:
Die Lucky-Starr-Serie
Armin Rößler (Hrsg.); Dieter Schmitt (Hrsg.) – Walfred Goreng
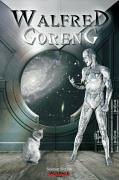
Armin Rößler (Hrsg.); Dieter Schmitt (Hrsg.) – Walfred Goreng weiterlesen
Ellery Queen – Drachenzähne
Den Juli des Jahres 1939 wird Kriminalschriftsteller und Privatdetektiv Ellery Queen sicherlich nicht vergessen. Da ist der geplatzte Blinddarm, der ihn ins Krankenhaus und fast auf den Friedhof bringt. Mit der Verfolgung von Übeltätern ist erst einmal Schluss. Das ist ärgerlich, denn just hat sich Ellery eines ausgesprochen interessanten Falls angenommen. Der schwerreiche, arg verschrobene Cadmus Cole wurde auf einer seiner ausgedehnten Schiffsreisen angeblich vom Schlag getroffen. Kurz zuvor hatte er Queen engagiert, um sein sehr seltsames Testament vollstrecken zu lassen, und ließ dabei durchblicken, dass man ihm womöglich nach dem Leben trachte, wollte Queen aber keine Details verraten. Ellery Queen – Drachenzähne weiterlesen
Chevalier, Tracy – dunkelste Blau, Das
Amis haben für gewöhnlich ein ziemlich seltsames Bild von uns Europäern und wehe sie ziehen dauerhaft hierher, dann kann es eigentlich nur Komplikationen und Verwicklungen geben. Sogar solche, die bis ins 16 Jh. zurückreichen. So ergeht es Tracy Chevaliers Protagonistin, als sie mit ihrem Mann berufsbedingt nach Frankreich übersiedelt. Dem Text auf dem Buchrücken nach bietet es sich an, die Geschichte spontan als einen der derzeit höchst beliebten klerikalen Thriller einzustufen. Ein Irrtum. So viel zur Erwartungshaltung. Ob und inwieweit der Eindruck des Teasers beabsichtigt ist, um auf der Welle mitzuschwimmen, soll einmal dahingestellt sein. Doch worum handelt es sich bei dem Roman „Das dunkelste Blau“ nun eigentlich wirklich?
_Die Autorin_
Tracy Chevalier ist gebürtige Amerikanerin des Jahrgangs 1962, wuchs in Washington D.C. auf und lebt heute in London. Vor ihrem Creative-Writing-Studium an der East Anglia University, das sie 1994 abschloss, arbeitete die Quereinsteigerin als Lektorin für Nachschlagewerke. Weitere von ihr erschienene Romane: „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ (List, TB 06/2001), „Wenn Engel fallen“ (List, TB 10/2003) und „Der Kuss des Einhorns“ (List, HC 02/2004). [Quellen: Verlagsinfo und amazon.de]
_Zur Story_
Ella Turner und ihren Mann Rick zieht es nach Frankreich. Er ist ein gefragter Architekt und arbeitet an einem Projekt in Toulouse, das sicher mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Somit ist der Umzug nach Frankreich in ein verschlafenes Nest in den französischen Chevennen ein recht dauerhaftes Unterfangen. Ausgesucht hat das neue, abseitige Domizil jedoch Ella, deren Familie vor Generationen aus Frankreich nach Amerika übersiedelte und ihren Namen von Tournier in Turner änderte. Seit ihrer Ankunft in Land des Weichkäses und ihrer Ahnen wird sie von immer wieder dem gleichen Albtraum heimgesucht, in welchem die Farbe Blau eine immens wichtige und traurige Rolle spielt. Zugleich üben die beiden, Nachwuchs zu bekommen, doch gerade der Sex macht die Albträume nur noch schlimmer und intensiver. Ihrem Mann offenbart sie sich jedoch nicht.
Da sie als Hebamme im Gastland nicht praktizieren darf, weil ihr dafür die Zulassung fehlt, und Rick sehr mit seinem Job beschäftigt ist, sucht sie sich Ablenkung. Sie fühlt sich als Fremdkörper im Dorf – man schneidet sie gepflegt in der Nachbarschaft, obwohl sie sich redlich Mühe gibt, ihr verschüttetes Französisch stetig aufzubessern und sich anzupassen. Sie fühlt sich hier auch irgendwie „zuhause“. Es hilft nichts. Kurzum, sie hat niemanden, mit dem sie sich austauschen könnte. Keine Freunde, keine Verwandten. Lediglich ein Cousin in der relativ nahen Schweiz, den sie bislang noch nicht persönlich kennen gelernt hat. Getrieben von innerer Unruhe – vorerst als selbst auferlegte Beschäftigungstherapie – fängt sie enthusiastisch an, ihre Familiengeschichte zu recherchieren und herauszufinden, warum sie im Traum in blitzsauberem Französisch Bibelzitate von sich geben kann.
Ella spürt, dass die Geschichte ihrer Ahnen mit dem stets wiederkehrenden Traum in direktem Zusammenhang steht. Ihre Intuition gibt ihr Recht, doch stellen sich Erfolge beim Wühlen nach alten Dokumenten nur schleppend ein. Dafür findet sie im hiesigen Bibliothekaren Jean-Paul einen zunächst widerwilligen und abweisenden Mitstreiter, der ihr dann aber immer tatkräftiger unter die Arme (und später auch unter den Rock) greift. Das Auffinden einer alten Familienbibel aus dem Besitz der Tourniers bringt sie endgültig auf die Spur eines schrecklichen Verbrechens, das Jahrhunderte zurückliegt. Genauer gesagt aus der Zeit, als die Protestanten Frankreichs – die Hugenotten – unter dem immer mehr um sich greifenden Katholizismus zu leiden hatten und vertrieben wurden. Mitten in dieser Welt des (Aber-)Glaubens spielte sich eine Tragödie in der Familie ab, die Ella in der Jetztzeit so viel Kopfzerbrechen bereitet …
_Meinung_
Schon zu Beginn des Romans erhält der Leser einen Einblick in die Vergangenheit. Genauer gesagt in die Familiengeschichte derer von Tournier, von denen Ella abstammt. Zunächst kann man sich auf die recht wirren und in schneller Zeitrafferfolge präsentierten Fetzen aus der Familienhistorie allerdings keinen klaren Reim machen. Das legt den Grundstein für später immer deutlicher zu Tage tretende Analogien und Parallelen zwischen Ella und ihrem Pendant aus dem 16. Jahrhundert: Isabelle de Moulin. Anfänglich sind diese Flashbacks noch sauber durch Kapitel von der Geschichte in der Gegenwart getrennt, später überschneiden sich die Stränge in schnellerer Abfolge und mogeln sich gegen Ende sogar absatzweise in den Plot. Als weitere Unterscheidung erzählt Chevalier Ellas Geschichte in der Ich-Form, Isabelles Part hingegen beobachtend in der dritten Person.
Man hat den Eindruck, dass besonders Isabelle rudimentäre übersinnliche Fähigkeiten besitzt – zumindest was ihre Connection zu Ella angeht, stimmt das auch irgendwo. Chevalier deutet vermeintlich vorhandene Hexenkünste in diesem Zusammenhang allenfalls nur an. Zum Teil auch recht deutlich, wie beim Bild des immer wieder auftauchenden Wolfes, den Isabelle ganz selbstverständlich als Reinkarnation und Sinnbild ihrer toten Mutter versteht, die helfend in ihr Leben eingreifen will. Leider werden einige dieser vielversprechenden Ansätze in letzter Konsequenz nicht genügend genutzt, um dem Plot mehr Substanz zu verleihen. Solche Festlegungen, ob hier nun tatsächlich paranormale Mächte am Werk sind, oder doch alles nur Aberglaube ist, bleiben dem Leser überlassen. Der kleine Schuss Mystery verpufft ziemlich wirkungslos.
Die wichtige (wie ich finde) Frage, warum die beiden Frauen auf irgendeine Weise miteinander verbunden sind, bleibt auch am Ende der Geschichte nur vage angedeutet. Wie so vieles. Das gilt auch und speziell für die Personenzeichnung. Die Figuren sind bis auf Ella sehr zweidimensional beschrieben und vegetieren als gesichtslos und vorhersehbar agierende Schablonen vor sich hin. Selten lässt sich Chevalier mal zu detaillierteren Beschreibungen ihrer Charaktere und deren Motive hinreißen. Überraschungen in deren Handeln braucht man demzufolge auch nicht zu erwarten, auch von der Protagonistin nicht. Vollkommen linear entwickelt sich die Geschichte genau in die Richtung fort, wie man es sich beim Lesen gedacht hat. Mit Ausnahme der vielen „toten Links“, d. h. Nebenhandlungen, die aus unerfindlichen Gründen einfach nicht weiterverfolgt werden und frei schwebend irgendwo in der Luft enden.
Man ist versucht, „Das dunkelste Blau“ ziemlich schnell als „Frauenroman“ abzustempeln, und tatsächlich bedient der Roman einige der beliebten Klischees, die diesem häufig zu Unrecht negativ konnotierten Begriff andichtet werden. Eine Dreiecksbeziehung gefällig? Geht klar! Die alte In-der-Fremde-doch-noch-ne-beste-Freundin-gefunden-Leier? Biddeschön, kommt sofort! Sex? Verkauft sich immer gut und ist im Doppelpack auch billiger. Okay, wollen wir mal nicht so ungerecht sein und einräumen, dass sich der Schnulzfaktor in erträglichem Rahmen bewegt. Natürlich landet die von ihrem Mann unverstandene und vernachlässigte (Die Klischees bitte nacheinander eintreten – Danke!) Ella mit dem Nebenbuhler – nebst einem ganzen Sack voller Gewissensbisse – in der Kiste. Beinahe zufällig. Vollkommen ungewollt und unerwartet. Hust. Die Beschreibungen der horizontalen Vergnüglichkeiten fallen harmlos aus, da gibt’s Deftigeres – erotisch sind sie aber auch nicht.
Den Leser dürstet es natürlich, das Kuddelmuddel am Ende aufgelöst zu wissen. Wer mit wem und wie und warum überhaupt. Nach den ganzen Sackgassen in der Handlung wähnt man sich im Recht, die Auflösung des Rätsels zu erfahren. Das gelingt Chevalier aber nur zum Teil, die Geschichte und der damit verbundene tragische Mordfall in der Familie Tournier während der Hugenotten-Vertreibung im Jahre Fuffzehnhundertpiependeckel bleibt ungesühnt. Die Schuldigen werden nicht bestraft, de facto erfährt man eigentlich gar nichts weiter. All die kleinen eingearbeiteten Hinweise sind für die Katz bzw. für den Wolf. Den Reißwolf. Dass das letzte Drittel ganz besonders mit der heißen Nadel geklöppelt wurde, bemerkt man an einigen Inkonsistenzen, stellvertretend etwa das plötzliche Auftauchen der Figur Lucien, den Chevalier schlichtweg vergessen hat, zuvor in irgendeiner Form vorzustellen.
Die mühselig aufgebaute und konstruierte Handlung in der Vergangenheit ist historisch ganz gut recherchiert, doch vergeudet Chevalier hier um des lauen Finales in der Gegenwart Willen jede Menge Potenzial, mehr in die Tiefe zu gehen. Die böse Schwiegermutter, der patriarchische Ehemann (Volle Deckung – schon wieder tief fliegende Klischees!), ja, selbst Isabelle, der man so arg und übel mitgespielt hat – immerhin eine wichtige Schlüsselfigur – verschwinden in bester Cliffhanger-Manier schlussendlich im Vakuum der Story. Absolut unbefriedigend. Stattdessen gibt’s ein versöhnliches (aber wenig überraschendes) Schlag-auf-Schlag-Ende für Ellas Albträume, den Beziehungsstress und die Akklimatisierungsprobleme in der neuen Heimat. Und verständnisvolle Verwandte hat sie auf einmal auch gefunden, zusätzlich zur neuen besten Freundin – versteht sich.
_Fazit_
Würde man die ganzen Platitüden streichen, die in losen Enden münden, wär’s eine schöne und übersinnlich angehauchte Novelle geworden. Alternativ dazu wäre eine detailliertere Ausarbeitung der vorhandenen guten Ansätze dazu angetan gewesen, aus dem Roman viel mehr heraus zu kitzeln. So jedoch überwiegt das recht uninteressante Füllwerk, um als recht plattes Transportmedium für die sich anbahnende Romanze zu dienen. Wischiwaschi. Wer aufgrund des Covertextes mit einem sakralen Thriller vom Schlage eines Eco oder Brown rechnet, sei gewarnt.
„Das dunkelste Blau“ ist eine – im wahrsten Sinne des Wortes – triviale Criminal-Love-Story mit einem kleinen Touch von Mystery, den Tracy Chevalier aber leider nur oberflächlich streift. Dank der unscharfen Figurenzeichnung und der vorhersehbaren Handlung sicherlich keine schwere Kost und zwischen Suppe und Kartoffeln schnell durchgelesen. Empfehlenswert höchstens als seichte Bettlektüre für schlaflose Genre-Liebhaber. Wer Gehaltvolleres mag, macht einen Bogen um diese künstlich aufgepumpte und dadurch recht unausgegoren wirkende Kurzgeschichte.
_Die Buchdaten auf einen Blick:_
Originaltitel: „The Virgin Blue“
Penguin, London 1996
Deutsche Erstveröffentlichung: dtv München 1999
Übersetzung: Agnes C. Müller
ISBN: 3-423-20702-7 (2. ungekürzte TB Neuauflage 05/2004)
Ildikó von Kürthy – Freizeichen
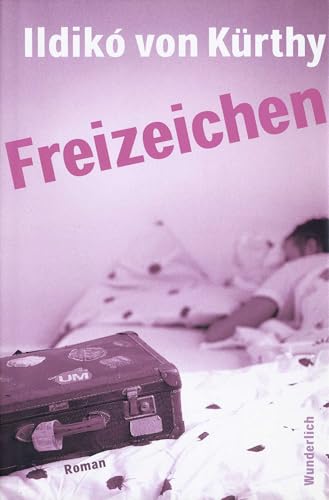
Der Leser befindet sich gleich zu Beginn mitten in einem Gedankenmonolog der Hauptperson Annabel wieder, die sogleich berichtet, dass sie nun endlich vor dem Problem steht, sich zwischen zwei Männern entscheiden zu müssen. Eigentlich ist sie bereits seit viereinhalb Jahren mit Ben zusammen, doch im Alltag ist die Leidenschaft flöten gegangen und Annabel fragt sich nun, ob diese Beziehung so noch Sinn ergibt. Kurzentschlossen – eine Fettanalysewaage und Max Frisch haben ihren Teil dazu beigetragen – fährt sie für ein paar Tage zu ihrer reichen Tante nach Mallorca, um dort über ihre Beziehung und ihre Frisur nachzudenken. Auf Mallorca angekommen, muss sie feststellen, dass ihr Koffer nicht mitgeflogen ist und ihre überschüssigen dreieinhalb Kilo sich vielleicht doch nicht so günstig verteilen, wie ihre Freundin Mona ihr das immer wieder versichert.
Whitley Strieber – Der Kuss des Todes
John und Miriam Blaylock töten Menschen, saugen ihnen das Blut aus und leben ewig, denn sie sind Vampire. Miriam weilt bereits einige Jahrtausende auf diesem Planeten und hat sich zur echten Überlebenskünstlerin entwickelt. John, der als englischer Lord mit Miriams bissiger Hilfe sein Schattendasein begann, ist gerade einmal zwei Jahrhunderte alt. Trotzdem fühlt er sich seit einiger Zeit müde und abgeschlagen, was einem Vampir eigentlich nicht passieren dürfte.
Miriam weiß mehr darüber, als sie John eingestehen mag. Ihr Blut verlängert das Leben ihrer Partner, aber irgendwann verliert es seine Kraft. Inzwischen sollte die Wissenschaft endlich in der Lage sein, ein Mittel gegen Johns ‚Krankheit‘ zu entwickeln, findet Miriam und nimmt Kontakt zur Medizinerin Sarah Roberts auf, die sich in ihren Forschungen auf das Phänomen des Alters spezialisiert hat. Whitley Strieber – Der Kuss des Todes weiterlesen
Friedmann, Celia S. – Kathedrale der Dämonen (Kaltfeuer 3)
Als die Menschen vor mehr als eintausend Jahren aus ihrem künstlichen Schlaf erwachten, um den Planeten Arna zu kolonisieren, ahnten sie nicht, wie gefährlich der Planet ist. Einer der Kolonisten vollführte ein Ritual, um Arna gnädig zu stimmen, um die Dämonen und Geister zu bändigen, die dem Unterbewusstsein der Kolonisten entsprangen.
Heute befindet sich Arna auf dem Stand des irdischen Mittelalters. Der Planet ist von einer Kraft umgeben, die sich Fae nennt und manipuliert werden kann. Doch das Fae ist gefährlich. So versagen alle Dinge, die zu viel Technik benötigen. Unter anderem schon simple Dampfkraft oder Schwarzpulverwaffen.
In dieser Welt lebt Pater Damien Kilcannon Vryce, der dem einzig wahren Gott dient. Er ist unterwegs nach Osten, um dort – auf einem unbekannten Kontinent – einen verborgenen Feind zu bekämpfen, der vielleicht die ganze Welt bedroht. Damien steht Gerald Tarrant zur Seite, ehemaliger Neograf von Merentha. Einst war er Begründer von Damiens Glauben – nun ist er der Teufel persönlich. Die beiden Männer werden von der Rakh Hesseth begleitet, die durch Geralds dunkle Macht menschliches Aussehen erhält.
Tatsächlich stoßen sie auf Zivilisation. Die Überlebenden einer vor Jahrhunderten verschollenen Expedition haben ein neues Reich gegründet und leben dort nach den Lehren, die einst vom Neograf von Merentha niedergeschrieben wurden. In diesem Gottesstaat gibt es funktionierende Technik, niemand ängstigt sich vor Dämonen und Monster, alle verehren den einen wahren Gott. Damien glaubt sich im Garten Eden, denn in seiner Heimat versagten die Menschen im Bemühen darin, dem rechten Glauben zu folgen. Doch Gerald Tarrant öffnet Damien rasch die Augen und reißt dem Feind die Maske herunter, hinter der er sich versteckt. Gerald, Damien und Hesseth fliehen …
Die Abenteuer von Damien und Gerald sind einfach faszinierend. Beide Männer sind scheinbar unterschiedlich, doch ihre Seelen weisen tiefe Abgründe auf. So ist Gerald ein skrupelloser Mörder, ein Vampir, der sich an der Angst seiner Opfer weidet. Und obwohl Damien ihn vernichten müsste, vertraut er diesem Mann, nährt ihn und lässt ihn jagen. Ganz nach dem Motto: Der Zweck heiligt die Mittel. Doch Damien ist sich bewusst, dass er auf einem schmalen Grat wandelt und jederzeit abstürzen kann. Hier arbeiten Licht und Schatten zusammen, kämpfen stets gegeneinander an und ergießen sich in Gegensätzen. Die Spannung bleibt am kochen, denn es ist fraglich, ob Gut oder Böse obsiegt – falls eine Seite überhaupt triumphieren wird.
Die emotionale Spannung baut sich also zwischen diesen beiden Männern auf. Die Figur der Hesseth wirkt noch blass, besitzt aber eine exotische Anziehungskraft. Bleibt abzuwarten, ob ihr Part in den nächsten zwei Bänden des Zyklus‘ stärker wird. Immerhin wurde der Originalroman „When True Night Falls“ (DAW Books Inc., New York) in drei Teile gespalten („Kathedrale der Dämonen“, „Tal der Nebel“, „Burg der Illusionen“). Dies geschieht zwar mit dem Einverständnis der Autorin, ist trotzdem unglücklich gemacht, da der Kaltfeuer-Zyklus vor allem im Ganzen besticht und die deutschsprachigen Bände künstlich gebrochene Spannungsbögen besitzen. Vom Preis ganz zu schweigen. Dafür hat sich der Verlag um anständige, zusammenpassende Titelbilder bemüht, die im Manga-Stil daherkommen und zu gefallen wissen.
Nun, trotz der Teilung ist „Kathedrale der Dämonen“ ein guter Roman, der sich flüssig lesen lässt. Friedman besitzt einen packenden Stil, der vom Übersetzer entsprechend eingefangen wurde. Bereits die ersten Seiten fesseln die Aufmerksamkeit, da C. S. Friedman erst einmal in die Vergangenheit reist und eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte Arnas beleuchtet. Dann wechselt die Autorin in eine real wirkende Traumsequenz, um anschließend mit ihrer Geschichte zu beginnen. Ein kontroverses Stilmittel, das gefällt.
Neben den ausgeklügelten Helden buhlen auch die Antagonisten um die Gunst der Leser. Auch sie haben ihre dunklen Geheimnisse, die nicht gelüftet werden. Ausgefeilt, mit Ecken und Kanten, herausfordernd und gefährdet – auch die Gegenseite besitzt eine große Anziehungskraft.
Obwohl Celia S. Friedman viel Wert auf Charakterentwicklung und Emotionen legt, weiß sie auch blutige und harte Szenen zu beschreiben. So liest man plötzlich von verwesenden Kreaturen, ausgeweideten Menschen und Kindern, die als Dämonenköder dienen. Das ist nichts für zart besaitete Menschen.
„Kathedrale der Dämonen“ ist ein packendes Buch. Bleibt abzuwarten, wie dem Roman die Dreiteilung bekommt. Der Auftakt ist jedenfalls sehr gelungen.
|Originaltitel: When True Night Falls (1993)
Übersetzung: Ronald M. Hahn|
_Günther Lietz_ © 2004
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de/ veröffentlicht.|