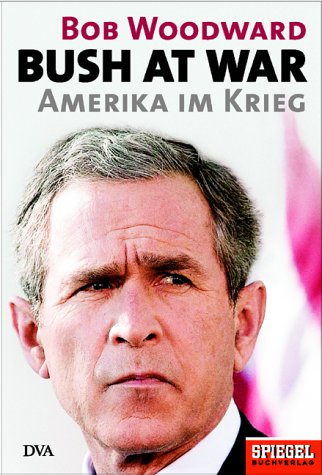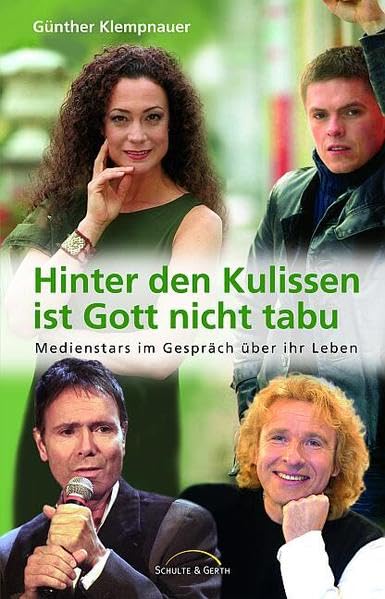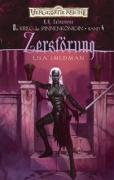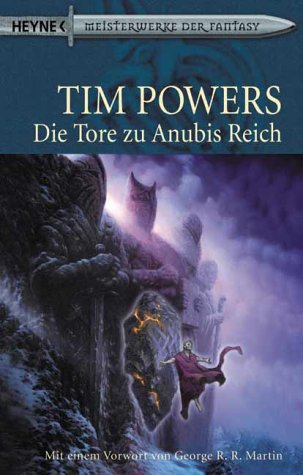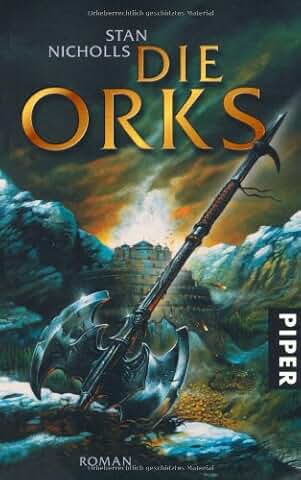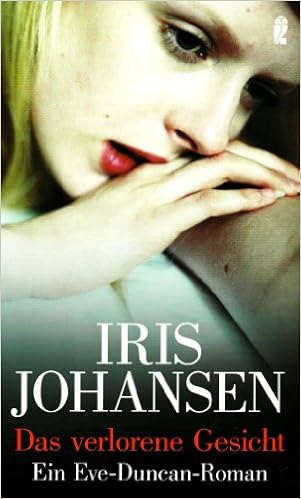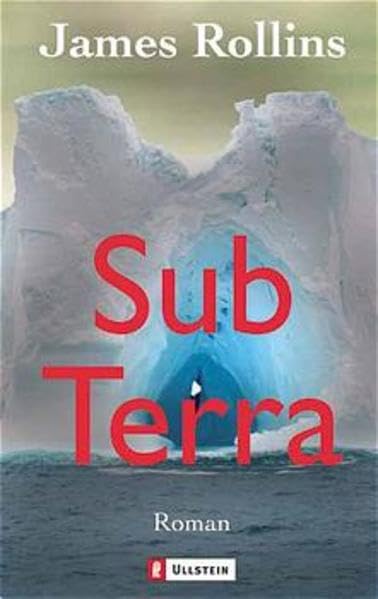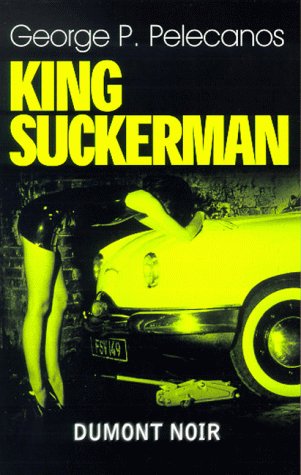Ann C. Crispin – Alien: Die Wiedergeburt weiterlesen
Woodward, Bob – Bush at War
Wohl kaum etwas hat die Weltgemeinschaft im noch sehr jungen Jahrtausend so in helle Aufregung versetzt wie der Anschlag auf die „Twin Towers“ des |World Trade Center| am Nine-Eleven. Dies war der Auftakt zu einer Kampagne von Feld- oder sollte man besser sagen |Kreuz|zügen?, die uns Bewohner dieses durchgeknallten Planeten sicher noch viel länger beschäftigen wird, als uns allen lieb (und einigen bewusst) ist – ausgelöst durch die letzte verbliebene Supermacht und selbst ernannten Weltsheriffs, die nun endlich die Möglichkeit und Legitimation sahen, ganz mächtig – und entgegen dem geltenden Völkerrecht – loszuschlagen.
Da die „Beweise“ für einen muslimischen Terrorakt mittlerweile immer zweifelhafter erscheinen, brauchte man wohl ein wenig Propaganda, daher bedient sich die Machtzentrale wohl nun auch des berufenen Mundes Bob Woodwards (Pulitzer-Preisträger und zusammen mit seinem Kollegen Bernstein der journalistische Enthüller der Watergate-Affäre, die seinerzeit Richard Nixon zu Fall brachte). Woodward gilt als Number One unter den investigativen Vertretern der Journallie und auch sein deutscher Verlag (der ehrenwerte |SPIEGEL|-Buchverlag) spricht vom Namen her für ein kritisches Sachbuch über die ersten 100 Tage nach den Anschlägen – Wollen wir mal sehen, was davon zu halten ist …
_Worum geht’s? – Zum Inhalt_
Woodward ist seit jeher bei der angesehenen Tageszeitung „Washington Post“ beschäftigt und wird seit 1972 als |der| kritische Beobachter der amerikanischen Innenpolitik gefeiert (die oben erwähnte Watergate-Affäre). Ein richtiger Wadenbeißer möchte man meinen, vor dessen Feder die Mächtigen der USA zittern. Dennoch gelingt ihm der Coup, an die geheimen *hust* Protokolle des Sicherheitsrates zu gelangen, die Nine-Eleven und den anschließenden Afghanistan Feldzug beinhalten – beinahe freiwillig habe man sie (ausgerechnet ihm!) zugänglich gemacht und auch von Seiten der Behörden und sogar der Regierung (sic!) war man gern bereit, ihm für Interviews Rede und Antwort in dieser Sache zu stehen.
Der Junta-Chief himself kommt übrigens auch oft zu Wort und wird fleißig zitiert, komischerweise jedoch nicht seine bekannten markig-lächerlichen und sinnentleerten Sprüche, die uns auch aus seinen hochnotpeinlichen TV-Auftritten bestens bekannt sind, sondern allerhand extrem fragwürdiges pseudo-intelligentes Zeug, was er Woodward gegenüber in seinen Interviews zum Besten gegeben haben soll. Woodward rekapituliert diese hundert Tage, als wäre er förmlich bei den zum Teil hochgeheimen Treffen der US-Machtzentrale persönlich anwesend gewesen. Was er nachweislich ja nicht kann, ergo ist er auf das angewiesen, was ihm diejenigen, die dort teilnehmen durften/mussten, an Informationsbrocken vor die Nase setzen.
Die hauptsächlich handelnden Personen sind hierbei: Möchtegern-Präsi George Walker Bush, Sicherheitsbelaberin Condolezza Rice, Außenscherge Colin Powell, Pentagramm-Vorstand Donald Rumsfeld, Vize-Wäre-Gern-Präsi Richard „Dick“ Cheney, CIA-Chef-Terrorist Tenet und deren Vertreter. Ach ja. Ein paar vom Fußvolk des CIA dürfen in Afghanistan auch ein paar Warlords schmieren und sich an der Frontlinie irgendwie nützlich machen. Vor allem aber ein vor Pathos nur so triefendes Ende verursachen. God bless America! Oder so.
_Wer’s glaubt, wird selig – Meinung_
Was augenscheinlich wie der große journalistische Wurf anmutet, besteht schon im Vorwort keinen zweiten Blick, denn wie Woodward dort bereits andeutet, habe man zwar von offizieller Stelle sein Buchmanuskript durchgesehen und zum Teil auf „Irrtümer“ hingewiesen, es sei jedoch nicht zensiert worden. Da er von vorneherein so vehement auf diesen Umstand pocht, kommt mir automatisch der alte Sinnspruch in den Kopf, dass wer sich vorweg ungefragt, pauschal und ohne erkennbaren Anlass verteidigt, etwas im im Schilde führt. Es riecht also bereits auf den ersten Seiten bei der Lobhudelei auf die tolle, kooperative CIA verdächtig und ganz extrem nach Schwefel – Hier ist also buchstäblich schon irgendwas im Bush, dabei hat das Buch noch nicht mal richtig angefangen und mir sträuben sich bereits die Nackenhaare.
Auf den ersten 100 Seiten erfahren wir nun wer, wo, was, wann gesagt und getan haben soll, als das WTC attackiert wurde, hier hebt Woodward mindestens drei Mal hervor, dass der „gewählte“ Präsident dieses oder jenes zu einer bestimmten Zeit unternahm oder anordnete. Es ist nicht nötig extra zu erwähnen, dass ein Präsident gewählt wird, das ist in der Regel nun mal so (außer eben bei diesem), also wie soll man diese auffällige Hervorhebung dann interpretieren – Ironie seitens des Autors?
Ich könnte jetzt in nicht enden wollende Dauerlästerei verfallen und fast jede Seite mit Gegenargumenten und Quellen belegen, doch dann kann ich gleich selbst ein ganzes Buch schreiben – ich überlasse in diesem Fall mal der Presse das Wort und kommentiere anhand der drei auf dem Buchrücken abgedruckten Statements deutscher Pressestimmen:
|“Wer Woodward gelesen hat, wird glauben, bei Bush und den Seinen dabei gewesen zu sein.“ (DIE ZEIT)|
Kommentar: Na klar, |Glaube| trifft es ziemlich gut, Glaube ist der Mangel an Wissen und selbst heute glauben noch viele an die Unbefleckte Empfängnis und daran, dass Schokoriegel gesund sind. Lieber Kritiker von |DIE ZEIT|, es muss richtig heißen: „Wer Woodward gelesen hat, |soll| glauben, bei Bush und den Seinen dabei gewesen zu sein“ oder wie es der Sportsender DSF in seinem Werbeslogan so trefflich ausdrückt, ist es besser „mittendrin statt nur dabei“ zu sein. In diese Sitzungen hat man ihn (aus nachvollziehbaren Gründen) aber nicht vorgelassen und ihn stattdessen mit äußerst dubiosen Protokollen gefüttert, die meine Oma hätte ebenso verfassen können – und die arbeitet (zumindest meines Wissens nach) nicht für die CIA.
Der Autor versucht eine gewisse Nähe zwischen der Leserschaft und den Protagonisten zu schaffen, indem er den Handelnden Emotionen wie „sie oder er dachte“ oder „empfand dies und das“ zuordnet, nur fließt die Gedanken- und Gefühlswelt bekanntermaßen nicht dergestalt in Protokolle eines Sicherheitsrates ein und muss daher reine Spekulation bleiben. Nur selten verweist er auf von ihm oder anderen geführte Interviews, aus denen er die verwendeten Informationen bezieht (allerdings sind auch alle Zitate weitgehend ohne Quellenangabe, was den Autor nicht glaubwürdiger macht).
|“Um zu verstehen, wie die Bush-Administration ihre weltpolitische Bedeutung und ihre geopolitischen Möglichkeiten einschätzt, ist das Buch von fundamentaler Bedeutung.“ (SÜDDEUTSCHE ZEITUNG)|
Kommentar: Hat fundamental nicht etwas mit fundamentalistisch zu tun? Na egal, da in dem Werk keinerlei Hinweise zu den massiv bestehenden Verknüpfungen der einzelnen Kabinettsmitgliedern zu wichtigen Firmen in der Kriegs- und Ölmaschinerie (nicht zu vergessen die innige Connection zwischen der bin-Laden-Familie und dem Bush-Clan) hergestellt werden, ist dies allenfalls ein unvollständiges und lückenhaftes Bild – um zu verstehen, was wirklich an unglaublicher Perfidität hinter den Machtinteressen der amerikanischen Führungs-Elite steckt, muss man wesentlich tiefer graben, als Woodward es gewagt hat (oder wagen durfte?) – Ein schwaches Bild für einen angeblichen Schnüffel-Journalisten, die solcherlei Angriffspunkte schon von Berufs wegen doch liebend gern weidlich ausschlachten.
Doch nichts davon wird auch nur ansatzweise aufgegriffen! Weder Haliburton noch Carlyle oder ähnlich dubiose von US-Politikern geführte bzw. mit ihnen verbundene Firmen werden auch nur mit einer Silbe erwähnt. Außerdem wird ziemlich schnell klar, dass Osama nicht das eigentliche Ziel der Vergeltungsschläge ist – zunächst wird dieser Eindruck zwar erweckt, doch schon bald ist vom angeblichen Schreckgespenst Al Qaida und dergleichen nichts mehr zu lesen, sondern nur noch von den Taliban, denen man auf deutsch gesagt um jeden Preis den Arsch aufreißen will. Natürlich spielen geopolitische Interessen eine Rolle, aber ganz andere, als hier geschildert – dass von Streubomben und ähnlichem Zeugs auch kein Sterbenswörtchen fällt, dürfte klar sein und spätestens jetzt niemanden mehr wundern … Die „Daisycutter“-Bomben werden zwar am Rande angerissen, aber derart, dass man glaubt, es wäre nur gerecht, sie zu abzuwerfen.
|“Woodward gelang ein Coup: Er konnte die Sitzungsprotokolle des Nationalen Sicherheitsrates an Land ziehen. Aus ihnen ergab sich die einzigartige Perspektive des Buches.“ (DER SPIEGEL)|
Kommentar: Oh, diese Formulierung ist geschickt und kann doppeldeutig gelesen werden, die Jungs und Mädels vom |SPIEGEL| sind nicht doof, man kann schon von einer einzigartigen Perspektive sprechen, ich würde das aber eher als ein|seitige| Sicht der Bush-Krieger bezeichnen, die Woodward brav nachbetet. Ob diese Protokolle vollständig (und wahrheitsgemäß) sind, darf anhand einiger fehlender Begebenheiten, die nachträglich öffentlich wurden, arg bezweifelt werden. So manche Passage aus dem Buch ist durch wirklich investigative Journalisten mittlerweile |ad absurdum| geführt und als Propaganda-Mär entlarvt worden.
Ebenso wie viele Äußerungen der amerikanischen Regierung zum Fall des WTC und des Afghanistan-Feldzugs. Insofern ist die Authentizität der ach-so-geheimen Protokolle doch stark anzuzweifeln, denn wenn sich viele Punkte als faustdicke Lüge herausstellen, darf man davon ausgehen, dass der Rest ebenso fragwürdig ist. Es handelt sich hierbei nämlich lediglich um die enttarnten Flunkereien – aber mit aller Wahrscheinlichkeit sind das noch längst nicht alle. Inwieweit die Protokolle den Tatsachen entsprechen, wird wohl nie ganz geklärt werden können, eines steht auf jeden Fall fest: Sie wurden massiv getürkt.
_I want to believe – Das Fazit_
Dies ist kein „Enthüllungs“-Buch, denn es leiert nur die Propaganda und Bettelei um Verständnis für den Einsatz in Afghanistan herunter. Dabei ist nicht einmal geklärt, ob die Selbstmordattentäter überhaupt welche waren. Zumindest bestehen in einigen wichtigen Punkten berechtigte Zweifel, ob nicht der Regierungsapparat selbt mit Hilfe des CIA und anderen ein wenig nachgeholfen hat, um die Legitimation, andere Staaten mit Krieg zu überziehen, zu erhalten. Wie dem auch sei, dieses Buch ist weder sachlich noch lesetechnisch auf der Höhe. Wenn ich statt Condoleeza (Rice) wiederholt „Condi“ lesen muss (die Anführungszeichen sind von mir, Woodward setzt dort keine!), keimt in mir der Verdacht auf, dass hier eine Verniedlichung und subtil eingefädelte Solidarisierung herbeigeführt werden soll – traurig, dass sich ein solches Urgestein offenbar so ohne Weiteres vor den Karren spannen ließ, diese Fabeln zu verbreiten.
Für einen ausgezeichneten Pulitzer-Reporter geht mir das kritische Hinterfragen vollkommen ab stattdessen dümpelt der Autor beim Weglassen des ganzen Firlefanzes tatsächlich nur an der Oberfläche. Die Intention dieses Buches mag falsch verstandener Patriotismus sein, oder ein weiteres denkbares Szenario wäre, dass Woodwards Arbeitgeber, die „Washington Post“ (wie übrigens auch der Nachrichtensender ABC) fest in der Hand des Bush-Clans ist. Ein Schuft, wer jetzt denkt, dass Woodward diese Hände nicht beißt, die ihn füttern. Ohne in Verschwörungstheorien abgleiten zu wollen, aber hier stimmt was nicht. Dennoch lassen sich zwischen den Zeilen einige Infos extrahieren, die interessant sind, wenngleich wohl nur ungewollt preisgegeben. Allerdings muss man sich dafür schon stark interessieren oder durch Zugriff auf andere Literatur quer lesen, damit man dem Puzzle einige weitere Stückchen hinzufügen kann. Man kann sich das Propaganda-Werk |just for show| mal geben, der Preis für die Restexemplare ist laut |amazon.de| mittlerweile auf 4,95 statt 25 Euro runtergegangen.
John Dickson Carr – Tod im Hexenwinkel
Student Tad Rampole, Sohn reicher Amerikaner und in diesem Jahr 1930 auf einer Bildungsreise durch das alte Europa, besucht in England den berühmten Privatgelehrten und Amateurdetektiv Dr. Gideon Fell. Dieser residiert in Chatterham, einem pittoresken Flecken in der Grafschaft Lincolnshire, wo die Uhren irgendwann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stehengeblieben zu sein scheinen.
Die ländliche Idylle wird seit jeher getrübt durch die unweit des Ortes dräuende Ruine des alten Gefängnisses, das seit 1837 leer steht. Der alte Anthony Starberth, ein bigotter, grausamer Mann, hatte es einst über dem alten Hinrichtungsplatz für Kapitalverbrecher und Hexen errichtet. Besonderes Grauen verbreitet der „Hexenwinkel“; dort stand der Galgen, und zu seinen Füßen ließ Anthony einen tiefen Brunnen graben, in den die Leichen der Gehängten geworfen wurden. Kein Wunder, dass es im Hexenwinkel umgehen soll! Anthony fühlte sich im Alter von den Geistern der von ihm Gemarterten verfolgt und endete mit gebrochenem Genick am Rande des verfluchten Brunnens. Seinen Sohn ereilte dasselbe Geschick, und seither starb kaum ein Starberth im Bett. John Dickson Carr – Tod im Hexenwinkel weiterlesen
Wisnewski, Gerhard – Mythos 9/11
Kritische Betrachtungsweisen zum 9/11 gibt es wie Sand am Meer. Kurioserweise schießen sie stets vor dem betreffenden Datum aus der Deckung hervor und zurück in die Köpfe der Gesellschaft. Gerhard Wisnewski legt nach seiner letzten Publikation [„Operation 9/11 – Angriff aus den Globus“ 678 mit „Mythos 9/11 – Der Wahrheit auf der Spur“ sein mittlerweile zweites Buch zum Thema vor, bei dem der Cover-Aufdruck „neue Enthüllungen“ verspricht. Unterstützt wird er bei der Publikation von Willy Brunner, mit welchem er schon die WDR-Dokumentation „Aktenzeichen 9/11 ungelöst“ produzierte, die 2003 einige Wellen schlug. Aufgrund eben jenes Beitrags wurden sie beim Westdeutschen Rundfunk geschasst und mit einem Beschäftigungsverbot beim öffentlich-rechtlichen TV belegt. Man kann nach der bewegten Vorgeschichte des Autors also davon ausgehen, im vorliegenden Werk auf einigen Zündstoff zu stoßen. Oder auch nicht?
_Offizielle contra Verschwörungstheorie_
In der öffentlichen Meinung wird der 11. September gerne kollektiv wie eine heilige Kuh behandelt. Obwohl an der offiziellen Version des Attentats so manches Teil nicht passt. Demzufolge entschied sich ein gewisser Herr Osama bin Laden, 19 Terrorpiloten auszusenden, um das Wirtschaftszentrum der Welt (das WTC), das Weiße Haus und das Pentagon empfindlich zu treffen. Vier gekaperte zivile Verkehrsmaschinen sollen die mutmaßlichen Entführer dafür in ihre Gewalt gebracht und als lebende Bomben in die betreffenden Ziele gelenkt haben. Im Falle von UA 93 ging es daneben, sie erreichte ihr Ziel (mit großer Wahrscheinlichkeit das Weiße Haus) in Washington nicht, sondern crashte vorgeblich bei Shanksville / Pennsylvenia in den Acker. Nebenbei eine „schöne“ Mär von Heldenmut und tapferen Passagieren.
Soweit die hinlänglich bekannte Version, welche über die Medien permanent verbreitet wurde und wird, in deren Konsequenz eine gefährliche Kettenreaktion ausgelöst wurde, die bis heute andauert: Der Afghanistan-Feldzug und in (bisher) letzter Instanz der Irak-Krieg. Die Anschläge mussten seither für eine Menge Repressalien und Einschränkungen in der Freiheit herhalten – alles mit dem Totschlagargument des „Kampfes gegen den Terrorismus“. Der beinahe in Nullzeit eingeführte „Patriot-Act“ ist nur ein einzelnes und prominentes Beispiel dafür, wie man sein Staatsvolk gängeln und die Verfassung aushebeln kann. Man gewinnt den Eindruck, dass genau ein solcher Fall von langer Hand vorbereitet wurde. Selbst hierzulande sind die Ausläufer des Innere-Sicherheit-Bebens mit Epizentrum in den USA spürbar. Unlängst knickt auch das alte Europa zunehmend ein. Mehr noch. Dank 9/11 schwelt es auf unserem Planeten nicht mehr, es brennt sogar schon lichterloh.
Auch wenn einige es immer noch nicht verstanden haben: Wir stehen mitten in einem weiteren Weltkrieg, ein Krieg, der jedoch auf subtilerer Ebene ausgefochten wird als seine beiden Vorgänger. Das macht ihn nicht weniger real oder vielleicht weniger tödlich für die Partizipanten, bekam aber das Label eines „gerechten“ Krieges. Dabei haben sich alle zur Rechtfertigung herangezogenen und vorgebrachten „Beweise“ für die militärischen Interventionen bislang als fadenscheinig, nicht haltbar und völkerrechtlich höchst bedenklich herausgestellt. Dass Dank des Schaffens von Fakten auch handfeste geopolitische und wirtschaftliche Interessen quasi im Handstreich durchgepeitscht wurden, wird gerne übersehen oder als „pietätlos“ wegzudiskutieren versucht. Das wirft vor diesem Hintergrund natürlich die Frage auf, was an der Geschichte des alles auslösenden Schlamassels denn nun wirklich wahr und was davon praktikable Dichtung ist.
Fest steht, dass die Ungereimtheiten des 9/11 unübersehbar sind und es allerorts mit viel Schlamperei, wenn nicht sogar Manipulation zuging. Aufklärung – so scheint es – wird nicht gewünscht; auch wenn so manche berechtigte Kritik geäußert wird, finden sich diejenigen, die sie vorgebracht haben, entweder als Terrorsympathisanten oder spinnerte Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt und ins Abseits gestellt wieder. Gruppenzwang auf amerikanisch – „Wer nicht unserer Meinung ist, kann nur ein Feind sein“. Dieser gefährlich pauschalisierte Automatismus ist unlängst in Gang gesetzt eine gern verwendete Waffe und probates Mittel, Kritiker kalt zu stellen und unangenehme Fragen zu unterbinden. Wie man an der Vielzahl von Websites und anderen Publikationen sieht, zieht diese Masche aber nicht überall.
_ Zum Buch_
Soweit also zur Ausgangslage, die auch dem Grundtenor des Buches entspricht. GW konzentriert sich aber nicht so sehr auf New York. Er verbeißt sich stattdessen verstärkt in die vermeintlichen Nebenkriegsschauplätze bei Shanksville und Washington, welche im Bewusstsein der Öffentlichkeit nicht ganz so präsent sind wie die bildtechnisch besser dokumentierten Vorgänge um den Einsturz der WTC-Tower. Das ist seiner Ansicht nach der Grund, warum an diesen beiden Orten, die nicht unter so vielen Zeugen getroffen wurden, auch keine Verkehrmaschinen einschlugen und es sich bei den Kratern nicht um Folgeschäden von Verkehrs-Linern, sondern um etwas anderes gehandelt haben kann/soll. Raketenbeschuss oder das Auftauchen eines Kampfflugzeugs vom Typ A-10 „Warthog“ bzw. einer mit Sprengstoff beladenen Drohne hält er für möglich, gestützt auf Augenzeugenberichte, Fotos und Filmaufnahmen direkt nach dem Desaster. Er kommt zu dem Schluss, dass es sich hier um eine lupenreine Inszenierung gehandelt hat – und eine schlampige noch dazu.
Anhaltspunkte für diese Theorie liefert ihm dabei nicht nur das, was man auf den Fotodokumenten und den vom FBI freigegebenen Bildern einer Überwachungskamera sieht, sondern auch das, was NICHT sichtbar ist: Flugzeugtrümmer nämlich, die zu den entführten Maschinen passen. Die offizielle Darstellung lautet: Sowohl die Boeing, die in das Pentagon einschlug, als auch jene, welche bei Shanksville den Boden umpflügte, seien vollständig „pulverisiert“ worden. Kurioserweise ist das einmalig in der Geschichte der Luftfahrt, da man bei ähnlichen Unfällen und Abstürzen doch bislang immer erkennbare Teile eines Flugzeugs dieser Größenordnung finden kann. Diese beiden Maschinen jedoch sind die Ausnahmen und das sogar an einem einzigen Tag. Zudem fehlen beim besagten Pentagon-Crash-Video urplötzlich elementare Passagen des Einschlags (erkennbar am Time-Stamp). Andere Videos von diversen Überwachungskameras wiederum sind hochoffiziell konfisziert und auf Nimmerwiedersehen im Orkus der Behörden verschwunden. Offizielle Begründung: „Nationale Sicherheit“ und „Pietät gegenüber den Angehörigen der Opfer“.
Dies sind aber nicht die einzigen Seltsamkeiten, die GW wirksam plakativ an den Leser bringt, es gibt durchaus noch mehr Aspekte, bei denen man staunend den Kopf schüttelt. Ferngesteuerte Drohnen, welche die „richtigen“ Maschinen ersetzten, sowie das unglaublich erscheinende Einstürzen gleich beider Tower in New York (was laut einiger Fachleute ziemlich unmöglich und unwahrscheinlich ist) sind nach seinem Dafürhalten keine Präzedensfälle. Sowohl Hollywood als auch schon vorherige Regierungen haben qua CIA und anderer Behörden ein solches Szenario mehr als einmal durchgekaut und in Betracht gezogen. Hinter vorgehaltener Hand natürlich. Bekannt wurde eine Aktion in den sechziger Jahren, die nach gängiger Meinung im Kennedy-Attentat gipfelte: „Operation Northwoods“ bzw. „Mongoose“. Hier sollten Kuba mit ganz ähnlichen Methoden wie heute der Islam diskreditiert und das amerikanische Volk mental auf eine Invasion vorbereitet werden. Somit wäre der Tenor der Bush-Administration „Wir haben das nicht gewusst/ahnen können“ äußerst scheinheilig. Das Drehbuch lag schon lange vor.
Gescholten werden auch die merkwürdigen Ermittlungsmethoden der US-Behörden und selbstverständlich die Journallie. Auch (und gerade) die deutsche. Logisch, denn mit dieser haben GW und WB auch hinreichend schlechte Erfahrungen gemacht und ihre Jobs beim WDR verloren. So nimmt es nicht wunder, dass die beiden Autoren hier keilen und Schienbeintritte verteilen. Im Fokus steht wieder einmal ganz besonders das Nachrichtenmagazin |“Der Spiegel“|, was für manch einen sicher einer glatten Majestätsbeleidigung gleichkommt. Das renommierte Hamburger Magazin muss sehr häufig stellvertretend als Buhmann für die ganze Zunft herhalten und sich wohl seinen Zorn zugezogen haben. Es wird ohnehin viel Werbung in eigener Sache gemacht und die Opferrolle anscheinend doch irgendwie genossen. Zwar mündet das nicht in absoluter Selbstbeweihräucherung oder -bemitleidung, jedoch ist es schon etwas auffällig, dass immer wieder von eben jenen kritischen Organisationen die Rede ist, in denen GW – zum Teil – führendes Mitglied ist.
Neu sind die Vorwürfe, dass am 9/11 ein Riesenschwindel stattgefunden hat, hingegen alle nicht. Die diversen Nutznießerschaften verschiedener neokonservativer Gruppen aus einem solchen Anschlag sind schon des Öfteren diskutiert worden – sowohl in den hier attackierten „konformen“ Medien, als auch in „konspirativen“ Kreisen. Über die möglichen Motive herrscht also weitgehend Einigkeit. Wer sich mit dem Thema etwas auseinander gesetzt hat, wird das alles irgendwie schon einmal gehört haben. Die Verbindungen der Saudis (speziell derer bin Ladens) zum Bush-Clan, die vollkommen dilettantisch-überdeutliche (und somit fragwürdige) Spurenlage, die ausgerechnet 19 nachweisliche Fliegerei-Nieten als Hauptschuldige darstellt. Die de facto nicht wirklich durchgeführten Untersuchungen der Behörden, das ausweichende Schweigen der Regierenden zu unangenehmen Fragen mit dem Universal-Argument „Nationale Sicherheit“, kurzum: all die „Schludrigkeiten“ und kalkuliert verbreitete Desinformation der Bush-Administration sind ja mittlerweile schon legendär.
_Fazit_
In der Hauptsache werden hier unlängst zuvor geäußerte Theorien und Spekulationen sowie die (großteils berechtigte) Kritik an unserer Medienlandschaft noch einmal aufgekocht. Dabei können weder die unscharfen Bilder, noch die scharfe Zunge Wisnewskis – übrigens ebenso wenig wie die offizielle Version – letztendlich zweifelsfrei beweisen, was am 11. September 2001 nun wirklich geschah. Was bleibt, ist die Frage nach der Motivation dieses Buches. Frust auf die Medien? Bitterkeit wegen des Rauswurfs beim WDR? Ich vermeine das zwischen den Zeilen und in bestimmten Formulierungen ein wenig herauszulesen, doch letztendlich weiß das nur der Autor selbst. Der Schreibstil jedenfalls ist gefällig und nicht frei von einem unterhaltsamen, ironisch-sarkastischen Unterton, was die ganze Sache süffig und flott lesbar macht. Mir entlockt der reißerische Aufdruck: „Neue Enthüllungen!“ trotzdem nur ein halbherziges Gähnen.
Ich zähle mich selbst zu den Zweiflern, stehe also dem Gedankengut per se nicht grundsätzlich negativ gegenüber, dass der 9/11 und das Drumherum ganz anders abgelaufen sind, als man uns von offizieller Seite und den Massenmedien her Glauben machen will. Wisnewski benutzt als Aufhänger bevorzugt den Pentagon- und Shanksville-Crash, leider sind gerade diese Fälle, wegen der spärlich verfügbaren und streckenweise dubiosen Informationsquellen, besonders schwer auf ihren Wahrheitsgehalt hin verifizierbar. Nichts Genaues weiß man nicht. Als Nachschlagewerk für gestandene Verschwörungstheoretiker bietet „Mythos 9/11“ sicherlich zu wenig Neues und für Neueinsteiger in die Materie nur einen (zu) kleinen Ausschnitt des Gesamtbildes, als dass man sie damit überzeugen könnte, dass die bisher verbreiteten Geschichten Mumpitz sind. Ohne Zusatzliteratur wird man als Laie in der Thematik schwerlich alles nachvollziehen können. |Summa summarum| eine unterhaltsame Lektüre, doch alles andere als eine Offenbarung.
Bibliographie des Autors:
Das RAF-Phantom (1992 als Co-Autor)
[Operation 9/11 678 (2003)
Mythos 9/11 (2004)
Weiterführende Informationen:
www.operation911.de (Website des Autors)
www.unansweredquestions.org (Website der Hinterbliebenen-Organisation)
Bitte beachtet zu dieser Thematik auch unseren Gastbeitrag von Mathias Bröckers:
[Fiktion & Wahrheit – Verschwörungstheorien als moderne Mythen.]http://www.buchwurm.info/artikel/anzeigen.php?id=24
Klempnauer, Günther – Hinter den Kulissen ist Gott nicht tabu
Unter dem verheißungsvollen Titel „Hinter den Kulissen ist Gott nicht tabu“ verbirgt sich der Journalist und Theologe Günther Klempnauer, der sich hier zur Aufgabe gemacht hat, Persönlichkeiten aus der Fernseh-, Film- und Musikwelt nach ihrem Bezug bzw. ihrem Verhältnis zu Gott zu befragen.
Dabei trifft er im Rahmen des 172 Seiten starken Buches nicht nur auf eher unbekannte Menschen wie Dietmar Schönherr und Gerhard Tötschinger, sondern auch auf die ganz großen Stars, sprich Johnny Cash (kurz vor dessen Tod), Thomas Gottschalk und Sir Cliff Richard. Interessant ist in dieser Hinsicht, dass Klempnauer seine Interviewpartner nicht immer zum selben Thema befragt. Stattdessen fängt er die jeweiligen Personen genau da auf, wo sie sich befinden, das heißt, er hat sich bereits im Vorfeld einige Gedanken gemacht, wer hinter dem befragten Menschen steht und geht dementsprechend recht individuell an die Sache heran.
Leider kann man das von seinen Gegenübern nur in den seltensten Fällen behaupten, denn nicht selten bekommt man den Eindruck, als würden diese dem Theologen nur nach der Nase reden, um sich selber so in ein besseres Licht zu stellen bzw. irgendetwas zu verkaufen, was im Hinblick auf die Überschrift einfach nicht ehrlich herüberkommt. Gerade bei Barbara Wussow und ihrem Lebensgefährten Albert Fortell und bei den Schlagersängerinnen Corinna May und Hanne Haller kommt man nicht von dem Gedanken ab, als würden sie hier bewusst übertriebene Selbstdarstellung betreiben. Dem entgegen bekommt man von den beiden Deutschrockern Udo Lindenberg und Peter Maffay nur recht allgemeine und oberflächliche Darstellungen über ihr Verhältnis zu Gott, die im Vergleich zu manch anderen Statements sowohl unvollständig als auch unzufriedenstellend erscheinen.
In diesem Sinne ist es erstaunlich, dass direkt der erste Interviewpartner, nämlich Thomas Gottschalk, die wohl ehrlichsten und auch tiefgründigsten Antworten liefert, gerade wo der „Wetten, dass …?“-Moderator ja das Image weghat, er würde mit jedem Schritt versuchen, Eigenpromotion zu betreiben. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall, und so bekommt man von Herrn Gottschalk einige Anregungen, über die es sich im Nachhinein tatsächlich nachzudenken lohnt. Weiterhin beeindruckend finde ich die Darstellungen von Dietmar Schönherr, der anhand eine Projektes zur Aufbauhilfe in Nicaragua seinen Gottglauben nach außen trägt.
Im Endeffekt wären es gerade solche Kommentare gewesen, die das Interesse an „Hinter den Kulissen ist Gott nicht tabu“ auch über die gesamte Seitenstärke aufrecht erhalten hätten, doch nachdem wirklich viele befragte Stars nie den Kern der gestellten Fragen treffen, fällt es einem zum Ende hin schwer, den Antworten solcher Künstler wie Johnny Cash etwas Positives abzugewinnen.
Das soll die Intention hinter diesem Unterfangen sicherlich nicht mindern, denn Herr Klempnauer löst seine Aufgabe sehr beachtlich, nur werden seine Gesprächspartner der Sache nur bedingt gerecht, was sicherlich sehr schade ist, denn die Idee und die Umsetzung des Autoren sind beileibe nicht schlecht.
Wisnewski, Gerhard – Operation 9/11 – Angriff auf den Globus
Was passierte am 11.September 2001? Jeder weiß es … oder glaubt es zu wissen. Zwei Flugzeuge schlagen in die Tower des World Trade Centers ein. Es ist gebannt auf unzähligen Aufnahmen. Das ist Fakt. Aber die gesamte restliche Geschichte verschwimmt, wohlwollend ausgedrückt, hinter einem Vorhang aus nationaler Sicherheit und geheim geführten Ermittlungen.
Durch die Beeinflussung der Medien wurde der Weltöffentlichkeit eine Geschichte aufgetischt, die irgendwie nicht ganz plausibel klingt. Wenn jeder mal ehrlich zu sich selbst ist fällt auf, dass niemand wirklich an genau diesen Ablauf jenes denkwürdigen Tages glaubt, der als offiziell gilt. Nur fehlte bisher eine Art Bündelung aller Zweifel. Viele kleine Hinweise, die letztlich etwas Handfestes bilden. Und eben dies ist das Buch „Operation 9/11 – Angriff auf den Globus“ von Gerhard Wisnewski. Es ist die erste ernst gemeinte, distanzierte, nüchterne Auseinandersetzung mit den Geschehnissen jenes Tages. {Ergänzung des Editors: Auch [„Fakten, Fälschungen und die unterdrückten Beweise des 11.9.“ 103 von Bröckers & Hauß darf in diese Kategorie gezählt werden.} Es ist ein „Hexenhammer des Guten“.
Natürlich lässt sich dieses Buch leicht als eine von vielen Verschwörungstheorie abtun, doch wer einen Blick hinein riskiert, der stellt fest, dass sich zwei Drittel des Buches lediglich mit der Widerlegung der als Tatsachen verkauften Behauptungen der US-Regierungsbehörden beschäftigen. Erst auf den letzten Zentimetern der Buchbreite wird eine Gegendarstellung gewagt.
Wisnewski sagt einen sehr schönen Satz in seinem Vorwort, der bezeichnend ist für die Art der Recherche seines Buches: „(Sein Buch) wirkt der Mutter aller Verschwörungstheorien entgegen, nämlich der abenteuerlichsten These, am 11. September 2001 sei es einer Handvoll Arabern gelungen, im Herzen der Militärmacht Nr. 1 das perfekte Verbrechen zu verüben.“
Danach beschäftigt man sich provokant sachlich mit jedem kleinen Detail, das den 11. September umgibt und ihn schon nach wenigen Seiten des Lesens als eine große Farce hinstellt. Und genau hier geht die Macht der Beurteilung zu Ende, denn was Wisnewski hier aufführt, sind einfach nur schlichte Fakten, garniert mit einigen Fingerzeigen, die lediglich die Schlussfolgerungen wiedergeben, die sich im Kopf des Lesers ohnehin längst ergeben haben.
Auffällig ist besonders, dass Wisnewski hauptsächlich mit allgemein gekannten Fakten arbeitet. Er hatte für seine Recherchen keinen Mittelsmann bei der CIA oder sonst irgendeiner Organisation, nein, er arbeitet hauptsächlich mit den Fakten, die über den Äther kamen, und fügt diese lediglich zusammen.
Aber was steht denn nun wirklich in diesem Buch?
Gerade darüber sollte man nicht zu viel sagen. Nicht, weil es da nichts zu sagen gäbe, sondern weil man sich in der Vielzahl der Details verliert. Zu fast jeder Begebenheit, die in Verbindung mit den Anschlägen steht, stellt das Buch eine zerstörerische Frage, hinterleucht die Idiotie der bisherigen Vermutungen und gibt einleuchtendere Lösungsansätze. Hier gilt allerdings die Regel: „Wenn der Inhalt nicht von dem Buch selbst erzählt wird, dann verliert er durch das Weglassen wichtiger Details seine Glaubwürdigkeit.“ Soll heißen: Man muss es einfach selbst gelesen haben!
Umso weiter man liest, umso mehr entsteht der Eindruck, als gehe der Autor immer risikoreicher vor. Das Buch schmeißt dem Leser nicht einfach alle Fakten und Argumente an den Kopf, sondern führt ihn vielmehr auf einen Weg der Mündigkeit. Denn um das Gegenteil glauben zu können, muss man zunächst den Glauben an die bisherige Version verlieren.
Um aber nicht gänzlich um den heißen Brei herum zu reden, möchte ich zumindest eines der eindruckvollsten Beispiele schildern, an denen das Buch beweist, dass alles anders ist, als man glaubt. Der Autor beschäftigt sich beispielsweise eingängig mit den Flugrouten der Maschinen. Dies sind Details, die hier in Deutschland nie aufgegriffen wurden, obwohl sie eine völlig neue Geschichte erzählen. So flogen die Flugzeuge, bevor sie zu ihrem phänomenalen Todesstoß ausholten, noch eine Weile lustig in der Gegend herum, weitab von irgendeinem vorgegebenen Kurs. Und dies führt schließlich zu einem der härtesten Argumente: So überraschend und genial es zunächst wirkte, Passagierflugzeuge als fliegende Bomben einzusetzen, so wenig überraschend ist doch die Situation vor den Einschlägen für die Luftfahrt der USA. Man hat lediglich ein paar Flugzeuge in der Luft, die fliegen, wie sie wollen und noch dazu keinen Funkkontakt mehr halten. In den USA sind in solchen Fällen innerhalb von drei Minuten Abfangjäger bei diesen Ausreißern. Nicht, weil sie eine Entführung vermuten, sondern weil diese ganz einfach eine Gefahr für den gesamten umliegenden Luftraum darstellen. Und dann will man uns verkaufen, dass gleich vier Maschinen mehr oder weniger gleichzeitig über eine halbe Stunde ausgerechnet auch noch teilweise über dem extrem dichten Flugraum von New York machen, was sie wollen, ohne überwacht zu werden?
Nach unendlich vielen weiteren einschlägigen Argumenten, die durch eine Vielzahl von Expertenaussagen gestützt werden, aber auch nur vermutend logischen Erkenntnissen folgen, der Teil „Hintergründe“. Leider gerät das Buch auf dieser Schlussgeraden dann doch zu einer Art Verschwörungstheorie-Doku. Wisnewski lehnt sich meiner Meinung nach zu weit aus dem Fenster, als er sogar Verbindungen zwischen Hollywood und der US Army zieht. Sicherlich ist diese immer bemüht, in Hollywood-Produktionen gut auszusehen, aber solch ausartende Verbindungen, wie sie hier gezogen werden, sind wohl übertrieben. Zwar ist der Rest der Antithese des Buches ganz akzeptabel, besonders der sehr aufschlussreiche Zusammenhang zwischen den Familien Bush und Bin Laden, doch hat Wisnewski uns gerade noch gelehrt, sich nicht von allem einwickeln zu lassen. Deshalb sollte man diese Theorien ebenso distanziert und kritisch sehen, wie das Buch die Ereignisse um den 11. September behandelt. Ganz großes Plus der Wisnewskischen Behauptungen ist allerdings eine geheime Akte namens „Operation Northwoods“. Diese wurde jahrelang auf höchster Geheimhaltungsstufe von der US-Regierung gebunkert. Und sie schildert auf erschreckende Art und Weise einen Bauplan des Terrors, der perfekt auf das Schema der Flugzeugentführungen vom 11. Semptember passt und sodann blutige, wahnsinnige Realität wurde. Damals sollte durch einen inszenierten Flugzeugabschuss ein Krieg gegen Kuba heraufbeschworen werden. Haarklein werden Flugzeugaustausch und Dronenflug beschrieben. Besonders alarmierend: welche Möglichkeiten der Technik können heute schon genutzt werden, wenn man damals bereits unbemannte, ferngesteuerte Flüge vornehmen konnte.
Vielleicht empfand es Wisnewski als Pflicht, wenn er schon alle Fakten außer Kraft setzt, auch eine plausible Gegendarstellung abliefern zu müssen, aber ich persönlich halte das nicht für nötig. Es ist völlig egal, mit welchen Gedanken man an dieses Buch herangeht, man wird geläutert werden. An was man anschließend glaubt, ist jedem selbst überlassen. Nur eines ist ganz sicher: Man glaubt nicht mehr, dass irgendwelche Hobby-Terroristen das Unmögliche geschafft haben. Man fühlt sich ein ganzes Stück mündiger in einer Welt aus medialem Trug und Halbwahrheiten. Zumindest zwei Drittel dieses Buches sollten als eines der wichtigsten Werke neo-historischer Aufklärungsschriften gelten, denn was sie darlegen, ist die Realität, in der wir leben, und die wir schon kaum noch sehen können.
Webseite des Autors: http://www.operation911.de/
Smedman, Lisa – Zerstörung (Der Krieg der Spinnenkönigin 4)
„Zerstörung“ von Lisa Smedman ist der vierte Band des sechsteiligen |AD&D|-Epos „Der Krieg der Spinnenkönigin“ (War of the Spider Queen), der in deutscher Übersetzung bei |Feder & Schwert| erscheint.
Im Zentrum des Zyklus steht eine Gruppe von Dunkelelfen, die aus ihrer unterirdischen Stadt Menzoberranzan aufgebrochen ist, um herauszufinden, warum ihre Göttin Lolth schweigt und den Priesterinnen ihre Magie versagt. Diese Schwäche machen sich die Feinde Menzoberranzans zunutze: Eine Allianz geknechteter Völker des Unterreichs sieht ihre Chance, den verhassten Dunkelelfen den Garaus zu machen. Eine Gruppe abtrünniger männlicher Drow unterstützt sie dabei nach Kräften, denn ein Umsturz der matriarchalisch geprägten Dunkelelfen-Gesellschaft wäre ganz in ihrem Sinne.
Die aus der Lolth-Hohepriesterin Quenthel, dem Draegloth Jeggred, dem Magier Pharaun, dem Waffenmeister Ryld Argith, dem Söldner Valas Hune und der aus der kürzlich verwüsteten Stadt Ched Nasad geflohenen Halisstra sowie ihrer Leibsklavin Danifae bestehende Gruppe hat schon einiges durchgemacht:
Bis in den Abyss selbst war man schon vorgestoßen, doch Lolth schweigt, und niemand weiß warum. Während Quenthel einen neuen Vorstoß in den Abyss plant, mit einem erzwungenen Umweg über ein in der See der Schatten treibendes Dämonenschiff, intrigieren die Mitglieder der Gruppe untereinander. Quenthel und Pharaun streiten sich nun nicht mehr nur mit Worten, sie machen ernst und stellen sich gegenseitig tödliche Fallen. Halisstra setzt sich unter fadenscheinigen Gründen ab und der in sie verliebte Ryld folgt ihr. Sie wendet sich endgültig von Lolth ab und Eilistraee, der Göttin der an der Oberfläche lebenden Drow, zu …
_Göttinnensuche die Vierte …_
Die auf sechs Bände ausgelegte Reihe ist der reinste Quell der Freude für AD&D- und Dunkelelfen-Fans: Das gesamte „Who is Who“ des Fantasybestiariums sowie ein geballtes Sortiment arkaner Beschwörungen wurden bisher präsentiert. Die dargebotene Vielfalt an fremdartigen Rassen sorgte für weitere Unterhaltung und Abwechslung, zumal einige Autoren profunde AD&D-Regelkenntnisse demonstrieren und in ihren Romanen umsetzen konnten.
Da jeder Band von einem anderen Autoren geschrieben wurde, gibt es jedoch einige Inkonsistenzen zu beklagen: Spielten anfangs Magier Pharaun sowie Ryld die erste Geige, wechselte dies später über Nebenfiguren bis nun hin zu Halisstra, die in diesem Band eine tragende Rolle spielt. Leider hatte jeder Autor eine geringfügig, aber dennoch unangenehm deutlich spürbar andere Vorstellung der Hauptfiguren. Dies fiel mir vor allem bei Quenthel und Pharaun auf.
Lisa Smedman, sonst eher durch ihre „Shadowrun“-Romane bekannt, hat in diesem Roman die Ehre, einen Knackpunkt der Handlung darzustellen, der sich bereits im dritten Band andeutete. Leider konnte mich der plötzliche Gesinnungswechsel Halisstras nicht überzeugen, noch weniger konnte ich nachvollziehen, warum der seit jeher für einen Drow recht sanfte und freundliche Ryld ihr auf einmal liebestrunken folgt. Dafür hat ihre per Bindungszauber an Halisstras Leben gebundene Leibsklavin Danifae keinerlei Probleme, ihre Herrin ziehen zu lassen – ihr wird schon nichts passieren …
Solche und ähnliche kleine bis ärgerliche Patzer und Wunderlichkeiten bietet diese Reihe leider zuhauf, allerdings kann Lisa Smedman in schreiberischer Hinsicht punkten: Sie kann wirklich einen spannenden Roman schreiben, nicht nur ein Sammelsurium an Monstern gemäß Regelwerk runterleiern und niedermetzeln lassen. Während sie ihre Regelkenntnisse nicht erkennbar wie einige Vorgänger demonstriert oder einfach unter den Scheffel stellt, kann sie die Figuren gut und nachvollziehbar charakterisieren, abgesehen von oben erwähnten Mängeln.
Abenteuer gibt es zuhauf, ein gewisser Eindruck, die ganze AD&D-Welt Faerûn müsse im Schnelldurchlauf abgearbeitet werden, kann ob des hohen Erzähltempos entstehen. So bleibt aber auch wenig Zeit zum Nörgeln, denn Abwechslung und Unterhaltung satt werden wirklich nonstop geboten. Ein Pluspunkt der Reihe ist die wunderschöne Präsentation: Die Cover sind durchweg in dunklen, blauschwarzen bis lila Tönen gehalten und zeigen Dunkelelfen-Motive, die zudem auch noch die Charaktere der Handlung darstellen – was durchaus keine Selbstverständlichkeit ist. Auch innen ist das Buch passend und stilsicher verziert, kleine Spinnensymbole trennen Absätze und Kapitel. Lektorat und Übersetzung sind tadellos, Übersetzer Ralph Sander von |Feder & Schwert| demonstriert Kenntnis der Materie und gab mir dem Eindruck, als wäre der Roman von Anfang an in Deutsch geschrieben worden.
_Fazit_
Für Rollenspieler und Dunkelelfen-Fans ist „Der Krieg der Spinnenkönigin“ einfach ein Muss. Die vorzügliche Präsentation und das insgesamt leicht überdurchschnittliche Niveau der unterhaltsamen Reihe macht dank der interessanten Storyline einige der Mängel wett, die eine von sechs verschiedenen Autoren geschriebene Serie mit sich bringt. Auch wenn Lisa Smedman nicht an den Autor des Anfangsbandes [„Zersetzung“, 183 Richard Lee Byers, herankommt, platziert sie sich knapp hinter ihm und setzt die Reihe spannend fort.
Wer noch nichts mit Dunkelelfen an Hut hatte, wird jedoch überfordert und unter Umständen wenig Freude an dem Roman finden, und sollte lieber mit den AD&D-Klassikern „Die Vergessenen Reiche“ (bitte nicht verwechseln mit den „Vergessenen Reichen“ von Margaret Weis und Tracy Hickman) oder der „Saga vom Dunkelelf“ einsteigen.
Homepage der Autorin:
http://www.lisasmedman.topcities.com/
Feder & Schwert
http://www.feder-und-schwert.com/
Kenneth Robeson – Doc Savage: Der Gespensterkönig
Im sumpfigen Marschland von Holland County geht der Geist von Englands Ex-König John um. Er beschuldigt die erstaunten Anwohner, ihm 1216 Gift in den Wein geträufelt zu haben, und zieht ihnen rachsüchtig eins mit dem Schwert über. Während sich die Presse lustig macht, findet der Archäologe und Geologe William Harper „Johnny“ Littlejohn endlich ein Ventil für seine Langeweile. Er reist nach England, stellt Nachforschungen an, trifft prompt den unfreundlichen König, wird von diesem niedergeschlagen und entführt.
Das war keine gute Idee, denn Littlejohn gehört zum Team von Dr. Clark „Doc“ Savage, jr., dem übermenschlich klugen und starken Bronzemann, der unermüdlich das Böse auf dieser Welt jagt und züchtigt. Als Savage, der in England einige Vorträge halten soll, seinen Freund und Gefährten vermisst, setzen er sowie Andrew Blodgett „Monk“ Mayfair und Theodore Marley „Ham“ Brooks sich auf dessen Spur. Kenneth Robeson – Doc Savage: Der Gespensterkönig weiterlesen
Alan Dean Foster – Alien 3
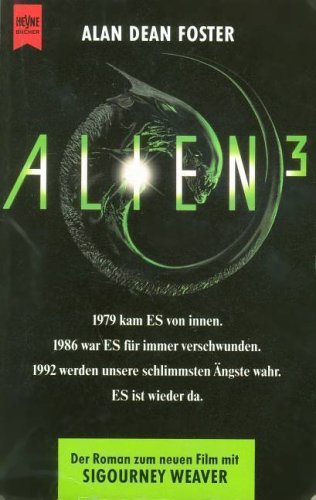
Doch auf Acheron konnte sich eine Alien-Larve an Bord der SULACO schleichen. Bei seinem Versuch, die Menschen in ihren Schlafkabinen anzugreifen, beschädigt das Wesen die Steuerung des Schiffs. Die SULACO kommt vom Kurs ab und setzt zu einer automatischen Notlandung auf dem Planeten Fiorina an. Die Schäden erweisen sich als so groß, dass der Transporter abstürzt. Das Alien stirbt, aber auch Hicks und Newt überleben das Unglück nicht. Allein Ripley kommt mit dem Leben davon.
Powers, Tim – Tore zu Anubis Reich, Die
„The Anubis Gates“ ist Tim Powers bis heute beliebtester und bekanntester Roman. Der Autor gewann mit diesem Werk auf Anhieb den Philip-K.-Dick-Award für die beste Taschenbucherstveröffentlichung des Jahres 1983 und mittlerweile wurde dieses Werk in alle Weltsprachen übersetzt. Im Deutschen erschien das Buch erstmals 1988 als |Heyne|-Taschenbuch 06/4473 und war somit die erste deutsche Übersetzung eines Werkes des Amerikaners.
Powers besuchte in Fullerton das College und die Universität, wo er K. W. Jeter und James P. Blaylock kennen lernte, beide mittlerweile selbst Autoren Phantastischer Literatur.
Vor allem mit Blaylock verstand Powers sich gut, und als Anfang der 70er Jahre in ihrer Schülerzeitung einige bedeutungsschwangere und grottenschlechte Gedichte erschienen, dachten sich die beiden, dass sie dieses Niveau noch mühelos würden unterbieten können. Deshalb schrieben sie, sich dabei zeilenweise abwechselnd, Werke, die düster und bedeutungsvoll klingen sollten, ohne wirklich etwas auszusagen. Als Pseudonym wählten sie den Namen William Ashbless und erzählten allen möglichen Leuten, dass dies ein verkrüppelter und schüchterner Freund von ihnen sei, der sich persönlich nicht an die Öffentlichkeit traue. So entstand ein Kunstfigur, die nicht nur Protagonist von Powers bekanntestem Werk ist, sondern auch in einem von Blaylocks Romanen auftritt (obwohl beide dies nicht abgesprochen hatten, sondern erst erfuhren, als sie zufällig zeitgleich ihre Manuskripte beim selben Verleger einreichten). Mittlerweile gibt es sogar ein Kochbuch, welches unter dem Namen des Dichters erschienen ist.
„Die Tore zu Anubis Reich“ beginnt mit einer Beschwörung des gleichnamigen Gottes, welche dessen Macht wieder herstellen soll, jedoch auf fatale Weise schief geht. Stattdessen werden Löcher in die Abschirmung des Zeitflusses geschlagen. Diese reichen vom Anfang des 19. Jahrhunderts (in dem die Beschwörung erfolgte) knapp 300 Jahre in beide Richtungen (also Vergangenheit und Zukunft).
Im Jahre 1983 (in diesem Jahr erschien Powers Roman) startet ein reicher Millionär, der ebenfalls die Abschirmungslöcher entdeckt hat, eine Zeitreiseexpedition ins Jahr 1810, um dem berühmten Dichter Samuel Taylor Coleridge bei einem Vortrag zu lauschen. Zur Finanzierung des teuren Unternehmens lädt er noch Gäste ein, die sich finanziell beteiligen müssen. Als Service engagiert er den Coleridge-Fachmann Brendan Doyle, der die Expedition begleiten soll. Nach dem Vortrag wird Doyle jedoch überraschend entführt und kann so nicht ins Jahr 1983 zurückkehren. Doch auch der Millionär hat längst andere Pläne, kann er doch im Jahre 1810 eine Form der Unsterblichkeit erlangen, die wohl jeden verlocken würde. Denn die Beschwörung der alten ägyptischen Götter hat auch die naturwissenschaftlichen Gesetze teilweise außer Kraft gesetzt, und so finden sich im London des Jahres 1810 mehr Magie und Zauberei, als es vor allem Brendan Doyle lieb ist.
Bald muss er um sein Leben kämpfen, droht ihm doch von vielen Seiten der Tod, und erst das von Doyle in anderer Form erwartete Auftauchen des zeitgenössischen Dichters William Ashbless, für dessen Werk der Zeitreisende zufällig auch noch Fachmann ist, bringt für den Literaturwissenschaftler die Lösung einiger seiner Probleme …
Wie Doyle sich aus einer Bredouille in die nächste windet, und vor allem auf welch verblüffende Weise er den „heute fast vergessenen englischen Dichter des frühen 19. Jahrhunderts William Ashbless“ kennen lernt, davon erzählt „Die Tore zu Anubis Reich“ äußerst unterhaltsam und spannend.
Was Powers im Laufe der knapp 600 Seiten des Buches dabei an Action, frappierenden Ideen und tollen, verzwickten Handlungssträngen entwickelt, ist einfach sensationell. Nie lässt den Leser die faszinierenden Geschichte aus ihrem Griff. Dabei wechselt der Autor klug Action mit ruhigeren Passagen, in denen sich die vielschichtige Handlung entwickeln kann, ohne dass der Rezipient den Überblick verliert.
Dabei ist „The Anubis Gates“ nicht nur ein packender und zudem intelligenter Roman, er jongliert auch mühelos verschiedene Subgenres der Literatur, vor allem der Phantastischen. Neben Horror- und Fantasyelementen hat die Geschichte zudem eine SF-Rahmenhandlung aufzuweisen, ist außerdem genauso Kriminalroman wie historische Erzählung.
Bisher hat es wohl weltweit noch kaum ein anderer Autor geschafft, diese Genres dermaßen virtuos zu mixen (einziges, dem Rezensenten bekanntes Beispiel für ein ähnlich gelungenes Werk erscheint Christopher Priests genialer Roman „Das Kabinett des Magiers“ zu sein, welcher aber erst zwölf Jahre nach Powers Meisterwerk erschien).
|Heyne| legt dieses nun in einer überarbeiteten Übersetzung in seiner Reihe „Meisterwerke der Fantasy“ wieder auf, wobei das Buch sicherlich nicht der üblichen Fantasy zugeschlagen werden darf, eigentlich besser unter der Rubrik „Phantastik“ eingeordnet werden sollte.
Denn „Die Tore zu Anubis Reich“ ist Phantastik im ureigenstem Sinne, Literatur zum Staunen und Wundern, welche den Kopf genauso anspricht wie den Bauch, und welche perfekt die Balance hält zwischen dem berühmten „Sense of Wonder“ einerseits und einer überzeugenden, niveauvollen Handlung, die in ihrer herrlichen Irrwitzigkeit ihres Gleichen sucht.
Sollte es dort draußen noch Leser geben, die Powers Meisterwerk bisher nicht kannten: Nun, hier ist die ultimative Gelegenheit! Wer jetzt nicht zuschlägt, ist selbst schuld!
_Gunther Barnewald_ © 2004
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung unseres Partnermagazins [Buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de veröffentlicht.|
William Shatner (mit Judith u. Garfield Reeves-Stevens) – Sternendämmerung (Star Trek)
James Tiberius Kirk, Raumschiff-Captain außer Dienst aber weiterhin als Retter des Universums tätig, möchte mit seinem neuen Freund Jean-Luc Picard einige Tage Abenteuerurlaub machen. Aus Gründen der Handlungsdramatik beschließen die beiden, dies auf dem Planeten Bajor und im Schatten der Raumstation „Deep Space Nine“ zu tun. Sie haben keine Ahnung, dass sie ihre Atmosphären-Gleitsprünge ausgerechnet über einem Wüstengebiet absolvieren, das vor dreißig Jahren Schauplatz einer merkwürdigen Episode des bajoranisch-cardassianischen Krieges war. In Bar‘trila, der verlorenen Stadt, wurde eines jener als „Tränen der Propheten“ bekannten Artefakte vermutet, die der im Wurmloch über Bajor hausenden Superintelligenz zugeschrieben werden und dem Finder quasi übernatürliche Macht verleihen. Damals konnten die Bajoraner die Cardassianer unter hohen Opfern von diesem Platz verjagen. Die Überlebenden beider Seiten haben den ungehobenen Schatz freilich nicht vergessen.
Unsere gleitenden Helden werden zum Absturz gebracht. Die Notlandung lässt sie in der glühenden Wüste stranden. Während sie dem feuchten Horizont zustreben, bleibt viel Zeit, sich über Vergangenes zu unterhalten. Das bedingt eine lange Kette primär Kirkscher Reminiszenzen an glorreiche „Enterprise“-Zeiten und die Einsamkeit des Captains, der in brenzliger Lage kurzentschlossene Entscheidungen treffen muss.
Die Handlung wird wieder aufgenommen, als Kirk und Picard in eine archäologische Ausgrabung stolpern. Die verlorene Stadt wurde gefunden: von den Bajoranern, aber wohl nicht nur von ihnen, denn just fiel Professor Nilan einem merkwürdigen Unfall zum Opfer. Der Tod weiterer Forscher zeigt eine feindliche Macht am Werk ist. Oder sind es religiöse Fundamentalisten, die es nicht dulden, eventuelle Artefakte als Objekte der Wissenschaft missbraucht zu sehen? Die Lage ist undurchsichtig und eskaliert, als auf Kirk und Picard ein Mordanschlag verübt wird, der Letzteren in einem See versinken lässt. Ist Picard tot? Mit der für ihn typischen Mischung aus Elan und Zorn geht Kirk auf Konfrontationskurs und stört den Gegner auf …
Alter Mann mit jugendlichem Ego
Der rasende Rentner macht erneut das All unsicher. „Sternendämmerung“ ist der furiose Auftakt einer weiteren „Star-Trek“-Kirk-Trilogie. Weil er trotz seines überlebensgroßen Egos kein Dummkopf ist, hat sich William Shatner wiederum der Unterstützung des schreibenden Ehepaars Judith und Garfield Reeves-Stevens versichert. Eine kluge Wahl, denn kaum jemand kennt sich so gut im „Star-Trek“-Universum aus und trifft vor allem den Ton, der uns seine Protagonisten seit vielen Jahren zu lieben und teuren Feierabend-Gästen im Fernsehzimmer macht.
Shatner möchte selbstverständlich „Star-Trek“-Luxus-Science-Fiction produzieren. Das meint er sich und seinem Publikum als der leibhaftige und einzige James T. Kirk schuldig zu sein. Der Leser honoriert und schätzt es, nicht zum x-ten Male mit einem Abenteuer der legendären Fünfjahresmission behelligt zu werden, die sich längst alle irgendwie ähneln. „Sternendämmerung“ gelingt darüber hinaus, was man in Kino und Fernsehen oft entbehren muss: die (überzeugende) Verklammerung von „Star-Trek“- Vergangenheit und -Gegenwart, zwischen denen die Handlung immer wieder springt.
Damit stellt sich „Sternendämmerung“ tapfer der quasi realen, Jahrhunderte umspannenden Fiktion, welche die „Star-Trek“-Saga heute darstellt. Das Autorentrio fürchtet nicht die faktenreiche Historie (oder ihre detailversessenen, pingeligen Kenner), sondern stellt sie in den Nutzen ihrer Geschichte. Noch in den Nebensätzen werden immer wieder Ereignisse aufgegriffen, an die sich womöglich nur der absolute Trekkie erinnert. Das lässt ein außerordentlich dichtes Hintergrundgewebe entstehen, auf dem der eigentliche Plot stabil ruht.
Aller Anfang ist – langsam
‚Ruht‘ ist der zutreffende Ausdruck, denn obwohl stets etwas geschieht, ist „Sternendämmerung“ sichtlich die Ouvertüre zu einem Spektakel, das sich über mindestens 1200 Druckseiten hinziehen wird. So reihen sich zunächst zwar spannend geschriebene aber zusammenhanglos wirkende Episoden aneinander, bis endlich ein roter Faden – der Kampf gegen die „Totalität“ – sichtbar wird. Wer barockes Breitwand-Fabulieren schätzt, wird mit „Sternendämmerung“ nur allmählich auf seine Kosten kommen.
Wer ist der beste „Enterprise“-Kapitän aller Zeiten? William Shatner kennt die Antwort auf diese Frage genau, und seit er ‚Schriftsteller‘ geworden ist, nutzt er jede Gelegenheit, die Trekkies auf seine Seite zu ziehen. Dieses Mal konnten ihn die Reeves-Stevens offenbar nicht so gut kontrollieren wie sonst. Das Ergebnis: ein durch Raum und Zeit kapriolender Kirk, den sein Freund Picard gnädig begleiten darf (wenn er denn Schritt halten kann).
Jean-Luc Picard ist in der Tat ein manchmal dröger Zeitgenosse, aber zum Steigbügelhalter des entfesselten Kirk degradiert zu werden, hat er ganz sicher nicht verdient! Auf der anderen Seite weiß Shatner anschaulich zu machen, dass die Sturm- und Drangzeit der Föderation Männer wie ihn – Tatmenschen – benötigte, die nach der Konsolidierung einer nüchterner forschenden Generation Platz machen konnten und mussten.
Picard ist in der Krise durchaus zu schnellen, die Regeln großzügig auslegenden Entscheidungen fähig. Kirk lebt allerdings in einer Welt, der jedem Moment eine potenzielle Ausnahmesituation entspringen kann. Das hat ihn geprägt und zu dem unberechenbaren Strategen werden lassen, der geachtet und gefürchtet (oder verflucht) wird.
Interessant sind Kirks Selbstreflexionen, die viel vom wahren William Shatner verraten. „Im Gegensatz zu den verlorenen Details standen die Gefühle der damaligen Zeit … Einen Traum verwirklicht zu haben, mit hoch angesehenen Profis und guten Freunden zusammenzuarbeiten … Er konnte immer noch auf jene Erinnerungen zurückgreifen, auch wenn manche von ihnen dunkler und schmerzhafter waren“ (S. 100). Diese Passage spiegelt womöglich Shatners lückenhafte und geschönte Erinnerung an seine „Star-Trek“-TV-Tage wider, die er nach Auskunft seiner erbosten Schauspieler-Kollegen weitgehend vergessen hat, um sie erst im Alter autobiografisch und lukrativ wieder zum Leben zu erwecken.
Autor/en
William Shatner wurde am 22. März 1931 im kanadischen Montreal geboren. Er studierte Wirtschaftswissenschaften, wurde aber schon in jungen Jahren Schauspieler – zunächst beim Theater, wo er u. a. in zahlreichen Shakespeare-Stücken auftrat. 1956 ging Shatner nach New York zum Broadway. Parallel dazu spielte er in TV-Dramen, die damals noch live gesendet wurden. Zwei Jahre später tauchte Shatner in „The Brothers Karamazov“ (dt. „Die Brüder Karamasow“) an der Seite von Yul Brunner und Maria Schell im Kino auf.
Der echte Durchbruch blieb aus. In den nächsten Jahren spielte Shatner in zahlreichen aber schnell vergessenen Kinofilmen und TV-Shows mit. Darin lieferte er trotz seiner theatralischen bis pathetischen Darstellungsweise durchaus achtbare Leistungen ab, die ihm die Kritik bekanntlich gern abspricht. 1966 bis 1969 folgte die Hauptrolle in „Star Trek – The Original Series“, gefolgt von einer langen Durststrecke und den für Shatner typischen Rollen in B-Movies und Fernsehserien.
Aber Shatner blieb am Ball. Die Rückkehr als Captain Kirk in den „Star-Trek“-Kinofilmen brachte ihm endlich die Popularität, die er sich wünschte. Er nutzte sie geschickt, um in den 1980er und 90er Jahren eine parallele Karriere als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent in Gang zu bringen. Seine Aktivitäten als Schauspieler schränkte er keineswegs ein, versuchte sich als Sänger, wurde Pferdezüchter, gründete eine Firma für Spezialeffekte – und entwickelte schriftstellerische Ambitionen.
Von Anfang an sah sich Shatner primär als Lieferant von Plots und Ideen, die von Profischreibern in literarische Form gegossen wurden aber unter seinem zugkräftigen Namen erschienen. Als Ghostwriter für die „Tek-War“-Serie (ab 1994) fungierte SF- Veteran Ron Goulart. Da der Erfolg sich in Grenzen hielt, besann sich Shatner seines Alter Egos James T. Kirk, den er mit tatkräftiger Unterstützung der Reeves-Stevens (s. u.) ins Leben zurückkehren ließ.
Trotz seines Alters denkt Shatner nicht an den Ruhestand. In seiner Rolle als unwürdiger Greis besetzt er im Kulturleben der USA heute etwa dieselbe Nische wie hierzulande Dieter Bohlen oder Jürgen Drews und hat sich als Trash-Ikone und Amerikas liebster Toupet-Träger eine solide Alterskarriere aufgebaut. William Shatner ist in dritter Ehe verheiratet, hat vier Kinder und lebt in Südkalifornien und Kentucky.
Judith und Garfield Reeves-Stevens schreiben Romane und Drehbücher. Außerdem sind sie Produzenten für Kinofilme und Fernsehserien, Ideenlieferanten für SF- und Fantasy-Games und, und, und … Im „Star-Trek“- Universum zählen die Reeves-Stevens zu den Besten unter den Fließband-Literaten des Franchises. Garfield allein schrieb bisher fünf Thriller, die Elemente der Science Fiction mit der des Horrors verknüpfen.
Garfield und Judith sind kompetente „Star-Trek“-Chronisten, die über die verschiedenen Serien großformatige, sehr informative und unterhaltsame Sachbücher verfasst haben.
Taschenbuch: 404 Seiten
Originaltitel: Captain‘s Peril (New York : Pocket Books 2002)
Übersetzung: Andreas Brandhorst
http://www.randomhouse.de/heyne
eBook: 730 KB
ISBN-13: 978-3-641-11518-0
http://www.randomhouse.de/heyne
Der Autor vergibt: 



Bernd Wedemeyer-Kolwe – Der neue Mensch. Körperkultur im Kaiserreich und in der Weimarer Republik

Nicholls, Stan – Orks, Die
Der „Herr der Ringe“, dessen Verfilmung zahllose Fans begeistert hat, mag ein Grund sein, warum auf einmal die fantasy-typischen Standardbösewichte,
_DIE ORKS_,
sich so großen allgemeinen Interesses erfreuen dürfen.
|Piper| legt mit Stan Nicholls‘ „Die Orks“ einen Sammelband von drei Ork-Geschichten vor, die uns ein Abenteuer aus Ork-Sicht schildern. So erhält man mit dem 800 Seiten dicken Buch eine komplette und abgeschlossene Trilogie!
Der eher unbekannte australische Autor Stan Nicholls schrieb neben den Orks die bisher ausschließlich im englischen Original erschienene „Quicksilver“-Trilogie und die „Nightshade-Chronicles“, die beide klassische Fantasythemen behandeln.
Der Sammelband „Die Orks“ ist ein sehr sauber und solide broschiertes/kartoniertes Buch. Auf dem breiten Buchrücken sowie dem schwarzen Cover ist eine riesige, vermeintliche Ork-Axt abgebildet – ironischerweise die Axt „Snaga“ des Helden Druss von David Gemmell … Darüber prangt der goldene Schrifzug „Die Orks“ – eine sehr gefällige Gestaltung! Eine SW-Karte zeigt den Handlungsort Maras-Dantien, zur Einstimmung beginnt das Buch mit einem alten Orks-Kriegslied, das sehr schön und sich gut reimend übersetzt wurde.
Das Buch besteht aus den Einzelromanen:
Leibwächter des Blitzes (Bodyguard of Lightning)
Legion des Donners (Legion of Thunder)
Krieger des Sturms (Warriors of the Tempest)
– alle von Stan Nicholls, zusammen eine abgeschlossene Handlung bildend.
_Piper-Orks, Heyne-Orks?_
Wer sich wundert, warum „Die Orks“ auf einmal bei |Piper| und nicht wie ursprünglich bei |Heyne| erscheinen: |Heyne| gehört zu der Verlagsgruppe |Random House|, deren Anteil im Fantasytaschenbuchmarkt so groß wurde, dass vom Bundeskartellamt der Verkauf einiger Reihen gefordert wurde. Die Reihe |Heyne Fantasy|, zu der auch „Die Orks“ gehören, erscheint somit neben anderen klangvollen Namen wie Ursula K. LeGuin, Terry Pratchett und Robert Jordans „Rad der Zeit“ nun bei |Piper Taschenbuch|. Optisch wurde nur der Schriftzug des Verlags auf dem Cover der „Orks“ verändert, alle genannten Reihen werden weiterhin erscheinen. Man kann auf die kommende und nun wahrlich opulente Fantasy-Vorschau des Piper-Verlages zu Recht gespannt sein! Weitere Details finden sich in den [Buchwurminfos III/2004]http://www.buchwurm.info/artikel/anzeigen.php?id=19.
_Zur Sache – was mordet Ork in diesem Buch?_
Der von dem Ork Stryke geführte Kriegstrupp der „Vielfraße“ führt auf den Schlachtfeldern Maras-Dantiens einen blutigen Krieg im Namen ihrer halborkischen Königin Jennesta. Die „älteren“ Rassen der Orks, Zwerge und Elfen stehen im Kampf mit den „Spätankommer“ genannten Menschen. War das Land Maras-Dantien reich an Magie, zehrt die Ankunft der Menschen an dessen Substanz, und der Zauber wird immer schwächer. Glaubenskriege zwischen den die älteren Göttern verehrenden „Mannis“ und den an den einen Gott glaubenden „Unis“ prägen das Land von der Kirgizil-Wüste bis zum Hojanger-Ödland im Norden. Dabei kämpfen Menschen und andere Rassen auch untereinander. Die Orks gelten als die besten Krieger Maras-Dantiens, treten jedoch nicht als eigene Nation auf, sondern werden als Leibwächer oder Kriegstrupps von vielerlei Herren angeworben, von den Menschen verständlicherweise weniger.
Eines Tages erhält Stryke den Auftrag, seiner Herrin Jennesta ein besonderes magisches Artefakt zu überbringen. Der Trupp gerät jedoch in einem Hinterhalt, Kobolde können das Artefakt entwenden. Bei der erzürnten Jennesta fällt der Trupp sofort in Ungnade, und sie hetzt ihre Soldaten, Kopfgeldjäger und sogar Drachen den „Vielfraßen“ hinterher …
Stryke erfährt bald mehr über das Artefakt, eines von fünf sogenannten „Instrumentalen“ … Zusammengesetzt werden sie zu einem Objekt großer Macht, das den Niedergang der Magie stoppen und vielleicht sogar die Orks aus der in Strykes Augen unwürdigen Leibknechtschaft befreien könnte.
Auf der Flucht vor Jennesta und der Suche nach den weiteren Instrumentalen stoßen Stryke und sein Trupp mehrfach mit fanatischen Menschen, Zentauren, Fischwesen und allen Arten von Geschöpfen, welche die Fantasyliteratur bisher hervorbrachte, zusammen. Der geheimnisvolle Seraphim sowie die ebenfalls recht widerwärtigen beiden Schwestern Jennestas mischen sich immer wieder in die Geschicke des Trupps ein … bis es zum Showdown zwischen Stryke, seinen „Vielfraßen“ und der bösen Königin kommt.
_Doch keine „echten“ Orks?_
Auch wenn der Klappentext „Ein etwas anderes Fantasy-Epos – mit den Bösen aus J. R. R. Tolkiens |Herr der Ringe| in den Hauptrollen“ verspricht: Die Welt Maras-Dantien ist doch sehr verschieden von Tolkiens Mittelerde!
Die Orks sind nicht ganz so hässliche Kreaturen wie die anscheinend das Zahnersatz-Bonusheft verachtenden Stinkfüße aus dem Herrn der Ringe, die zudem extreme Hautprobleme und miserable Beauty-Berater haben.
Groß, kräftig, wild, tödlich – im Gegensatz zum |Herrn der Ringe| wirbelt hier ein Ork locker drei, vier Menschenkrieger durch die Luft, nicht umgekehrt. Geblieben ist die Denkart: Orks lösen ein Problem direkt – mit dem Schwert und Körpereinsatz. Zimperlich sind sie nicht, im Gegenteil, sie leben erst so richtig auf, wenn Körperteile und Blut nur so spritzen! Vorurteile gegen die geldgierigen Zwerge hegen sie ebenso, was sich in den unterhaltsamen Streitigkeiten des Ork-Feldwebels Haskeer mit dem einzigen Zwerg im Trupp, Feldwebel Jup, zeigt.
Ein Unterschied zum klassischen Ork ist die Disziplin der Vielfraße: Professionelle, gut ausgebildete und schlachtenerprobte Krieger, die vor allem auch |diszipliniert| sind, das sind Nicholls Orks. Trotz dieser Unterschiede bleibt das barbarische Wesen der Orks dennoch weitgehend unangetastet.
Kämpfe gibt es im Verlauf der sehr linearen Storyline zuhauf. Obwohl einige wirklich brutale Dinge wie die Opferungen menschlicher Gefangener durch die halborkische Königin Jennesta, denen sie zu magischen Zwecken das Herz herausreißt (vorher „vergnügt“ sie sich gerne mit ihren Opfern im Bett oder auf dem Altar …) enthalten sind, gehen Gräuel und Fanatismus selten von den Orks aus. So sind menschliche Söldner oder hetzerische Menschen-Prediger die wahren Bösewichte, nicht die gewalttätigen, kämpferischen und etwas dummen Orks.
Die Vielfalt an fantasytypischen Rassen und Figuren, die im Handlungsverlauf auftreten, ist enorm. Für Abwechslung ist gesorgt, auch beschränkt sich die Story nicht nur auf Hauen und Stechen. Der Zwerg Jup darf so z. B. in einer Menschenstadt spionieren, einzelne Truppmitglieder werden geschnappt von ihren Jägern und erleben parallel zum Haupttrupp ihr eigenes Abenteuer. Gelegentlich wird zu Jennestas ebenfalls bösartiger Schwester Adpar und ihrem Kampf gegen die fischartigen Merz umgeblendet. Besonders amüsant ist auch der fanatische Menschenprediger Kimball Hobrow, seine hartherzige Tochter mit dem passenden Namen „Milde“ und die gemeinen Söldner um Micah Lekmann.
Die Kampfszenen sind sehr lebendig und spannend, sogar Drachen tauchen kurz auf, alles was das Herz des Orkfreunds begehrt. Was will man mehr?
Leider können die schöne Aufmachung und der geglückte Versuch, auf der Massenbegeisterungswelle des |Herrn der Ringe| mitzureiten, nicht verbergen, dass Nicholls einfach kein zweiter Tolkien ist.
Neben dem Ork Stryke, der für einen Ork ungewöhnlich schlau ist, zeigen nur die Figuren in seinem Kriegstrupp wie Alfray, Coilla, Jup und Haskeer so etwas wie Charakter. Alle anderen Orks, auch die des Trupps, sind bedeutungs- und weitgehend sogar namenlos. Dasselbe gilt für die anderen Fantasyrassen: Sie werden wie Statisten nacheinander besucht, ihres Artefakts beraubt und abgehandelt. Königin Jennesta wird als ziemlich flacher, böser Charakter dargestellt. Die Menschen werden ganz gut zum Teil als üble Bösewichte geschildert, ohne zu platt zu werden.
Die furiosen Gefechte können nicht über im späteren Handlungsverlauf auftretende Durststrecken hinwegtäuschen. Das von Nicholls selbst erdachte Finale kam bei mir sogar noch weniger gut an als seine oft geradezu zwanghaft in die Handlung integrierten, geklauten Fantasywesen/rassen an. Alles in allem jedoch keinesfalls ein schlechtes Buch. Allerdings auch keine wirkliche Empfehlung.
Eine kleine Leseprobe aus dem orkischen Marschlied am Anfang des Buchs:
|“Wir sahn einen Bauern so fett mit seiner Tochter so nett,
die Spitzen unserer Dolche weckten ihn rau,
er fing an zu stammeln und zu kreischen, gab uns Gold ohne zu feilschen,
die Tochter floh, also brieten wir seine Frau.
Und jetzt, orkische Lumpen, hebt euren vollen Humpen,
in tüchtigen Schlucken sauft das starke Bier,
spießt sie auf im Geplänkel wie von Schweinen die Schenkel,
fett und reich, so sehen wir Vielfraße uns wieder hier!“|
_Fazit_
Für Fantasy-Freunde ein Paradies. Die Ork-Perspektive des Buches weiß zu gefallen. Trotzdem kommt das Buch oft nicht über gutes Mittelmaß hinaus. Wer selten Fantasy liest oder Tiefgang und Anspruch sucht, der wird hier nicht fündig. Da das Buch ein sehr schön gestalteter Riesenwälzer von 800 Seiten ist, stellt es jedoch ein sehr schönes Geschenk für die entsprechende Zielgruppe dar.
|Tipp – oder Warnung (?)|
Dank des großen Verkaufserfolgs der Orks gibt es nun auch die „Zwerge“ und die „Elfen“ sowie Weiteres von Stan Nicholls. Man kann nur hoffen, dass hier nicht auf Kosten bekannter Fantasylieblinge deren Fans mit reihenweise Mittelmaß bombardiert werden. „Die Zwerge“ zumindest kamen bei der Zielgruppe allerdings überwiegend gut an.
Homepage des Autors: http://herebedragons.co.uk/nicholls/
Andreas C. Knigge – Alles über Comics
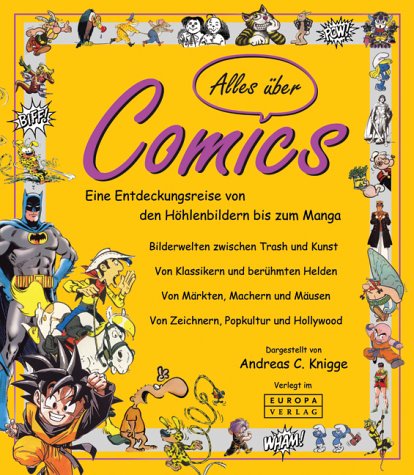
Interview mit Tobias O. Meißner
_Mit seinem Fantasy-Roman „Das Paradies der Schwerter“ machte Tobias O. Meißner dieses Jahr allerorts Schlagzeilen. Nicht nur die Feuilletons von |FAZ| und |SÜDDEUTSCHE ZEITUNG| sind begeistert, auch aus der SF- und Rollenspiel-Szene kommen zahlreiche lobende Rezensionen. [ALIEN CONTACT]http://www.epilog.de/Magazin/ sprach mit ihm über seine Romane, seine Arbeitsweise und sein nächstes Buch._
_AC:_
Für viele Leser aus der Science-Fiction- und Fantasy-Szene bist du noch ein unbeschriebenes Blatt. Kannst du uns etwas über deinen Werdegang erzählen?
_Meißner:_
Ich wurde 1967 in der Weltstadt Oberndorf am Neckar geboren und bin im Alter von zwei Jahren mit meinen Eltern nach Berlin emigriert. Beruflich wurde ich vor allem von meinem Vater geprägt, der Journalist war. Mit 18 Jahren habe ich selbst angefangen als Journalist zu arbeiten. Danach habe ich Publizistik und Theaterwissenschaften studiert und abgeschlossen. In der Zeit habe ich auch mehrere Praktika gemacht, unter anderem für Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen. Dabei habe ich festgestellt, dass Journalismus doch nicht das Richtige für mich ist, weil ich es nicht so gut finde, wenn man innerhalb ganz kurzer Zeit Resultate erzielen muss, weil immer ein extremer Zeitdruck herrscht. Beim Schreiben von Belletristik arbeite ich zwar auch gern mit Deadlines, aber die sind dann schon etwas fürstlicher. Ich hatte bei den Zeitungen immer das Gefühl, dass man unglaublich viel verschenkt, wenn man sehr schnell schreiben muss.
In meiner Freizeit habe ich angefangen zu schreiben, bereits während der Schulzeit. 1990 habe ich mit drei Freunden einen kleinen Literaturklub gegründet, den wir »Deadline Project« nannten. Es ging darum, dass jeder in jedem Monat ein Kapitel einer Geschichte schreibt und es den anderen schickt. Jeder schrieb also einen Text und bekam drei. Nach einem halben Jahr gaben zwei von den vieren als Autoren auf, weil es nicht jedermanns Sache ist, jeden Monat pünktlich ein neues Kapitel liefern zu müssen. Aber die beiden blieben uns weiter als Leser treu, während Michael Scholz und ich als Autoren übrig blieben. Wir beide haben uns gegenseitig immer weiter angestachelt, weil keiner aufgeben wollte. Im Rahmen dieses »Deadline Projects« sind von 1990 bis 1996 meine ersten in sich geschlossenen Bücher entstanden: „Starfish Rules“, „HalbEngel“ und „Hiobs Spiel“, und Michael verfasste „Der Schreiber“, „Revolver“ und „Splitterkreis“. Dabei haben wir gar keine Kontakte zu Verlagen gesucht, das war nicht wichtig für uns. Erst als ich drei fertige Romane in der Schublade liegen hatte, dachte ich, dass es toll wäre, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich den Spaß am Schreiben mit finanziellen Einkünften zu verbinden. Ich habe es zunächst mit „Starfish Rules“ versucht, und es klappte dann auch.
_AC:_
Zu welchen Verlagen hast du den Roman geschickt?
_Meißner:_
Das waren nur sechs oder sieben Verlage. Ich habe mich dabei an meiner eigenen Büchersammlung orientiert, um herauszufinden, welchen Verlagen ich meinen Text anvertrauen würde. Verblüffend früh hat sich |Rotbuch| in Hamburg für das Manuskript interessiert. Ich habe allerdings nicht das Manuskript versendet, weil ich befürchtete, dass es in einer Flut von unverlangt eingesandten Texten untergeht. Stattdessen habe ich eine Art Werbeseite designt, auf der die Schlagworte draufstanden sowie der Satz: »Bei Interesse fordern Sie das Manuskript an.« Rotbuch war der einzige Verlag, der auf diese Werbeseite reagierte und demzufolge auch der einzige, der das Manuskript bekommen hat. Allerdings hat es noch ein Jahr gedauert, bis sie sich durchgerungen hatten, einen völlig unbekannten Autor mit einem derart extravaganten Text zu publizieren. Sie hatten inzwischen drei Gutachten in Auftrag gegeben, die alle begeistert waren.
In diesem Jahr hatte ich an einem Drehbuch geschrieben und an weiteren »Deadline«-Projekten gearbeitet. Danach hatte ich Glück, weil der |Rowohlt|-Verlag die Taschenbuchrechte an „Starfish Rules“ gekauft hat, wovon ich ein weiteres Jahr leben konnte. Leider hatte das Taschenbuch ein entsetzliches Titelbild, das dem Verkauf nicht gerade förderlich war.
_AC:_
Lass uns über das neue Buch reden. „Das Paradies der Schwerter“ ist dein erster Fantasy-Roman …
_Meißner:_
Der erste veröffentlichte …
_AC:_
Wie meinst du das?
_Meißner:_
Ich habe mit Fantasy angefangen. Ich habe zwischen meinem 18. und 22. Lebensjahr ein Buch verfasst, das, wäre es fertig geworden, ungefähr 2000 Seiten umfasst hätte. Ich habe allerdings nach rund 400 Seiten aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass es einfach zu lange dauert, wenn ich für die ersten 400 Seiten schon vier Jahre gebraucht habe. Ich dachte mir, ich könnte noch weitere 16 Jahre an diesem einen Buch arbeiten – oder ich beginne lieber kleinere, überschaubarere Projekte. An „Starfish Rules“ habe ich allerdings auch vier Jahre gearbeitet. Jedenfalls habe ich mir damals mit den 400 Fantasy-Seiten einen guten Teil des Handwerks des belletristischen Schreibens selbst beigebracht.
_AC:_
Woher kam dein Interesse am Fantasy-Genre?
_Meißner:_
Eigentlich bin ich kein Fantasy-Fan oder –Kenner. Ich war in meiner Jugend von diesem eigenartigen Zeichentrick-Herr-der-Ringe-Film mehr beeindruckt als von Tolkiens Roman. Beim Lesen von Fantasy-Literatur hatte ich immer das Gefühl, dass mir etwas fehlt, dass irgendetwas nicht stimmt. Vieles war sehr gestelzt, klischeebeladen oder zu weit weg. Mir fehlte immer irgendetwas, das ich bei anderen Literaturformen gefunden habe. Ich hatte eine eigene Vision davon, wie ich Fantasy anders darstellen würde: den reinen Eskapismus weglassen, die Geschichte grobkörniger gestalten. So ähnlich wie das Verhältnis zwischen einem klassischen amerikanischen Edelwestern zu einem dreckigen Italowestern.
_AC:_
Michael Swanwick hat in einem aktuellen Interview gesagt, dass sich die meisten Fantasy-Autoren damit begnügen, die Staffage zu lernen – also Drachen, Elfen, Zwerge und so weiter – und dabei die Verankerung in der Realität vernachlässigen. Science-Fiction, auch schlechte Science-Fiction, hat diese Verankerung, weil sie eine, wenn auch manchmal minimale, Extrapolation unserer Welt ist. Momentan gibt es aber einen Trend, dass Fantasy realistischer und schmutziger wird. Ein Beispiel dafür ist China Miéville.
_Meißner:_
Ich habe irgendwann aufgehört Fantasy zu lesen, nachdem ich als Jugendlicher von der Ideenvielfalt der Romanheftserie „Mythor“ recht beeindruckt war. Aber ich kam mit dem Schreibstil nicht klar. Das Problem habe ich auch mit anderen Romanheften. Ich finde es schön, wie viele Ideen darin stecken, aber es ist leider so schlecht geschrieben. Da ich nicht weitergelesen habe, ist mir vielleicht auch einiges entgangen. Ich habe noch nie einen Jack Vance oder Fritz Leiber gelesen, Moorcock habe ich mir erst letztes Jahr mal angeschaut. Ich hatte immer den Eindruck, dass alle Fantasy daraus besteht, dass ein böser, dunkler Fürst das Land bedroht und kleinwüchsige Wesen oder Elfen oder Drachenreiter sich verbünden müssen, um diesen bösen Fürsten zu bekämpfen. Ich sah nirgendwo ein Gegenbeispiel. Ich dachte mir immer, dass es so nicht sein dürfte, denn das wäre ja so, als würde jeder klassische Abenteuerroman nur von Musketieren handeln. Aber ich bin wirklich kein Experte für Fantasy. Ich bin sozusagen aus Enttäuschung keiner geworden.
_AC:_
Was war der Anstoß für „Das Paradies der Schwerter“?
_Meißner:_
Da gab es mindestens vier Anstöße. Die brauchte ich auch, sonst hätte ich mich nicht daran gesetzt. Ich wusste von Anfang an, dass es drei Jahre dauern würde, das Buch zu schreiben – 36 Kapitel zu je einem Monat ergibt drei Jahre. Eine der Grundideen für „Paradies der Schwerter“ war, die Allwissenheit und Allmacht des Autors aus der Hand zu geben und eine Handlung zu entwickeln, die vom Zufall bestimmt werden kann, ohne dass das Handlungsgerüst aus dem Ruder läuft. Ich brauchte ein mathematisches Grundsystem, und dafür bot sich ein Turnier an. Ich wurde zum Reporter eines Geschehens, das ich selber nur in Gang gebracht habe, das dann aber aus kinetischer Energie selbst anfing zu rollen und immer schneller wurde. Das erklärt aber nicht, warum es ein Fantasy-Roman geworden ist.
Da ich mit Fantasy angefangen hatte zu schreiben, wollte ich irgendwann zu diesem Format zurückkehren, wenn sich die Gelegenheit bot. Die dritte Idee war, dass ich ein Buch mit vielen Protagonisten schreiben wollte, von denen man nicht weiß, welcher der wichtigste ist. Es sollten mindestens zehn sein – im Buch waren es dann sogar sechzehn –, die die Postmoderne in sich tragen; die auch aus Kulturkreisen stammen, die man eindeutig unserer Welt zuordnen kann und die in eine mittelalterliche Fantasy-Welt vielleicht gar nicht reinpassen. Die aus einem Italowestern, einem Samuraifilm oder einem Blaxploitation-Movie stammen könnten und die ich in dieses Buch hineinwerfen konnte, damit es ein phantastischer Schmelztiegel aus unterschiedlichen Storys und Beweggründen wird. Der vierte Ansatz war, dass ich mit sechzehn Protagonisten unterschiedliche Stilistiken und Blickpunkte anwenden konnte. Ich wollte die Geschichte nicht »von oben« betrachten, sondern für jede Perspektive eine eigene Deutungsweise schaffen. Es sollten Figuren sein, an denen man sich reiben kann.
_AC:_
Du sagtest, dass das Buch auf dem Zufall basiert. Wie ist das gemeint?
_Meißner:_
Ich habe die sechzehn Protagonisten entworfen, habe ihnen nach Rollenspielregeln bestimmte Körperwerte zugeordnet – also Geschicklichkeit, Attacke- und Paradefähigkeiten, Rüstungen – und habe die Kampfbegegnungen ausgewürfelt. Es war also nicht vorher festgelegt, wer gewinnt. Ich habe auch die Paarungen der Kämpfe nicht festgelegt, das ist sehr wichtig für das Buch. Ich habe sie stattdessen ausgelost und live, während ich die Lose aus dem Holztopf gezogen habe, geschildert, wer gegen wen antritt. _[Achtung: In den nächsten Sätzen werden einige Handlungswendungen verraten! Bitte erst „Das Paradies der Schwerter“ lesen!]_ Das ist fast noch wichtiger als die Kampfwerte, weil es bestimmte Konstellationen gibt, in denen zum Beispiel einer, der mit die besten Werte hat, der Degenfechter Cyril Brécard DeVlame, schon sehr großes Pech haben musste, gegen einen der beiden Gegner gelost zu werden, die eine dermaßen starke Rüstung tragen, dass er sie mit seinem Degen kaum verwunden kann. Genau das hat aber das Los entschieden. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit hätte DeVlame das ganze Turnier gewinnen können, das Los hat aber entschieden, dass er Pech hat und gleich in der ersten Runde ausscheidet. Ich war sehr begeistert darüber, wie die Lose mitgespielt haben, und dass sie mir auch einige zu klischeehafte Situationen erspart haben – zum Beispiel, dass die beiden Brüder gegeneinander antreten. _[Entwarnung!]_ Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass der Zufall ein besserer Autor ist als ich. Es war spannend, damit umzugehen und den Zufall ins Schreiben einzubinden. Oder auch Situationen umzubiegen, die zunächst sinnlos erscheinen. Die Sinnlosigkeit hat auch viel mit dem wirklichen Leben zu tun. Es endet eine Spannungskurve, die man aufgebaut hat, plötzlich ganz abrupt, wie im wirklichen Leben.
_AC:_
Gab es eine Situation, in der du versucht warst zu mogeln?
_Meißner:_
Glücklicherweise überhaupt nicht. Ich hätte auch auf keinen Fall gemogelt. Ich hatte auch meine Freunde aus dem |Deadline Project| als Kontrollinstanz, die auch alle Rollenspieler sind. Der Produktionsprozess war ganz offen, ich habe ihnen meine Würfeltabellen mitgegeben. Es gab ein paar Situationen, von denen ich gehofft habe, dass sie nicht passieren, hätte sie aber als Herausforderung an den Autor begriffen.
_AC:_
Die Kapitel des Buches, insbesondere die Kämpfe, sind unterschiedlich lang. Liegt es daran, dass du an einigen besonderen Spaß hattest?
_Meißner:_
Es hängt direkt mit dem Würfeln zusammen, dass einige Kämpfe schon sehr schnell vorbei waren. Andere Kämpfe zogen sich über mehrere Seiten als Würfel-Zahlentabellen hin, weil beide Kontrahenten jede Attacke des Gegners parierten. Dadurch wird das Kapitel automatisch sehr viel länger. Aber ich habe mir auch die Freiheit genommen, mich vom ganz konkreten Kampfgeschehen zu lösen. Bei der Auslosung habe ich gleichzeitig geschrieben, bei den Kämpfen habe ich nicht während des Würfelns geschrieben. Ich habe also nicht jede einzelne Attacke, die ausgewürfelt war, genau eins zu eins wiedergegeben, sondern habe mir den Kampf erst einmal ganz angeschaut und habe mir dann überlegt, was die Essenz des Kampfes ist. Oftmals habe ich dann auch bereits im ersten Satz der Schilderung eines Kampfes auf die Essenz hingearbeitet. Wenn ich weiß, wer am Ende stirbt, dann habe ich den Kenntnisstand, dass ich diese Figur tatsächlich zum letzten Mal beschreibe und ich hinterher nichts bedauern muss.
_AC:_
Du hättest aber hinterher noch etwas ändern können.
_Meißner:_
Das mache ich nie. Das habe ich beim |Deadline Project| gelernt. Dadurch, dass man an jedem Monatsende die Geschichte sozusagen |in progress| publiziert, also an die Freunde schickt, kann man nichts mehr ändern. Ich habe meine Freunde als Kontrollleser und bete, dass sie keine Fehler finden.
_AC:_
Dadurch setzt du dich als Autor aber auch sehr unter Stress.
_Meißner:_
Ich weiß nicht, wo mehr Stress liegt. Einer der vier Autoren im |Deadline Project| hat nach einem halben Jahr aufgehört zu schreiben, weil er immer wieder am ersten Kapitel Änderungen vorgenommen hat und irgendwann gar nicht mehr dazu kam weiterzuschreiben. Leider ist er uns als Schriftsteller dadurch verloren gegangen, obwohl er tolle Ideen hatte. Diesen Stress der nachträglichen Änderung habe ich mir nie gemacht. Ich schreibe ein Kapitel, und in den letzten Tagen eines Monats überarbeite ich es noch einmal richtig, und dann ist es halt fertig. Ich muss dann nicht noch einmal rückwärts durch das ganze Buch gehen.
_AC:_
Aber du arbeitest sehr konzentriert und in sehr kleinen Einheiten.
_Meißner:_
Ja, ich arbeite konzentriert. Das hängt damit zusammen.
_AC:_
Woher weißt du so viel über Waffen und Kampftechniken?
_Meißner:_
Vieles davon habe ich mir durch unterschiedliche Regelwerke der Fantasyrollenspiele in der Theorie angeeignet. Rollenspiele haben den schönen Aspekt, dass dort versucht wird, Traditionen oder bestimmte Bereiche des Daseins zu simulieren. Es gibt Experten, die dicke Bücher verfassen, wie man bestimmte japanische Waffen oder bestimmte Kampftechniken in Würfelergebnisse übersetzen kann. Diese Arbeit kann ich mir ersparen.
_AC:_
Hast du für das Buch speziell recherchiert?
_Meißner:_
Ja natürlich, ich habe mir aus vielen verschiedenen Quellen Inspirationen für meine Figuren geholt, habe aber auch vieles selbst entwickelt. Ich habe ein inzwischen veraltetes Regelwerk von |Das Schwarze Auge| als Grundsystem benutzt, allerdings dann modifiziert. Ich habe da eine gewisse Erfahrung, mir Regeln auszudenken, weil ich seit meinem sechzehnten Lebensjahr Spielleiter von Rollenspielkampagnen bin.
_AC:_
Du sagtest, dass das Buch in einer Art Mittelalter spielt.
_Meißner:_
Eher auf einer mittelalterlichen Entwicklungsstufe. Das kann natürlich auch zu einer postapokalyptischen Zeit sein, das habe ich gar nicht festgelegt. Es gibt viele Endzeitgeschichten, die in eine Art Mittelalter zurückfallen. Ich wollte für den Roman nicht festlegen, ob er in der Vergangenheit oder in der Zukunft spielt.
_AC:_
In einigen Rezensionen zu „Das Paradies der Schwerter“ wurde bemängelt, dass der Roman Anachronismen enthält. Die waren dann also Absicht?
_Meißner:_
Das sind keine Fehler, die mir unterlaufen sind, sondern eher Andeutungen, dass das Ganze auch in der Zukunft spielen könnte. Es gibt zum Beispiel den Begriff »an der Nadel hängen«, den man aus dem Mittelalter nicht kennt. Auch Wörter wie »Logistik« kommen vor. Ein solches Mittelalter, wie im Buch beschrieben, hat es ohnehin definitiv nie gegeben.
_AC:_
Welcher der Kämpfer war dein Favorit?
_Meißner:_
Einen Favoriten durfte ich nicht haben. Es wäre fatal gewesen, wenn ich einen gehabt hätte. Der Sinn des Spieles war, genau das zu vermeiden. Normalerweise, in anderen Büchern, habe ich immer einen Protagonisten, aber selbst da sind sie nicht immer meine Favoriten, zum Beispiel in „Starfish Rules“. Anders bei „Hiobs Spiel“; darin ist es offensichtlich, dass ich an Hiob klebe und jede seiner Bewegungen mit einer großen Faszination, manchmal auch mit Abscheu – aber das ist ja etwas Ähnliches – verfolge. Bei „Paradies der Schwerter“ wollte ich genau das nicht.
_AC:_
Auf der Impressumseite steht die Vorbemerkung: »|Paradies der Schwerter| ist der Roman, der in Tobias O. Meißners Neverwake-Zukunft unter dem Titel |Rakuen| veröffentlicht und berühmt wird (siehe Tobias O. Meißner |Neverwake|, Eichborn Berlin, 2001).«
_Meißner:_
Ja. Innerhalb der Neverwake-Chronologie wurde das Buch von einem Autor verfasst, dessen Akronym »Ein Robot.Messias« lautet. Wenn man die Buchstaben von »Ein Robot.Messias« umstellt, kommt dabei Tobias O. Meissner raus. Das muss man dann aber wirklich in „Neverwake“ nachlesen. Es ist nämlich so: Wenn man das Gesamtwerk verstehen will, muss man alles gelesen haben. Auch das unveröffentlichte …
_AC:_
War die Vorbemerkung nur ein Spaß, oder spielt sie für dich eine wichtige Rolle?
_Meißner:_
Es ist insofern wichtig, dass ich zuerst „Rakuen“ geschrieben habe. „Das Paradies der Schwerter“ hieß nämlich ursprünglich „Rakuen“, wurde dann aber aus vertriebstechnischen Gründen umbenannt, weil schon die Teilnehmer der Vertreterkonferenz des Verlages das Wort „Rakuen“ auf die absurdeste Art und Weise verdreht haben, so dass schnell klar wurde, dass im Buchhandel irgendetwas ganz anderes ankommt und es nie gelingen wird, dieses Buch jemandem zu vermitteln. Deswegen habe ich selber als Alternativvorschlag den Titel „Das Paradies der Schwerter“ eingebracht. Also, ich habe zuerst „Rakuen“ geschrieben, und danach erst „Neverwake“, auch wenn die Romane in anderer Reihenfolge erschienen sind. Ich konnte in Neverwake nur deshalb behaupten, dass es dieses Buch gibt, weil ich es schon geschrieben hatte. Daher also die Vorbemerkung.
_AC:_
Du hast so etwas wie einen Schutzengel, und der heißt Wolfgang Ferchl. Als |Rotbuch| „Starfish Rules“ gekauft hat, war er dort als Lektor beschäftigt und hat dich dann zum |Eichborn|-Verlag mitgenommen, wo er Programmchef war. Inzwischen ist er Verlagsleiter bei |Piper|. Welche Bücher sind in diesen drei Verlagen denn noch erschienen?
_Meißner:_
Beim |Rotbuch|-Verlag gab es „Starfish Rules“ und danach „HalbEngel“, ein Roman über Populärkultur und Rockmusik. Bei |Eichborn| hatte ich einen Vertrag über drei Projekte, zuerst „Todestag“, das ich damals noch gar nicht geschrieben hatte. „Todestag“ wollte ich sehr schnell schreiben, es durfte nur drei Monate dauern und hat sich direkt auf die Gegenwartspolitik bezogen. Das zweite Projekt bei |Eichborn| war „Neverwake“. Es sollte eigentlich eine Trilogie werden, aber daraus wird wohl nichts, weil es leider das kommerziell unverkäuflichste meiner Bücher geworden ist. Und zu meiner großen Überraschung war das dritte „Hiobs Spiel“. Keiner hat das Buch jemals verstanden, keiner mochte das Buch, aber Wolfgang Ferchl, mein »Schutzengel«, sagte, es gibt Projekte, die muss man als Verleger einfach bringen. Leider verkauften sich die drei Bücher nicht gar so gut. Wolfgang Hörner, der mich bei |Eichborn.Berlin| von Ferchl übernommen hatte, hat „Das Paradies der Schwerter“ gesehen, als es noch „Rakuen“ hieß. Er war davon überzeugt, und tatsächlich läuft es jetzt besser als alle meine anderen Bücher. Jetzt habe ich ein Angebot von |Piper|, und ich habe das Konzept für einen Fantasy-Zyklus aus meiner Schublade geholt, der zwölf Bände umfassen soll. Ich kann nur hoffen, dass |Piper| wirklich alle Bände bringen wird. Das hängt natürlich vom Erfolg ab.
_AC:_
„Hiobs Spiel“ und auch „Starfish Rules“ haben eine sehr extravagante Typographie. War das deine Idee?
_Meißner:_
Das ist nicht so einfach zu beantworten. In meinem Originalmanuskript ist so etwas schon angedeutet, mit unterschiedlichen Schrifttypen. Dass aber für jedes Kapitel eine eigene Kapitelüberschrift und jeweils eine andere Textgestaltung designt wurde, das hatte ich gar nicht zu träumen gewagt. Ich fand es aber toll. Und sie haben meinen Hinweis befolgt, dass jeder Handlungsstrang in „Starfish Rules“ immer die gleiche Schrifttype hat, was Struktur in das Chaos des Buches bringt. Bei „Hiobs Spiel“ sieht mein Manuskript relativ einfach aus, und ich finde es großartig, was der Designer daraus gemacht hat.
_AC:_
Hattest du Einfluss auf die endgültige Gestaltung?
_Meißner:_
Überhaupt nicht, ich habe nur die fertigen Druckfahnen bekommen, um sie abzusegnen.
_AC:_
„Hiobs Spiel“ ist zum Teil unglaublich brutal. Hat der Verlag darauf reagiert oder etwas verändern wollen?
_Meißner:_
Die Brutalität war nicht das Problem, sondern vielmehr die stilistischen Experimente, die ich in dem Buch gemacht habe; Sätze, die aus ihrem grammatischen Zusammenhang geschleudert wurden und vieles andere, das zunächst für mich ohne Beispiel war. Ich habe versucht, neuschöpferisch mit Sprache umzugehen und einen gewissen schamanistischen Ansatz zu finden. Wenn man ein Buch über Magie schreibt, dann sollte man auch versuchen, wie ein Schamane etwas Magisches in das Buch hineinzustecken. Und das geht bei einem Buch nun mal nur mit Sprache. Ich hatte also irrwitzige Sätze gebaut, die vom Lektorat hinterher herausgenommen wurden, weil sie angeblich unverständlich gewesen wären. Ich finde, dass der schamanistische Charakter des Buches unter dem Lektorat sehr gelitten hat. Andererseits kann man aber auch nicht deutlich genug betonen, dass |Eichborn| den Mut hatte, ein solches Buch überhaupt zu bringen.
_AC:_
Du sagtest, dass das Buch niemand verstanden hat. Ist es dir egal, dass es keiner versteht?
_Meißner:_
Ich glaube, dass ich selber nicht weiß, wie man es richtig verstehen sollte. Es besteht aus sehr vielen Einzelteilen, die viele Bedeutungen haben – zum einen für mich, aber auch historisch bedingt, wofür ich intensiv recherchiert habe. Die meisten Rezensionen wurden dem aber nicht gerecht. In „Starfish Rules“ habe ich ungefähr das Achtfache an Zeit investiert, das ich für meine Magisterarbeit an der Universität benötigt habe. Insofern wäre „Starfish Rules“ rein rechnerisch ein Buch, mit dem man sich acht Universitätsgrade holen könnte. Es steckt nichts Zufälliges drin, auch wenn es auf den allerersten Blick so aussehen mag.
_AC:_
Was ist dein Antrieb, dich jeden Tag an den Schreibtisch zu setzen und weiterzuarbeiten? Ist es der Spaß am Schreiben, oder eher, dass du etwas loswerden musst, das in dir lauert?
_Meißner:_
Der Hauptantrieb ist der Spaß und die Möglichkeit, Kreativität zu verarbeiten, ohne dass einem jemand reinredet. Das ist ganz anders als zum Beispiel beim Filmemachen, wo man auf viel zu viele Leute Rücksicht nehmen muss.
_AC:_
Obwohl du eigentlich schon immer Genreliteratur geschrieben hast – Science-Fiction, Fantasy, Horror – wurdest du vom Fandom nie wahrgenommen. Das ging allerdings auch anderen Autoren so, wie zum Beispiel Dietmar Dath oder Kai Meyer. Liegt das an deinem Anspruch, weil du »literarische« Bücher schreibst?
_Meißner:_
Das mag sein. Das Spannende für mich an meinem neuen Projekt für |Piper| ist, dass ich meine Stilistik sehr weit runterschraube und keine Sprachexperimente mehr mache. Ich möchte, dass das Buch ganz leicht zu lesen ist. Aber gleichzeitig versuche ich, eine extrem komplexe Geschichte aufzubauen, deren Komplexität man im ersten Band noch gar nicht unbedingt bemerkt. Aber ich habe ja das Gesamtprojekt im Kopf, ich weiß, was ich in den zwölf Bänden alles machen werde. Ich kenne bisher nichts Vergleichbares, sonst würde ich es nicht umsetzen wollen. Wenn ein anderer Fantasy-Autor so etwas schon gemacht hätte, würde ich dafür nicht zwölf Jahre meines Lebens opfern. Ich bin ja kein Masochist.
_AC:_
Fürchtest du dich nicht vor dem Berg an Arbeit? Oder dass du zwischendurch das Interesse an der Geschichte verlieren könntest?
_Meißner:_
Gar nicht. Die Herausforderung spornt mich eher an. Der Gedanke, einen so umfangreichen Zyklus zu schreiben, ist etwas Neues, das ich noch nie versucht habe.
_AC:_
Wobei du das Glück hast, dass du den Zyklus in einem Genre schreibst, in dem das möglich ist. Obwohl ich bei den meisten Zyklen nach dem ersten Band keine Lust mehr habe weiterzulesen.
_Meißner:_
Das geht mir genauso, denn ich habe das Gefühl, dass die meisten Fantasyautoren kein Gesamtkonzept haben, sondern einfach nur immer weiter schreiben und sich zu viel wiederholt.
_AC:_
Themawechsel. Welche Rolle spielen Realität und Virtualität für dich?
_Meißner:_
Realität ist ja auch immer virtuell. Ich glaube nicht, dass es eine einzige Wahrheit gibt. Deshalb ist es schwer, Realität zu fassen. Ich bin ein Verfechter der multiplen Perspektiven, und das merkt man meinen Büchern auch an. Es gibt immer sehr viele Figuren, die eine völlig unterschiedliche Sichtweise auf ein und dasselbe Geschehen haben.
Virtualität finde ich leichter zu beschreiben als Realität. Realität ist ein so unüberschaubarer Raum, dass man ihn nicht fassen kann, während man in der Virtualität ein Kontinuum schaffen kann, das vollständig begreifbar ist, weil man es nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten entwickelt hat. Das fasziniert mich auch immer wieder an Computerspielen, denn man kann ein Spiel quasi zu hundert Prozent durchqueren und lösen, was in der wirklichen Welt niemals möglich ist. Die Virtualität hält für einen Geschichtenerzähler immer Möglichkeiten bereit, irgendwo im hintersten Winkel etwas zu verbergen, das vom Leser aber trotzdem gefunden wird.
Ich habe früher sehr viele Computerspiele gespielt, und dann eine Pause von fast zehn Jahren gemacht, um mehr Zeit zum Schreiben zu haben. Seit es die PlayStations gibt, spiele ich wieder mehr, zum einen zur Entspannung, aber auch zum kreativen Input. Es ist manchmal eine Art Meditation, durch diese virtuellen Räume zu gleiten oder zu laufen. Oder auch Rennspiele zu spielen, in denen man irgendwann eine Geschwindigkeit erreicht, bei der man nicht mehr nachdenken darf, sondern intuitiv reagiert. All das fasziniert mich sehr. Irgendwann will ich ein Buch schreiben, das man nur noch intuitiv erfassen kann und gar nicht mehr über den Intellekt, aber dafür bin ich wahrscheinlich noch nicht gut genug.
_AC:_
Wir sind sehr gespannt auf deine nächsten Bücher. Vielen Dank für das Gespräch!
|Das Gespräch führten _Hardy Kettlitz_ und _Hannes Riffel_ am 5. Juli 2004 für das Magazin [ALIEN CONTACT.]http://www.epilog.de/Magazin/ Die Veröffentlichung bei |Buchwurm.info| erfolgt mit freundlicher Genehmigung der AC-Redaktion.|
_[Das Paradies der Schwerter]http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3821807237/powermetalde-21
von Tobias O. Meißner
|Eichborn.Berlin|
Februar 2004
gebundene Ausgabe
ISBN: 3821807237_
Heinlein, Robert A. – Zwischen den Planeten
Robert Anson Heinlein (1907-1988) hat zweifellos eine ganze Menge bedeutenderer und unterhaltsamerer Romane geschrieben als „Zwischen den Planeten“. Die Karriere des Autors begann 1939 mit der Veröffentlichung einer Kurzgeschichte in |Astounding Science Fiction|, herausgegeben von John W. Campbell, der viele weitere Storys folgen sollten, ehe ihm der Absprung aus den Pulps hin zum viel beachteten Romanautor gelang, der in den siebziger und achtziger Jahren regelmäßig in den amerikanischen Bestsellerlisten zu finden war. Neben zahlreichen Science-Fiction-Romanen für ein erwachsenes Publikum, wie den allesamt mit dem |Hugo Award| ausgezeichneten „Double Star“ (1956), „Starship Troopers“ (1959), „Stranger in a Strange Land“ (1961) und „The Moon is a harsh Mistress“ (1966) veröffentlichte Heinlein zwischen 1947 und 1963 eine Reihe von Romanen für Jugendliche, zu denen – wenngleich eindeutig zu den qualitativ schwächeren – auch „Between the Planets“ zu rechnen ist.
Don Harvey erhält überraschend ein Telegramm seiner Eltern. Drei Monate vor dem Ende seiner schulischen Ausbildung wird er darin aufgefordert, die Erde zu verlassen und zu seinen Eltern auf den Mars zu kommen. Dieser ist ebenso wie die Venus von den Menschen kolonisiert. Noch bevor er sein Schiff besteigen kann, lernt Don einen der Eingeborenen der Venus, Saurier-ähnliche Wesen, die der Einfachheit halber als „Drachen“ bezeichnet werden, namens „Sir Isaac Newton“ kennen. Aus dem Flug zum Mars wird nichts, da kurz nach dem Start auf der Venus eine Rebellion gegen die irdische Regierung ausbricht: Das Schiff wird abgefangen, Don selbst wird zur Venus gebracht. Eigentlich hält er sich in diesem Konflikt für neutral, sieht er sich doch selbst als Bürger des ganzen Sonnensystems, da sein Vater Erdgeborener ist, seine Mutter eine Venus-Kolonistin der zweiten Generation und er auf einem Raumschiff geboren wurde. Doch einem vermeintlich billigen Plastikring, den er bei sich trägt, scheint eine größere Bedeutung beizukommen, als Don ahnt, was ihn in den Mittelpunkt der Auseinandersetzungen rückt.
Der mageren Handlung zum Trotz liest sich der Roman auch über fünfzig Jahre nach seiner Erstveröffentlichung noch recht flüssig, was für Heinleins erzählerische Begabung spricht, auch einem mäßig interessanten Stoff noch halbwegs unterhaltsame Seiten abzugewinnen. Damit hat es sich aber weitgehend: Der naive und gleichzeitig völlig von sich eingenommene Protagonist Don stößt dem Leser ebenso sauer auf wie die verschenkte Möglichkeit, die Urzivilisation der Venus detaillierter und nicht gar so oberflächlich zu schildern, wie es hier geschieht. Von der wenig prickelnden, sehr schwarz-weiß und amerikanisch gemalten Kolonisten-Rebellion gegen die obligatorische irdische Diktatur ganz zu schweigen. So bleibt „Zwischen den Planeten“ unterm Strich einer der schwächsten Romane Heinleins, den man ganz sicher nicht unbedingt gelesen haben muss.
Heinleins Jugendbücher in chronologischer Reihenfolge:
1947: Rocket Ship Galileo (dt. Reiseziel: Mond; BL 24293)
1948: Space Cadet (dt. Weltraumkadetten; BL 23220)
1949: The red Planet (dt. Der rote Planet; BL 23214)
1950: Farmer in the Sky (dt. Farmer im All; BL 24286)
1951: Between Planets (dt. Zwischen den Planeten, BL 23263)
1952: The rolling Stones (dt. Die Tramps von Luna; BL 24311)
1953: Starman Jones (dt. Gestrandet im Sternenreich; BL 24220)
1954: Star Beast (dt. Die Sternenbestie; BL 24163)
1955: Tunnel in the Sky (dt. Tunnel zu den Sternen; BL 23201)
1956: Time for the Stars (dt. Von Stern zu Stern; BL 23191)
1957: Citizen of the Galaxy (dt. Bewohner der Milchstraße; BL 23167)
1958: Have Space Suit – will travel (dt. Invasion der Wurmgesichter; noch nicht bei BL, zuletzt 1982 als Heyne TB 06/3862)
1963: Podkayne of Mars (dt. Bürgerin des Mars, noch nicht bei BL, zuletzt 1980/82 als Goldmann TB 23354)
(Zusammenstellung von Gunther Barnewald)
_Armin Rößler_ © 2004
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung unseres Partnermagazins [buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de/ veröffentlicht.|
Iris Johansen – Das verlorene Gesicht
Eve Duncan ist Spezialistin für computersimulierte Alterungsprozesse im „Nationalen Zentrum für verschwundene und missbrauchte Kinder“ in Arlington, US-Staat Virginia. Ihre Fachkenntnisse ermöglichen es, über einem Totenschädel das verschwundene Gesicht eines Opfers quasi neu erstehen zu lassen. Diese Mischung aus Wissenschaft und Kunst wird von der Justiz und den Polizeibehörden oft in Anspruch genommen. Sie hat sich ohnehin in einen Workaholic verwandelt, nachdem ihre kleine Tochter einem geistesgestörten Kindesmörder zum Opfer fiel.
John Logan ist ein amerikanischer Selfmade-Millionär. Er verdient viel Geld in der Hardware-Branche, nutzt aber sein Vermögen und seinen Einfluss auch, um in der Politik seines Landes mitzumischen. Dabei ist er einem Komplott auf die Spur gekommen, das ganz oben in der US-Hierarchie anzusiedeln ist und die Person des Präsidenten selbst in ein sehr schiefes Licht rückt. Wer regiert die letzte Großmacht dieses Planeten wirklich? Iris Johansen – Das verlorene Gesicht weiterlesen
Rollins, James – Sub Terra
McMurdo Base, eine Forschungsstation der US-Navy, auf Ron Island und unweit des Mount Erebus an der Antarktisküste – oder eigentlich darunter, ganze drei Kilometer sogar. Dort wurde ein gigantisches System unterirdischer Kavernen entdeckt; allein die Haupthöhle weist einen Durchmesser von acht Kilometern auf. Aber es kommt noch toller: Die Spähtrupps der Navy stießen auf Artefakte, die zwar primitiv, aber eindeutig einer intelligenten Zivilisation zuzuordnen sind. Datiert wurden sie auf ein stolzes Alter von 5,2 Mio. Jahre, und nun wird es unheimlich, weil sich der Mensch erst eine Million Jahre später zu entwickeln begann.
Da es in der unterirdischen Düsternis nichts gibt, auf das sich schießen ließe, ist nun der Zeitpunkt gekommen, wissenschaftliche Hilfe von außen anzufordern. Das chronische Misstrauen der Militärs – vielleicht findet sich da unten ja etwas, mit dem sich die vielen Feinde Amerikas noch besser in Schach halten lassen – bringt den Geologen und Vulkanologen Dr. Andrew Blakely ins Spiel. Er arbeitet ohnehin schon unter McMurdo für die Navy – da kann er wohl auch eine Expedition planen und mit anerkannten Fachleuten besetzen.
Professor Ashley Carter, Paläoanthropologin und Archäologin, gräbt gerade in Neumexiko alte Indianersiedlungen aus, als sie der Ruf aus der Antarktis erreicht. Sie sagt zu, bringt aber ihren elfjährigen Sohn Jason mit. Der Australier Benjamin Brust, Ex-Soldat und Höhlenforscher, organisiert den eher Körpereinsatz erfordernden Part der Kletterei; das Team wird komplettiert durch noch einen weiblichen Professor – die Biologin Linda Furstenberg aus Kanada -, Khalid Najmon, Geologe ägyptischer Herkunft, sowie Major Dennis Michaelson und zwei kernige Marines, die offiziell für die Logistik des Unternehmens, aber außerdem für den Schutz der Wissenschaftler zuständig sind. Denn der recht zwielichtige Blakely hat seinen Forschern eine kleine, aber wichtige Tatsache verschwiegen: Sie sind nicht das erste Team, das sich in die Tiefe wagt. Ihre Vorgänger sind allerdings spurlos verschwunden – und mit ihnen immer wieder Soldaten, die sich ein Stück zu weit ins Unbekannte gewagt hatten. Die Menschen sind ganz sicher nicht allein hier |sub terra|, und sie werden keineswegs gastfreundlich empfangen. Als ob dies nicht genug der Gefahr sei, entpuppt sich dann auch noch einer der Forscher als fanatischer Terrorist, der sicherstellen soll, dass sich die verhassten USA nicht auch noch unter der Erdoberfläche breit machen …
Dreimal geraten, liebe Leser, wer das wohl sein könnte aus unserer Runde! Nun ja, einmal wird wohl reichen (dazu unten mehr) – und damit wissen wir schon, wessen Geistes (Findel-)Kind der Roman „Sub Terra“ ist. Der Doktor und das liebe Leservieh … James Rollins alias James Clemens, geboren 1961 in Chicago, Illinois, als James Czajkowski, Doktor der Veterinärmedizin, vulgo Tierarzt, im kalifornischen Sacramento, dazu Reisender und Geschichtenerzähler – ein Lebenslauf, wie ihn die US-Amerikaner lieben, suggeriert er doch Weltläufigkeit und dass in diesem Land jedermann berühmt und reich werden, wenn er (oder sie) sich nur recht eifrig darum bemüht.
Die Qualität dessen, was dabei das Licht der Welt erblickt, ist von sekundärer Bedeutung. In unserem Fall ist das einleuchtend, wenn wir Dr. Czajkowski lauschen, wie er in Erinnerungen schwelgt an die schöne Zeit, als er mit der Linken hustende Dobermänner kurierte und mit der Rechten „Subterranean“, seinen Romanerstling, niederschrieb: drei Seiten an jedem schönen Tag, den der Herr werden ließ, nicht mehr, nicht weniger, bis das Werk getan. (Diese und weitere Informationen zur Person und zum Werk des James Rollins liefert die Website www.jamesrollins.com, die sich allerdings mit demselben Adjektiv wie das schriftstellerische Potenzial ihres Herrn beschreiben lässt: dürftig.)
Diese ungewöhnliche Art der Schriftstellerei bedingt natürlich gewisse Einschränkungen. Um den Tagesdurchschnitt von drei Seiten nicht zu gefährden, gilt es beispielsweise auf jeglichen Ehrgeiz zu verzichten, sein Werk um den Faktor Originalität zu bereichern. Wozu denn auch, steckt doch die Welt des Abenteuerthrillers voller erprobter und bewährter Szenen und Figuren, die förmlich danach schreien, dass sich ein fix und ökonomisch arbeitender Schreiber(ling) ihrer bedient.
Oder wollen wir männlichen Leser etwa behaupten, wir verfolgten nicht gern – in allen Ehren selbstverständlich – die Abenteuer der 2.004ten schönen Frau, die auf den Spuren Lara Crofts die Unterwelt der Antarktis erobert? Wir müssen uns da keine Vorwürfe machen, ist diese Ashley Carter doch nicht nur hübsch, sondern auch schlau und eine gute Mutter obendrein, so dass sie politisch völlig korrekt bewundert werden darf. Sicher, das Treiben ihres Sprösslings – einer Nerven sägenden Heimsuchung, die das Disney-Studio geschickt haben könnte – lässt insgeheim den Wunsch aufkommen, ein gütiges Schicksal – vielleicht in Gestalt eines hungrigen Höhlenbären? – möge ihn möglichst rasch aus dem Geschehen reißen, aber schließlich muss Autor Rollins schon eine zukünftige Verfilmung bedenken, und da ist eine Identifikationsfigur für die eintrittskartenkaufende US-Teenagerschaft unbedingt erforderlich.
Aber keine Sorge: Guter, altmodischer Abenteuer-Machismo manifestiert sich in der Figur des Australiers Benjamin Brust, der eine Art Stalaktite Dundee gibt und noch in lebensbedrohlicher Notlage die Muße findet, die unbemannte Ashley ordentlich zu bebalzen (was sich auch die moderne Frau des 21. Jahrhunderts insgeheim ganz gern gefallen lässt, wie Rollins mit einem Augenzwinkern deutlich macht). In Reserve hält sich Frau Nr. 2, Linda Furstenberg, der aber eher die Rolle der schwarzhaarigen Verderbnis zugedacht wurde, die ein übles Ende nimmt: In dieser Geschichte ist nur Platz für eine Heldin.
Klassisch auch die Schurkenrollen: Mit falschem Lächeln zieht Dr. Blakely – intrigant, egoistisch, ehrgeizig: kein vom Wissensdurst beseelter Forscher, sondern ein Politiker eben – feige hinter den Kulissen die Fäden. Fürs grobe Tücken vor Ort (Belügen & Bedrohen der Helden, Bestehlen & Umbringen der Eingeborenen, Versündigen gegen Mutter Erde etc.) ist Khalid Najmon zuständig, dessen Namen im Ohr des wachsamen Durchschnittsamerikaners verdächtig nach Ausland und Nahem Osten klingt. (Ägypten? Ist das nicht die Hauptstadt des Iran?)
Bleiben noch der stramme Major Michaelson und seine beiden Mannen, harter Kern in stählerner Schale, mutig und dringend erforderlich, um die gar zu sorglosen Wissenschaftler zu ihrem eigenen Besten vor den Gefahren der Finsternis zu schützen. Außerdem gilt es uramerikanische Interessen zu vertreten: Wo kämen wir denn dahin, wenn am Mittelpunkt der Erde ein anderes als das Sternenbanner wehte? Hei, da kommt patriotischer Stolz auf, wenn tapfere Marines den Polar-Morlocks tüchtig in die Ärsche treten! Ach, wenn das mit den Iranern (Libyern, Kubanern u. a. Strolchen) doch auch nur so einfach wäre!
Der Blick auf die Handlung zeigt indes, dass mit den oben beschriebenen Protagonisten genau die richtigen Personen „Sub Terra“ gegangen sind. Was in der Theorie paradox klingt, weiß Autor Rollins wunderbar zu realisieren: Geografisch geht es klaftertief hinab, während die Geschichte durchweg flach bleibt. Hier Jules Vernes wunderbare [„Reise zum Mittelpunkt der Erde“ 325 („Voyage au Centre de la Terre“, 1864) als Vorbild zu nennen, zeugt von einem gut ausgebildeten Selbstbewusstsein – oder kündet vom dreisten Versuch, den zögerlichen Buchladen-Besucher zwecks Kauf des Bandes zu überrumpeln. Parallelen gibt es in der Tat: Auch Vernes Forscher sind Papier gewordene Klischees. Allerdings fand ihre Reise vor fast anderthalb Jahrhunderten statt. Inzwischen hat sich in Sachen Figurenzeichnung und -entwicklung einiges getan – oder eben nicht, wie Rollins hier deutlich macht. Es reicht nicht, sich populärwissenschaftlich auf den aktuellen Stand zu bringen. Natürlich ist es richtig, dass es dieses Mal nicht mehr zum Mittelpunkt der Erde hinab geht, weil wohl heute selbst dem dümmsten Zeitgenossen klar ist, dass dieser einen glühenden, flüssigen und deshalb ziemlich unzugänglichen Kern bildet.
Ein bisschen Realität braucht auch ein Phantastik-Garn wie „Sub Terra“. Auch ein gewisser naiver Charme in Form und Inhalt schadet nicht in einem Genre, dessen Autoren kaum um den Nobelpreis für Literatur zu buhlen pflegen. Doch Rollins übertreibt es bzw. versucht erst gar nicht, Bekanntes wenigstens zu variieren, Das Ergebnis ist spannend dort, wo reine Aktion die Szene bestimmt. Rollins Darstellung einer exotischen Höhlenwelt tief unter der Erde hat ganz sicher ihre Reize. Doch sobald seine Protagonisten auf der Bildfläche erscheinen und womöglich auch noch den Mund aufmachen, ist der Zauber verflogen.
„Sub Terra“ ist ein Debütwerk und muss deshalb mit einer gewissen Nachsicht beurteilt werden. Allerdings lassen Rollins Nachfolgewerke nicht die geringste Tendenz erkennen, die oben beschriebenen Probleme in den Griff zu bekommen. Wie könnte dies auch geschehen, da es doch erklärtes Ziel des Verfassers ist, die lesende Welt mit mindestens einem Abenteuer/Mystery-Thriller und einem Fantasy-Roman – in Deutschland veröffentlicht Rollins als James Clemens die Serie „The Banned and the Banished“ – pro Jahr zu beglücken? Der selbst auferlegte Arbeitsdruck führt denn auch dazu, dass „Excavation“ (1999; dt. „Das Blut des Teufels“), „Deep Fathom“ (2000; dt. „Im Dreieck des Drachen“) und „Amazonia“ (2001, dt. „Operation Amazonas“) unter den bekannten Schwächen leiden.
Da „Sub Terra“ erfreulich preisgünstig erstanden werden kann, ist ein Kauf trotz der beschriebenen Mankos kein Fehler, wenn man einfach nur (irgendwie) und ohne jeden Tiefgang unterhalten werden möchte, was ja manchmal auch ganz angenehm ist.
Pelecanos, George P. – King Suckerman
Am Anfang drei Fragen: Gibt es wirklich einen Film, der „King Suckerman“ heißt? Spielt Sean Combs („P. Diddy“) darin eine Hauptrolle? Was hat dieser Krimi damit zu tun? Antworten kommen bald, zuvor noch einige Basis-Infos:
„King Suckerman“ ist 1997 als sechster Roman des amerikanischen Autors George P. Pelecanos erschienen und wurde 2000 als deutsche Übersetzung bei |Dumont| veröffentlicht (als |Dumont Noir|–Taschenbuch Nr. 16).
_George P. Pelecanos_
Wie der Name schon vermuten lässt, ist er griechischer Herkunft, allerdings in Washington DC geboren (1957) und dort auch aufgewachsen. Er lebt immer noch dort, heute indes mit Frau und drei Kindern in Silver Springs (formal Maryland, aber eigentlich ein Teil von Washington). In seiner Jugend hat er viel Basketball gespielt (mit 16 sogar in der Freizeitmannschaft, die die Stadtmeisterschaft gewann). Nur logisch, dass da fast jedes seiner Bücher auch ein Basketball-Nebenthema hat.
Als Krimi-Autor fühlt er sich (wie so häufig) von Hammet und Chandler angeregt, wichtigste Inspirationen waren ihm zu Beginn seiner Laufbahn allerdings James Crumley und Kem Nunns „Tapping the Source“. Von seinen Kollegen mag er besonders Michael Connelly und Dennis Lehane (beide wirklich sehr zu empfehlen).
Pelecanos ist nicht bloß Krimi-Schreiber. Er hat mal Schuhe verkauft, leitete eine kleine Ladenkette für Unterhaltungselektronik und später auch die Produktionsfirma Circle Films, die u. a. sämtliche der frühen Filme der Coen-Brüder produziert hat – „Blood Simple“, „Raising Arizona“, „Miller’s Crossing“ und „Barton Fink“. Pelecanos war es auch, der John Woo (u. a. „Face/Off“) nach Amerika holte. Heute verdient er sein Geld zu etwa gleichen Teilen mit Krimis und mit Fernsehen. Er veröffentlicht ungefähr ein Buch pro Jahr und ist Produzent der recht erfolgreichen TV-Serie „The Wire“ auf HBO.
_Washington DC, Sommer 1976_
Die 200-Jahr-Feier der USA steht an. Es ist heiß. In den Kinos läuft gerade ein weiterer Blaxploitation-Film los, „King Suckerman“ (fiktiver Titel). Aus dem tiefen Süden kommt ein seltsames Verbrecher-Häuflein nach DC, um einen größeren Drogendeal zu machen: Wilton Cooper, schwarz, ultrahart, Berufsverbrecher, ultraböse. Bobby Roy Clagget, ein unterbelichteter dürrer weißer Bengel, der am liebsten ein richtig harter böser Neger wäre und gerade den Besitzer eines Autokinos abgeknallt hat (weil der ihn so komisch anglotzte). Dazu Ronald und Russell Thomas, zwei schwarze Brüder an der Grenze zwischen massivem Schwachsinn und Tollwut, mordgeübt, mordlustig, mordbereit.
Hier sind sie nun in DC und holen sich Informationen bei einem lokalen Dealer, der sich nebenbei auch noch als Hehler betätigt. Cooper und Clagget treffen ihn, und treffen dabei auch auf zwei andere Gäste, die eher zufällig da sind. Das sind die wesentlichen Helden, beide Ende zwanzig:
Marcus Clay, groß, schwarz, ehemaliger Basketballer, in Vietnam gewesen, jetzt Eigentümer eines Plattenladens („Real Right Records“). Er liebt die Musik von Curtis Mayfield, seine Freundin Elaine, seinen 72er Buick Riviera und immer noch den Basketball. Außerdem kann er hart zuschlagen, aber nur, wenn es sein muss.
Dimitri Karras, sein bester Freund seit Kindertagen, auch groß und Hobby-Basketballer, Grieche (dritte Generation). Karras war mal auf dem College, hat sogar Kurse dort gehalten, doch seit einigen Jahren beschäftigt er sich vorwiegend mit den Frauen und arbeitet nebenher noch ein wenig als kleiner Drogendealer, verkauft Hasch und Tabletten an College-Kids. Nicht dass er deswegen auf der Seite des Bösen stünde.
Heute sind sie beide hier, um wieder mal ein wenig Stoff zu holen, Marcus ist nur dabei, weil sie gemeinsam noch zum Freizeit-Basketball fahren wollen.
Es kommt zum Streit mit Cooper und Claggett. Wenn die beiden mit ihren grenzdebilen Schießfreunden das Drogengeschäft erledigt haben (zusammen mit einer ganzen Rockerbande), dann wollen sie zurückkommen und auch Clay und Karras erledigen. Es wird viel Blut geben. Am Ende einen großen Showdown während des 200-Jahr Feuerwerks. Marcus und Dimitri, gestützt durch die Hilfe einiger alter und neuer Freunde, werden überleben – nicht ohne Verletzungen.
Eine harte Geschichte, dichte Atmosphäre, viel Blut und Gewalt. Einige kleine Nebenplots, die auf andere Bücher Pelecanos‘ verweisen. Tief verwurzelt in der Story die Moral: Freundschaft, Familie und Eigentum sind lebenswichtig und zu schützen, egal was an sittlichen Verfehlungen sonst so anfällt. So gesehen eigentlich recht konservativ, wie so ziemlich jeder gute „hard boiled“-Krimi. Dazu aber auch viel Musik der Zeit, coole Autos und, ganz wesentlich, interessant gebrochene Charaktere. Diese Leute, die Guten vielleicht etwas eher als die Bösen, wirken glaubhaft. Insgesamt liest sich „King Suckerman“ sehr flüssig und schafft es, mich als Leser von Beginn an zu fesseln. Nein, diese Story lässt sich nicht so einfach weglegen (und das Buch hat nicht zu Unrecht einige Preise gewonnen).
_Zum Schreibstil_
„King Suckerman“ bietet |Creative Writing| der Oberklasse (auch wenn Pelecanos das nie ausdrücklich gelernt hat). Schnell, direkt, plastisch, fast schon filmisch. Die filmische Struktur wird immer wieder deutlich, häufig springen den Leser beinahe fertig ausgearbeitete kleine Filmszenen an. Ich denke beim Lesen: Das Ding muss doch schon verfilmt sein, und einen Soundtrack müsste es doch auch geben …
Ganz wichtig für den Genuss dieses Krimis (wie der anderen Pelecanos-Bücher) sind die präzisen und profunden Milieukenntnisse. Ob das die Schilderung der Umgebung ist, der Kleidung, der Musik, der Bewegungen, alles stimmt bis ins Detail. Ganz besonders gilt das für den Dialog. Und hier offenbart die deutsche Übersetzung dann doch erhebliche Schwächen. Ich muss zugeben, diese Schwächen erst richtig gesehen zu haben, nachdem ich mir im Anschluss an „King Suckerman“ andere Bücher von Pelecanos auch mal im Original durchgelesen habe (es gibt ja längst nicht alles von ihm auf Deutsch).
Sämtliche Figuren werden da glasklar durch ihre Sprechweise charakterisiert, nicht bloß die schwarze Ghettosprache wird sauber abgebildet, bis in die letzte Nebenfigur stimmen Akzent und Wortwahl (soweit ich das mit amerikanischen Verwandten und mehrjähriger Ostküsten-Erfahrung beurteilen kann). Hier kommt das Deutsche einfach nicht nach, irgendwelche deutschen Sprachmuster einfügen zu wollen, wäre auch fatal. Auch die immer wieder eingewobenen Songtexte und Basketball-Referenzen verlieren durch die Übersetzung doch deutlich an Energie. Das ist schade, denn die enorme Farbigkeit von Pelecanos‘ Schreibe kommt so insgesamt nur etwas matt herüber. Also, meine Empfehlung (selbst wenn die Englisch-Kenntnisse nicht |so| perfekt sein mögen): Möglichst im Original kaufen. Trotzdem ist die Übersetzung von Bernd Holzrichter solides Handwerk. Und für den Einstieg eignet sich eins der |Dumont|-Bücher durchaus.
_Und was war jetzt mit dem Film?_
April 1998. Sean Combs (da noch „Puff Daddy“) ist auf dem Höhepunkt der Verkaufszahlen seiner Plattenfirma |Bad Boy| angekommen. Aber sein Ego ist zu groß, um sich nur mit einer Rolle als Plattenproduzent und Gelegenheits-Rapper bescheiden zu wollen. Modeschöpfer will er werden, und Filmstar. Die erste „Sean John“-Modelinie lässt er entwerfen – und er sichert sich die Rechte für die Verfilmung von „King Suckerman“. Oliver Stone soll den Regisseur geben. Für sich selber reserviert Puffy die Rolle des Marcus Clay (eigentlich erstaunlich, wo er doch eher kleinwüchsig ist).
Das von Pelecanos gelieferte Skript wird mehrfach umgeschrieben, doch eigentlich liegt es nicht am Skript, dass aus dem Film bis auf weiteres nichts wird: Der Herr Combs ist einfach kein Schauspieler (um es mal zurückhaltend zu sagen). Immerhin hat es mit der Mode funktioniert, die überteuerte „Sean John“-Konfektion läuft seit Jahren außerordentlich gut.
Schade um den Film jedoch. Dieses Buch hätte eine gute Verfilmung nicht bloß verdient – es bietet sich ganz klar dazu an, immer noch.
_Was geschah |nach| „King Suckerman“?_
George Pelecanos hat mittlerweile ein halbes Dutzend weiterer Bücher veröffentlicht. Vom direkten Nachfolger „The Sweet Forever“ liegt bereits eine deutsche Übersetzung vor (als „Eine süße Ewigkeit“ bei |Dumont Noir|). Die wichtigsten Charaktere aus „King Suckerman“ tauchen wieder auf, es ist 1986, Marcus Clay hat mittlerweile vier Plattenläden und Dimitri Karras ist sein BMW-fahrender Geschäftsführer – mit einem deutlichen Kokainproblem. Es gibt allerlei dramatische Verwicklungen mit jugendlichen Drogendealern und korrupten Polizisten, die ich hier nicht weiter verraten will. Stattdessen eine klare Kaufempfehlung.
Auch „Shame the Devil“, Anfang 2000 erschienen, greift auf Clay und Karras zurück, spielt aber wieder zehn Jahre später, 1996 – und ist meines Wissens bisher noch nicht ins Deutsche übersetzt (dafür aber auf Französisch als „Funky Guns“ erhältlich). Das gilt auch für sein aktuelles Buch, „Hard Revolution“, in dem er Clay und Karras mal alleine lässt. Stattdessen besucht er einen anderen seiner Serienhelden, den schwarzen Privatdetektiv Derek Strange, als jungen Polizisten im Jahre 1968. Bin mal gespannt …
Als Einstieg in die Welt des George P. Pelecanos ist allerdings „King Suckerman“ kaum zu schlagen. Dass er nebenbei noch die auslaufende Blaxploitation-Welle und das schwarze Amerika der Mittsiebziger sauber aufzeichnet, das sind nur Nebenargumente: Hier ist einer der besten amerikanischen Autoren für „hard boiled“–Krimis am Werk – und er schreibt trotz verzeihlicher kleiner Abschweifungen ganz vorzüglich. Dieser Krimi ist spannend, kraftvoll und auf zugängliche Weise echte Literatur.
Also nochmals meine eindringliche Empfehlung: Go get it!
Alan Dean Foster – Aliens – Die Rückkehr
Mit letzter Kraft hat sich Ellen Ripley, Deckoffizier an Bord des Raumfrachters NOSTROMO, des unheimlichen, schier unsterblichen Aliens erwehren können, das sie und ihre Kameraden auf Geheiß der „Gesellschaft“, eines mächtigen Konzernmultis, ahnungslos vom Planeten LV-426 bergen mussten. Mit Jones, der Schiffskatze, treibt sie im Kälteschlaf in der Rettungskapsel der untergegangenen NOSTROMO im All und wartet auf ihre Rettung. (Die Vorgeschichte beschreibt Alan Dean Foster in [„Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ 645 .)
Schließlich findet man die Kapsel, doch inzwischen sind 57 Jahre vergangen. Ripley kehrt zur Erde zurück, wo ihre Angehörigen und Freunde längst gestorben sind. Die Schatten der Vergangenheit lassen sie nicht los. Da sind die ständigen Albträume. Schlimmer sind allerdings die Intrigen der „Gesellschaft“, die das so fatal fehlgeschlagene und höchst heikle Projekt LV-426 unbedingt vertuschen will und Ripley zum Sündenbock für den Verlust der NOSTROMO und ihrer Mannschaft stempelt. Ripley findet sich auf einer schwarzen Liste wieder, was es ihr doppelt schwer macht, in einer ihr völlig fremd gewordenen Welt Fuß zu fassen.
Da wendet sich Carter Burke, ein Repräsentant der „Gesellschaft“, an Ripley. Sie muss erfahren, dass die „Gesellschaft“ in den vergangenen Jahrzehnten eine Kolonie auf LV-426 – jetzt „Acheron“ genannt – eingerichtet hat. Riesige Maschinen sollen den unwirtlichen Planeten in eine zweite Erde verwandeln. Im Verborgenen wird gleichzeitig das Wrack untersucht, in dem die Mannschaft der NOSTROMO einst auf das Alien stieß.
Ganz plötzlich ist der Kontakt zur Vorzeige-Kolonie abgebrochen. Hat Ripley womöglich doch die Wahrheit gesagt? Die „Gesellschaft“ geht kein Risiko ein. Sie schickt den Truppentransporter SULACO und eine kleine Gruppe kampferprobter Soldaten nach Acheron, die dort nach dem Rechten sehen sollen. Ripley wird ihnen als Beraterin zur Seite gestellt; ihr bleibt keine Wahl, denn der lange Arm der „Gesellschaft“ wird sonst dafür sorgen, dass sie nirgendwo eine Heimat findet.
Nach der Ankunft findet die Gruppe die Kolonie menschenleer und zerstört vor. Ripley findet die einzige Überlebende: die sechsjährige Newt, die ihnen berichtet, wie Horden von Aliens die Kolonie überfallen und sämtliche Bewohner getötet oder verschleppt haben.
Rasch müssen die Soldaten, die Ripleys Warnungen über die Gefährlichkeit der Aliens bisher keinen Glauben geschenkt haben, die Erfahrung machen, dass ihre Bewaffnung und ihre Ausbildung gegen diesen Feind wenig ausrichten. Ein erster Vorstoß in das Nest der Aliens endet in einem Fiasko; einige Männer, darunter der Kommandant, sterben, das Landefahrzeug wird zerstört. Nun ist die Gruppe auf Acheron gefangen – und in der Nacht werden die Aliens kommen …
Seit etwa 1980 ist der „tie-in-Roman“ – die Nacherzählung eines Kino- oder TV-Films – eine feste Größe im Vermarktungskonzept der Film- und Fernsehindustrie. Das Drehbuch liegt sowieso vor; warum es dann nicht als Grundlage eines Romans noch einmal profitbringend recyceln? Im schlimmsten Fall werden die schon vorhandenen Dialoge und Handlungsvorgaben mit einigen Überleitungen verbunden, und schon kann das Produkt – und mehr ist es dann nicht – auf den Markt geworfen werden.
Unter diesem Aspekt ist es einleuchtend, dass sich eine ganze Reihe von zweit- und drittklassigen Autoren auf das Verfassen von Filmromanen spezialisiert hat. Aber auch Schriftsteller von Rang und Namen verdienen sich gern ein kleines Zubrot, wenn die Karrierekurve einmal einen Knick erfährt.
Alan Dean Foster gehört zu den redlichen Vertretern seiner Zunft. Er begann als „richtiger“ Autor und debütierte 1972 mit dem Roman „The Tar Aiym-Krang“ (dt. „Das Tar Aiym Krang“) dem er bis heute knapp 100 (!) weitere folgen ließ: Foster gilt als schneller, aber versierter und unterhaltsamer Handwerker. Als solcher erregte er schon früh die Aufmerksamkeit der Film- und Fernsehindustrie, der er schon vorher durch seine Arbeit in der PR-Abteilung eines kleinen kalifornischen Studios verbunden war. Zwischen 1974 und 1978 verwandelte er die Drehbücher der STAR TREK-Zeichentrickserie in eine zehnbändige Buchreihe. Anschließend ging es Schlag auf Schlag: Neben den „Alien“-Romanen entstanden Bücher zu Filmen wie „Starman“, „Das Ding aus einer anderen Welt“ oder „Outland – Planet der Verdammten“, aber auch zu Western wie „Pale Rider – Der namenlose Reiter“ – bis Anfang der 90er Jahre insgesamt etwa 25 Romane.
Der fleißige Autor hatte 1979 bereits den ersten Teil der „Alien“-Saga in Romanform gebracht und dabei sehr gute Arbeit geleistet. Die Fortsetzung sollte ihn vor ungleich größere Probleme stellen. „Aliens – Die Rückkehr“ ist ein James-Cameron-Film. Dieser Regisseur und Drehbuchautor ist bekannt und berühmt für seine fabelhaften Action-Filme (u. a. „Terminator“, „Terminator II“, „Abyss“). Gegen sein enormes Talent, eine spannende Geschichte in packende Bilder zu kleiden, fällt seine Fähigkeit, dieser Geschichte Tiefe zu verleihen, ab. Zumindest der frühe Cameron (mit „Titanic“ hat sich seine inszenatorische Bandbreite stark erweitert) achtete deshalb darauf, dass vor der Kamera immer etwas geschieht. In „Aliens – Die Rückkehr“ gibt es durchaus ruhige Passagen (das gilt besonders für den „Director´s Cut“, der fast eine halbe Stunde länger ist als die Kinofassung), der Film weist dennoch einen völlig anderen Grundton auf als sein Vorgänger.
Zwangsläufig erschwert die Betonung des Körperlichen einem Schriftsteller wie Alan Dean Foster die Arbeit. Er denke sich gern in die Köpfe seiner Figuren, sagte er in einem Interview einmal (nachzulesen in: Jens H. Altmann, „Am Ende passt alles zusammen“. Ein Interview mit Alan Dean Foster, in: Wolfgang Jeschke [Hg.], Das Science Fiction Jahr 1998, Heyne Verlag, Nr. 06/5925, S. 565-574). Dazu lässt ihm das Drehbuch zu „Aliens“ wenig Spielraum. Foster kann in die actionbetonte Story keine längeren Passagen einfügen, die dieser völlig entgegenlaufen. Also muss er sich mit Andeutungen begnügen. (So erfährt man beispielsweise zum ersten Mal etwas über das Privatleben Ellen Ripleys, die hier zudem endlich zu ihrem Vornamen kommt). Trotzdem gelingt ihm wieder ein spannend zu lesender Roman, der gegen den auf seine Art überragenden Film, der sich wie sein Vorgänger sofort zu einem Klassiker des Genres entwickelte, allerdings dieses Mal deutlich abfällt.
Taschenbuch : 282 Seiten
www.heyne.de