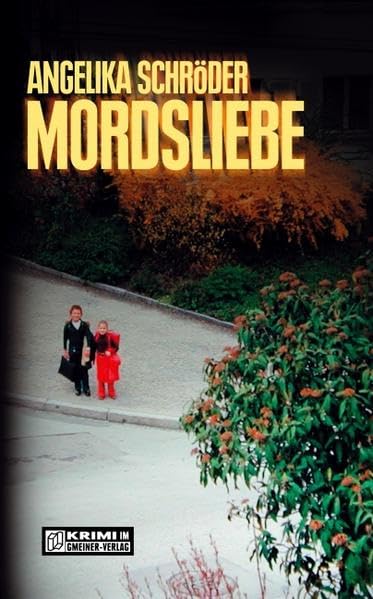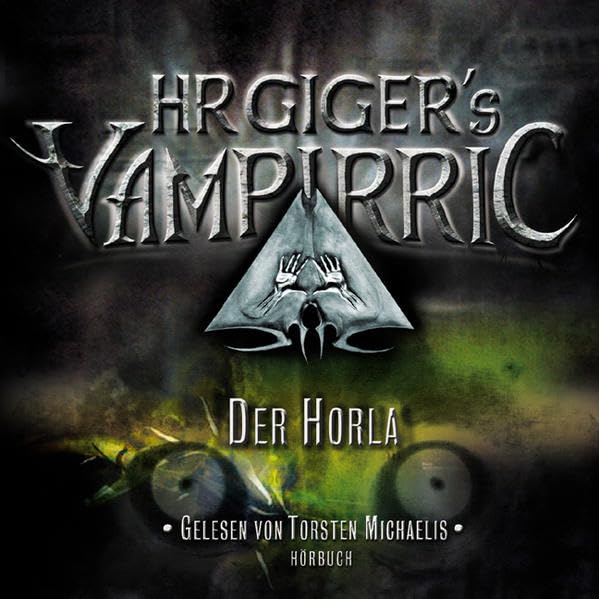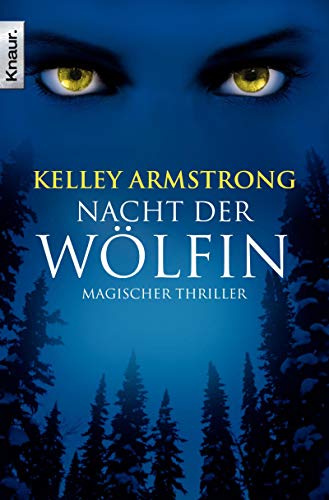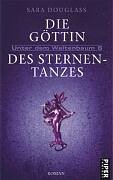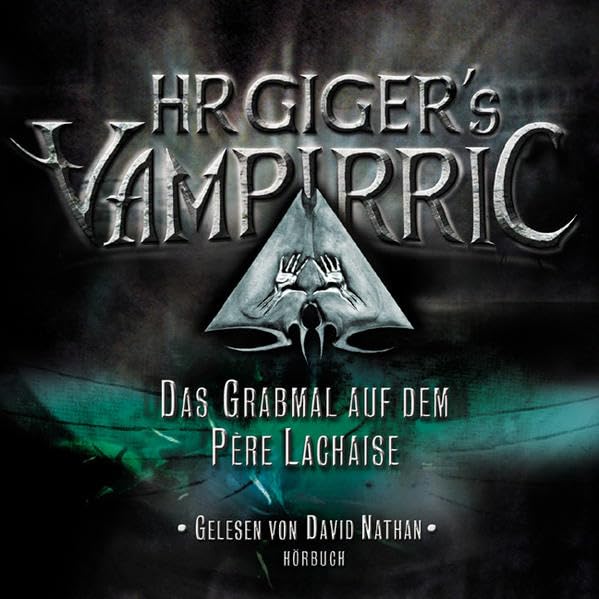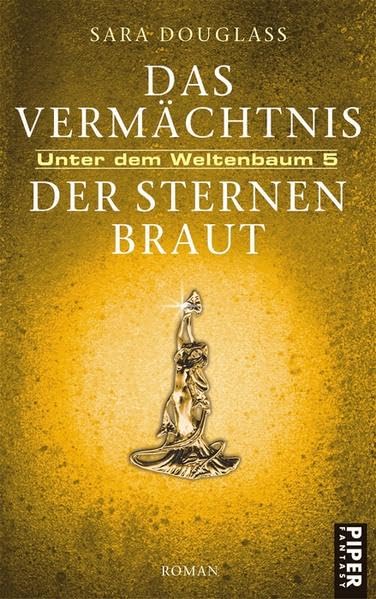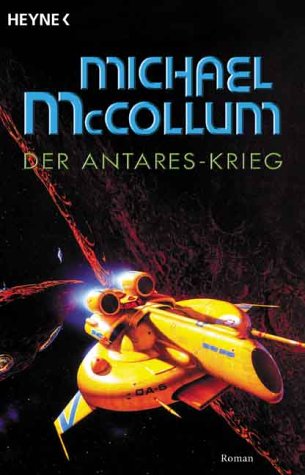Schröder, Angelika – Mordsliebe
„Mordsliebe“ spielt an einem Ort, an dem sich die 1955 in Westfalen geborene und in Hagen als Grundschullehrerin arbeitende Angelika Schröder bestens auskennt: eine Grundschule in einem fiktivem Stadtteil von Hagen. Der eher ruhige Krimi lebt von der präzisen und liebevollen Charakterisierung seiner Figuren. Obwohl dem Leser schnell klar ist, wer der Täter sein muss, vor allem durch die den Kapiteln vorangestellten Einblicke in die Gedanken des Mörders, macht es Spaß, die Hauptpersonen auf der Suche nach Hinweisen zu begleiten. Mit treffenden Worten skizziert Angelika Schröder auch den Hintergrund ihres Debütromans: schwierige Schüler, gleichgültige Eltern und resignierte Lehrer in einer heruntergekommenen Grundschule.
Viele der in dieser Grundschule unterrichteten Kinder stammen aus schwierigen Familienverhältnissen – von alleinerziehenden Müttern, die neben der Arbeit nur noch wenig Zeit für ihre Kinder aufbringen können, bis hin zu Missbrauch durch den Vater oder den neuen Freund der Mutter – und die Schule selbst ist dringend sanierungsbedürftig. Die Kellerklassenräume sind durch Schimmel unbenutzbar geworden, in den anderen Klassenräumen fällt den Kindern schon mal der Putz von der Decke und die Sporthalle ist durch ein undichtes Dach kaum einsetzbar. Helga Renner, die Hauptfigur des Romans, unterrichtet dort eine zweite Klasse. Vier Wochen vor Beginn der Romanhandlung wurde ein Mädchen aus ihrer Klasse, die achtjährige Sandra Linner, ermordet im Westpark aufgefunden. Die ermittelnden Beamten der Mordkommission, Klaus Kersting und Jürgen Masowski, wissen bislang nur wenig: Sandra hat ihren Mörder vermutlich gekannt, da sie keine Gegenwehr geleistet hat, und der Mörder trug einen grauen Wollmantel, von dem Fasern an Sandras Kleidung gefunden wurden. Nun wird ein zweites Kind tot im Westpark gefunden: Auch der Drittklässler Benjamin Fränzke wurde, wie Sandra, ohne Gegenwehr zu leisten von seinem Mörder erdrosselt. Doch noch immer verlaufen alle Ermittlungen im Sande und Angst macht sich breit im Viertel, den der Mörder könnte jederzeit wieder zuschlagen.
Die Vorsitzende der Elternschaft Anne-Liese (Ali) Merklin überredet Helga dazu, auf eigene Faust nach dem Täter zu suchen. Mit ihrer Kenntnis des Viertels und dessen Bewohner und Helgas Kenntnissen über die Grundschüler und das Kollegium erhoffen sie sich mehr Hinweise, als die Polizei bisher entdecken konnte. Auch Helgas Aikido-Gruppe möchte sich an den Ermittlungen beteiligen und verabredet sich, Patrouille im Westpark zu gehen. In Zweiergruppen wollen sie dort ihre Hunde spazieren führen, joggen oder Aikido trainieren, um zu beobachten und so die Kinder vielleicht zu beschützen.
Tatsächlich gelingt es ihnen, neue Spuren und Verdächtige in beiden Mordfällen zu entdecken, diese erweisen sich jedoch schnell als Sackgassen. Erst ein dritter Mord an dem neunjährigen Marcel Wohmann lässt in Helga einen schrecklichen Verdacht aufkommen.
Insgesamt besticht „Mordsliebe“ zwar nicht durch große Spannung oder lebensbedrohende „Action“, doch berührt die Geschichte aufgrund der Lebendigkeit ihrer Figuren. Positiv fällt auch die Lösung des Falles auf: die Hobby-Detektive versuchen nicht, den Täter alleine zu stellen, sondern leiten ihren entscheidenden Hinweis an die Beamten der Mordkommission weiter, die dann kompetent die weiteren Ermittlungen und die endgültige Lösung des Falles übernehmen. Man könnte sich durchaus vorstellen, dass der Roman von einer wahren Begebenheit erzählt, nur bleibt zu hoffen, dass Angelika Schröder die Verhältnisse an deutschen Grundschulen aus dramaturgischen Gründen stark übertrieben hat.
Jeffery Deaver – Das Gesicht des Drachen [Lincoln Rhyme/Amelia Sachs 4]
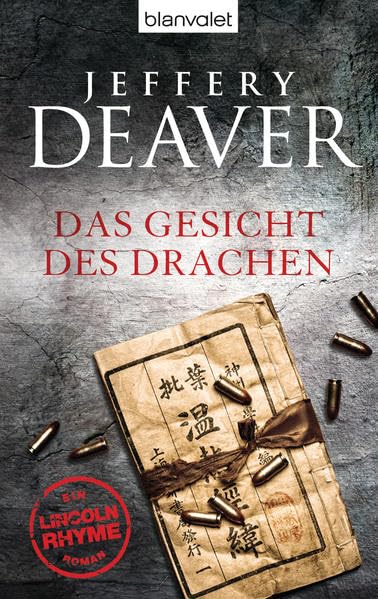
Maupassant, Guy de – HR Giger\’s Vampirric 4 – Der Horla
Die letzte CD aus HR Gigers Viererpack „Vampirric“, einer Hörbuch-Anthologie mit Vampirgeschichten, bietet noch einmal ein echtes Erlebnis. Dem Gruselfreund wird hier nämlich Guy de Maupassants „Der Horla“ (frz. „Le Horla“, 1887) vorgelesen, ein Klassiker der Vampirliteratur und ein Schmuckstück psychologischen Grusels.
Man verfolgt die Tagebucheintragungen eines zunächst lebensfrohen und naturverbundenen jungen Mannes: Er wohnt am Fluss in einem Häuschen, winkt den vorbeifahrenden Schiffen und spatziert durch die Wälder. Doch diese Idylle wird immer mehr gestört, als sich unser Protagonist Jean zunehmend schlapp und unwohl fühlt. Er schäft schlecht und leidet unter Albträumen. Letztlich beschließt er, dass er sich auf eine Erholungsreise begeben sollte. Ein weiser Entschluss, denn bei seiner Rückkehr fühlt er sich gesund und wohl. Doch schon nach der ersten Nacht im eigenen Haus stellen sich die Symptome wieder ein. Bald vermutet er sogar, dass er schlafwandelt, da aus seinem Krug des Nachts Wasser verschwindet, ohne dass er sich erinnern kann, es getrunken zu haben. Er fürchtet, wahnsinnig zu werden, doch bemerkt er, dass sich etwas anderes in seinem Haus herumtreibt, ein Wesen, das ihn nachts heimsucht und sich offensichtlich von Milch und Wasser ernährt, andere Speisen aber verschmäht. Gleichzeitig entzieht es Jean offensichtlich die Lebensenergie und zwingt ihm seinen Willen auf. Dieser Horla, so stellt sich das Wesen im Laufe der Erzählung vor, ist offensichtlich Teil einer Rasse, die evolutionär über dem Menschen steht und sich ihn Untertan macht. Jean pendelt daraufhin zwischen Verzweiflung und Wahn; ein Versuch, den Horla zu vernichten, schlägt fehl. Mit der Ausweglosigkeit der Situation konfrontiert, bleibt Jean nur noch eine Möglichkeit, sich dem Zugriff des Wesens zu entziehen: der Selbstmord.
Guy de Maupassant (1850-1893) ist dem Liebhaber französischer Literatur sicher kein Unbekannter. Als frischgebackener Beamter machte er seine ersten zögerlichen Schritte in der Schriftstellerei, war aber mit seinem Debüt „Fettklößchen“ gleich so erfolgreich, dass er sich fortan nur noch dem Schreiben widmete und einer der beliebtesten Autoren seiner Zeit wurde. Er war mit so bekannten Namen wie Flaubert oder Turgenev bekannt, bei Maupassants Tod 1893 hielt kein Geringerer als Emile Zola die Grabrede. Maupassants Leben endete in Wahnsinn. Schon früh litt er an einer Nervenkrankheit, die die damalige Medizin nicht zuordnen konnte: Sehstörungen, Angstzustände, Depressionen und partielle Lähmungen stellten sich in Schüben ein. Als sein Bruder durch ein ähnliches Leiden im Wahnsinn starb, war für Maupassant klar, dass ihm das gleiche Schicksal blühen würde. Unter diesem Licht lässt sich „Der Horla“ auch als Maupassants Auseinandersetzung mit dem fortschreitenden Wahnsinn lesen. Jean fragt sich an mehreren Stellen, ob er denn wahnsinnig geworden sei. Anstatt das Unmögliche und Unglaubliche zu akzeptieren, zieht er zunächst den Gedanken vor, selbst nicht mehr zurechnungsfähig zu sein. Dann, als das Unmögliche unwiderruflich bestätigt ist, drängt ihn gerade diese Gewissheit weiter an den Rand des Wahnsinns. Die Vorstellung, der Mensch sei nicht die Krönung der Schöpfung und nur Sklave eines höheren Wesens, raubt ihm den Seelenfrieden. Jeans Ringen um sein inneres Gleichgewicht zeigt Maupassant unverblümt in den schmerzhaft glaubwürdigen Tagebucheintragungen des Geplagten.
Gelesen wird die Geschichte diesmal von Torsten Michaelis, der sonst Wesley Snipes seine Stimme leiht. Dass er damit offensichtlich hoffnungslos unterfordert ist, beweist er hier eindrucksvoll. Mit samtener Stimme zieht er den Hörer in seinen Bann und klingt dennoch mit zunehmender Sprechzeit (und zunehmendem Wahnsinn) gehetzter, unkontrollierter und gebrochener. Innerhalb der 78 Minuten des Hörbuchs kann er damit eine ungeheure Bandbreite beweisen – und das mit nur einer Geschichte!
Qualitativ liegt diese CD ungefähr gleichauf mit „Das Grabmahl auf dem Père Lachaise“, das sich auf dem dritten Hörbuch findet. Welche Geschichte letztendlich das Rennen macht, ist Geschmackssache, beide jedoch bieten eine spannende Studie über das Innenleben eines vermeintlich Wahnsinnigen. Wer nicht alle vier CDs der Sammlung kaufen will, sollte sich jedoch zumindest diese beiden anschaffen. Jeweils eine gute Stunde gepflegten Nervenkitzels und Gruselns sind garantiert.
Wer nach dem Genuss von „HR Giger’s Vampirric“ immer noch nicht genug von vampirischen Geschichten hat, der kann sich das dazu passende Buch (erschienen bei |Festa|) zulegen. Für die Hörbücher wurden nämlich nur einige Erzählungen ausgewählt (sechs insgesamt), die Anthologie selbst bietet noch eine ganze Reihe mehr, nämlich insgesamt 23 Geschichten.
Alle vier Hörbücher im Überblick:
[HR Giger’s Vampirric 1: 581
Thomas Ligotti „Die verloren gegangene Kunst des Zwielichts“ und
Horacio Quiroga „Das Federkissen“
[HR Giger’s Vampirric 2: 582
Leonard Stein „Der Vampyr“ und
Amelia Reynolds Long „Der Untote“
[HR Giger’s Vampirric 3: 583
Karl Hans Strobl „Das Grabmahl auf dem Père Lachaise“
HR Giger’s Vampirric 4:
Guy de Maupassant „Der Horla“
Disher, Garry – Hinterhalt
20.000 Dollar hat Wyatt eingesackt, viel weniger als die erhofften dreihunderttausend Dollar, die das Lohnbüro gebunkert haben sollte. Und die läppische Beute wird ihm gleich im Motel von zwei Typen aus den Händen gerissen: Einen von ihnen, Mostyn, kann er kaltstellen, aber Whitney, der zweite Detektiv, macht sich mit dem Geld auf und davon. Wyatt bleiben „zweihundert Dollar, ein paar Dietriche und an Kleidung nur das, was er am Leibe trug“. Reichlich wenig für jemanden, der immer auf der Suche ist nach „dem großen Ding“. Jetzt hängt er fast mittellos in der Nähe Melbournes herum und ist so weit, jede seiner lächerlichen Ausgaben auf den Cent genau nachzuhalten.
Wyatt hätte sich aber nicht sein Leben lang halbwegs erfolgreich durchs Leben geschlagen – immerhin hat er sich ein schnuckeliges Farmhaus mit nettem Gelände auf einer abgelegenen Halbinsel zulegen können -, wenn ihn ein Rückschlag wie dieser in seinem Elan gestoppt hätte. Freunde hat er, zumindest ein paar, denen er vertrauen kann. Okay, sein Verbindungsmann Rossiter fällt aus, und die Ehefrau reagiert allergisch auf Wyatts Anruf: „Deinetwegen haben sie meinen Alten fast erwürgt!“ Und Loman – na ja, am Apparat meldet sich eindeutig ein Polizist: „Er ist buchstäblich verkohlt.“
Bleibt Harbutt, die dritte Wahl. Und der kreuzt nicht alleine am Treffpunkt auf, sondern mit Dern, der eine Latte an möglichen Aufträgen mit sich herumschleppt, die von Wyatt gleich einmal der Reihe nach aussortiert werden. Außerdem schließt sich Thea dem Trio an: „Damals hatte sie sich Maxine genannt“. Dieses „damals“ hängt Wyatt noch nach, jedenfalls taucht Thea-Maxine später alleine auf, um einen früheren eiligen Abschied nachzuholen. Dern hat sein Mädchen aber nicht aus den Augen verloren. Nach einer einseitigen Prügelei macht sich Wyatt wieder einmal aus dem Staub.
An einem anderen Ort braut sich bereits neue Unbill zusammen: Mark Stolle, Chef des Detektiv-Duos, will selbst den Auftrag erledigen und Wyatt aufspüren; seine Auftraggeberin lässt auch nach dem ersten Fehlschlag nicht locker.
Wyatt macht sich in der Zwischenzeit zu seiner Farm auf, um sich das dort deponierte Geld und eine Waffe vor dem Zugriff anderer zu sichern: Seine Farm steht längst zum Verkauf, nachdem er landesweit gesucht wird. Auf der Farm schließt sich auch der Kreis, denn Finn, der Bruder eines Ermordeten, passt ihn dort ab. Vor drei Monaten hatte er eine Kanzlei ausgeraubt, Anna Reid hatte den Job ins Rollen gebracht. Und eben diese Anna Reid kommt plötzlich mit ins Spiel, als Stolle auf der Suche nach Wyatt erst einmal dessen Farm anläuft. Finn wird erschossen, Wyatt kann entkommen – aber Stolle lässt nicht locker. Und die Auftraggeberin wird auch zufrieden gestellt …
258 Seiten Umfang hat „Hinterhalt“, nicht unbedingt viel für den Preis, der verlangt wird. Für ein paar Euro mehr kann ich schon Bücher mit dem doppelten Umfang einbringen – habe ich da für teuer Geld ein schlechtes Geschäft gemacht? Keineswegs und ganz im Gegenteil: Ich bin ja schon dankbar, wenn sich Autoren auf das Wesentliche zurücknehmen können und da von Zeilenschinderei absehen, wo es insbesondere dem Lesegenuss zugute kommt. „Hinterhalt“ legt ein rasantes Tempo vor, es bleibt für den Leser kaum Zeit zum Verschnaufen, und das hängt auch damit zusammen, dass Garry Disher den Inhalt auf das für ihn Wichtige kondensiert, also auf Reflektionen, Innenansichten, gute Gespräche verzichtet: Pure Action ist angesagt.
Das ist nicht jedermanns Sache, und auch der Rezensent würde sich mit argem Bauchgrimmen nach dem zu häufigen und einseitigen Genuss der Disher-Romane nach einem Highsmith-Krimi sehnen. Aber Wyatt, Held und Anti-Held in einer Person, strahlt eine magische Anziehungskraft aus, die vielleicht mit unserer dunklen Saite zu tun hat, die manchmal in uns anklingt, zumindest dann, wenn sie auf ungefährliche Weise angeschlagen wird: Er ist ein gewöhnlicher Verbrecher, dabei wenig ehrenhaft, schnell mit der Waffe und skrupellos, wenn es um den eigenen Vorteil geht. Und doch schimmert auch seine „gute“ Seite durch, wenn er am Ende des Romans die eben eingeheimste Barschaft mit vollen Händen von sich gibt, weil eine Frau – die er zuvor aus dem Gefängnis befreit hat – ihn darum bittet. „… aber er wusste, dass ab jetzt alles nur besser werden konnte“.
Natürlich wird nichts besser werden, weil dieses „besser werden“ auch immer den Klang nach Beständigkeit mit sich trägt, einen Dauerzustand, von dem man sich nicht mehr lösen kann, will man sich nicht wieder verschlechtern. Wyatt dagegen ist unstet, auf Veränderung aus, ein Nomade, den nichts dort hält, wo er gerade ist. Und so ist der Schluss von „Hinterhalt“, als die Frau befreit wird und er den Gedanken hat, mit ihr zusammenbleiben zu können, nur zwangsläufig. „Zwei- oder dreimal im Jahr verschwinde ich für eine Woche, für einen Monat, komme nach Hause …“ Das hätte niemals gut gehen können, doch sie nimmt ihm die Last ab, eine solche Beziehung scheitern zu lassen. Sie nimmt seine Geldofferte an und verschwindet aus seinem Leben …
Garry Disher erhielt zu Recht 2000 und 2002 den Deutschen Krimipreis. „Hinterhalt“ passt sich nahtlos an die beiden Vorgänger „Gier“ und „Drachenmann“ an: schnelle Kost für heiße Sommertage.
_Karl-Georg Müller_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de veröffentlicht.|
China Miéville – Leviathan
Teil 1: Die Narbe
Die schwimmende Stadt Armada, zusammengestückelt aus einer unüberschaubaren Zahl großer und kleiner Schiffe und Wracks, gezogen von den gewaltigen Kräften des Avanc, einer inselgroßen Kreatur aus den Tiefen der Meere Bas-Lags – auf der Suche nach der Narbe, der mythischen Wunde der Welt, Quell einer magischen Macht …
Der Autor
China Miéville wurde 1972 in England geboren. Nach Abschlüssen in Sozialanthropologie und Wirtschaft unterrichtete Miéville in Ägypten. Während sein für mehrere Awards nominierter erster Roman „King Rat“ noch leer ausging, wurde „Perdido Street Station“ mehrfach ausgezeichnet (unter anderem mit dem Arthur C. Clarke Award und dem Kurd-Laßwitz-Preis). Nach „Perdido Street Station“ ist „The Scar“ (deutsch: „Die Narbe“, „Leviathan“) sein zweiter Roman aus der phantastischen Welt Bas-Lag.
Inhalt
Die Wissenschaftler Armadas haben es geschafft, den Avanc, das Wesen aus dem Raum zwischen den Realitäten, mit thaumaturgischen Kadabras und der Hilfe eines von der Linguistin Bellis Schneewein übersetzten Buches zu ködern und als Zugtier für die Piratenstadt einzuspannen. Nie zuvor durchstreifte Armada die Meere Bas-Lags mit dieser Geschwindigkeit und Zielstrebigkeit, wie es ihr nun die Beherrschung des Giganten gestattet.
Und die mächtigste Führungsgruppe hat weitere Ziele. Sie gibt sich nicht mit der neuen Beweglichkeit zufrieden, sondern strebt nach größerer Macht, die sie an der unnatürlichen Wunde der Welt zu finden hofft. Dort, so sagen die Legenden und Mythen, seien die Naturgesetze aufgehoben, es herrsche ein Zustand der Possibilitäten, die je nach Grad ihrer Wahrscheinlichkeit zu tausenden parallel existieren – selbst widersprüchliche Zustände.
Doch werden der Bevölkerung Armadas die Fakten vorenthalten und sie wird über die wahren Ziele getäuscht. Der Brucolac, stärkster Gegner des Plans, probt die Meuterei, als sich fremdartige Wesen in den Konflikt einschalten. Mit ihrer Hilfe erhofft er sich eine Wendung der Stadt, zurück zu ihrem Alltag als Piratenstadt. Die Fremden handeln dabei nicht uneigennützig: Sie wurden von einem Mann betrogen und beraubt, der sich seit dem Überfall Armadas auf die Terpsichoria (siehe: „Die Narbe“) an Bord Armadas befindet. Ihm und dem Diebesgut gilt ihr Trachten. Und so kommen die Fremden und der Brucolac, Herr der Vampire, in ihr verhängnisvolles Geschäft. Nicht verhängnisvoll für die Fremden, denn sie sind wahrlich zu fremdartig …
Kritik
Es ist nicht einfach, ein Buch zu besprechen, das als zweiter Teil eines in der Originalsprache einzelnen Romans erschien. „Leviathan“ knüpft nahtlos an die Geschehnisse in „Die Narbe“ an. Guter Zeitpunkt, um ein Wort über die Titel zu verlieren. In der Narbe wurde sie selbst höchst verschwommen und indirekt erwähnt, dort ging es eher um die Köderung des Avanc, der ein wahrer Leviathan ist. Andersherum richtet sich der Blick im vorliegenden Buch, das den Titel „Leviathan“ trägt, immer stärker auf die Narbe, die Kluft in der Welt. Da hat wohl jemand die Titel vertauscht? Passend dazu die entsprechenden Klappentexte, die jeweils dem anderen Buch besser stehen würden.
Genug davon.
Bellis Schneewein erlebt eine herbe Enttäuschung. Alle Aktionen, alles, was sie anderes tut als die anderen Bewohner Armadas, ist geplant, sie wird von den einzelnen Machtgruppen manipuliert. Da ist beispielsweise Silas Fennek, der ihr von der großen Bedrohung ihrer Heimatstadt New Crobuzon berichtete und sie auf die gefährliche Reise zur Anopheles-Insel schickte, um eine Nachricht, eine Warnung rauszuschmuggeln. Jetzt erfährt sie über deutliche, blutige Zeichen (eine gnadenlose Schlacht auf den Meeren), dass Fennek nur sein Wohl im Auge hatte und die Flotte New Crobuzons gegen die Piratenstadt gelenkt hat. Bellis beichtet sogar entsetzt und wird von jenen ausgepeitscht, die sie in ähnlicher Weise benutzen, um eine Meuterei anzuzetteln. Als ihr das klar wird, erinnert sie sich, „[…] was sie in Douls Augen gelesen hat. Wieder ein Werkzeug, denkt sie, fassungslos und staunend. Wieder ausgenutzt[…]“.
Und trotz dieser Erkenntnis führt sie den eingeschlagenen Weg zu einem Ende, denn es ist der einzige Weg für sie zurück. So stellt sich das ohne viel Drumherum dem Leser dar, denn die bildgewaltige Sprache Miévilles hält sich mit einengenden Details zurück. Subtil entwirft er das Bild der Welt, die Charaktere entwickeln sich mit jeder Seite und werden deutlicher. Die kleinen Details erzeugen ein Gefühl für den Zustand, das Wesen, die Philosophie dieser Welt, die in ihrer Gesamtheit noch immer anders ist, faszinierend anders.
Während Bellis Schneewein in der „Narbe“ wichtige Erkenntnisse gewann und die Expedition voran trieb, ohne es wirklich zu wollen, tritt sie jetzt mehr in den Hintergrund, hat ihre Aufgabe erfüllt, ist nutzlos. So lassen die Herrscher ihre Werkzeuge fallen und schaffen sich damit eine große Gegnerschaft, die sich brodelnd zurückhält, bis es zum Eklat kommt. Aber Bellis bleibt weitgehend außerhalb der Masse, wird von hintergründigen Spielern manipuliert und protegiert. Fühlt sich schlecht dabei, wenn sie kleine Splitter des Intrigenpuzzles zusammensetzt. Aber ihre Intention ist klar: Sie will weg, keine Abenteuer an der Narbe, keine Reise mit dem Avanc, aber auch keine Piraterie mit Armada. Eigentlich will sie nach Hause.
Fazit
Die Welt Bas-Lag erhält mit jeder Seite mehr Tiefe, mehr Charakter, mehr Farbe. Mehr Hintergrund. Miéville entwirft eine neue Dimension der Phantastik, fern von Tolkiens Mittelerde oder der um Realismus bemühten Science-Fiction großer Space-Operas. Bas-Lag ist wie ein neuer, bisher unentdeckt gebliebener Winkel im Spektrum phantastischer Erzählkunst. Verständlich, dass der Autor mit neuen Geschichten ihre Reize auszuloten versucht. Und sehr begrüßenswert. Mit „Die Narbe“ und „Leviathan“ hat er eine neue Facette dieser Welt offenbart und Ansätze geliefert, die vermuten lassen, dass es hier noch viel zu entdecken gibt. Miéville ist einer der bedeutendsten Phantasten unserer Zeit.
Kelley Armstrong – Die Nacht der Wölfin
Sie sind schon ein rares Völkchen: Etwa 35 Werwölfe nur durchstreifen die Welt, doch da es keine Meldepflicht gibt, wissen sie es selbst nicht ganz genau. Eines ist allerdings sicher: Unter ihnen weilt nur eine einzige Werwolf-Frau, denn das entsprechende Gen wird ausschließlich in der männlichen Linie vererbt. Allerdings lässt auch der Biss des Werwolfs eines dieser mystischen Wesen entstehen, die sich in regelmäßigen Abständen in einen Wolf verwandeln müssen, der des Nachts Tiere und hier und da auch einen Menschen jagt. Üblicherweise überlebt das Opfer die Verwandlung zum Werwolf nicht oder wird getötet, doch Clayton hat den Kodex seiner Art stets recht flexibel ausgelegt. Liebe und Selbstsucht – die Übergänge sind bei einem Werwolf reicht fließend – brachten ihn vor nun über zehn Jahren dazu, seine damalige Verlobte Elena Michaels auf die beschriebene Weise zu seinesgleichen zu machen – für die junge, nach einer furchtbaren Kindheit ohnehin labile Frau der Beginn eines Martyriums, das mit dem Schrecken der ersten Verwandlung nur begann.
Ihr Überleben und Einfinden in die neue Existenz verdankt Elena Jeremy Danvers, dem gewählten Anführer oder „Alpha-Wolf“ des „Rudels“, dem die meisten Werwölfe Nordamerikas angehören. Hier finden sie Rat und Hilfe in der Not, hier werden sie aber auch an die Kandare genommen, sollten sie allzu heftig über die Stränge schlagen, denn das oberste Gebot lautet: Vermeide die Aufmerksamkeit des Menschen! Jeremy hat ein schweres Amt angetreten; längst nicht alle Werwölfe gehören zum Rudel oder fühlen sich seinen Regeln unterworfen. Die „Mutts“ oder Streuner sind Einzelgänger, die nicht selten von ihrem Jagdtrieb überwältigt werden und dann vom Rudel zur Ordnung gerufen – oder ausgeschaltet werden müssen. Elena verwaltete bis vor einem Jahr das Archiv des Rudels. In Stormhaven, der palastartigen, streng abgeschirmten Zentrale im abgelegenen Norden des US-Staates New York, behielt sie die Population der Werwölfe im Auge. Doch der innere Konflikt und die Hassliebe zum besitzergreifenden Clayton ließen sie mit dem Rudel brechen. Inzwischen hat sich Elena im kanadischen Toronto eine Existenz als Journalistin aufgebaut und lebt sogar in einer festen Beziehung mit dem Geschäftsmann Philip, der es gelernt hat, sich mit den Marotten seiner Lebensgefährtin abzufinden, die des Nachts gern lange, einsame Spaziergänge unternimmt …
Doch nun ereilt Elena erneut der Ruf des Rudels: Gefahr droht durch den charismatischen, aber moralisch verkommenen Karl Marsten, der die Mutts zur Rebellion anstachelt. Unter seiner Führung sollen sie das Rudel auslöschen, so dass er allein das Territorium beherrscht. Jeremy hat die Bedrohung allzu lange nicht erkannt. Marsten blieb Zeit genug, seine Streitmacht zu formieren. Mit brutaler Zielstrebigkeit heuert er Lust- und Serienmörder an, bietet ihnen ein zweites Leben als Werwolf an und hetzt sie dann auf das Rudel. Die meisten Angreifer können abgewehrt werden, doch einige sind allzu erfolgreich. Als der Krieg der Werwölfe endgültig ausbricht, ist das Rudel bereits arg zusammengeschmolzen. Elena sieht sich auf Gedeih und Verderb an der Seite ihrer Gefährten, denn auch sie steht auf Marstens Liste: als exotische Sklavin an seiner Seite – oder als Todeskandidatin, sollte sie sich ihm in den Weg stellen …
Wer hätte das gedacht: Manchmal geschehen nicht nur Zeichen und Wunder, sondern es erscheint hierzulande in einem Großverlag ein fest gebundener Horrorroman, der nicht Stephen King, Dean Koontz oder Anne Rice aus der Feder geflossen ist. Weil dies so selten vorkommt, hungert der echte Gruselfan nach Abwechslung, und hier wird sie ihm endlich einmal geboten. Noch besser: Armstrong nervt nicht mit telepathisch begabten Serienmördern, trügerisch liebreizenden Teufelskindern oder pseudoerotisch-dekadenten Neo-Vampiren, die man alle längst so satt hat. Stattdessen treten ganz klassische Gestalten ins Rampenlicht: Werwölfe, die – es wird immer besser – nicht als Projektionsgestalten spätpubertärer Mädchenträume verheizt, sondern in eine echte Handlung versetzt werden.
Daher vergesse man den nichts sagenden oder in die völlig falsche Richtung weisenden deutschen Titel möglichst umgehend: Hier steht nicht wie in den unfreiwillig grausigen Werwolf-Romanen der Alice Borchardt die mit den Elementen des Schauerromans notdürftig verbrämte Beschwörung des ungezähmten, wilden Weiblichen (kombiniert natürlich mit der diesem Prozess eigentlich diametralen, schwülstig-romantischen Suche nach Mr. Right) im Mittelpunkt, das sich ungehemmt anscheinend nur nach Mitternacht und im Gewand diverser Fabelgestalten entfalten kann. Stattdessen gibt es eine echte Story (mit dem Biss des Originaltitels), der die inneren Konflikte und Alltagsprobleme eines Werwolfs im 21. Jahrhundert untergeordnet bleiben bzw. klug an geeigneter Stelle in den Fluss des schwungvollen Geschehens eingeflochten werden.
Dabei ist diese Story – Rebellion im Reich der Wolfsmenschen – nicht gerade originell, aber sie wird flott und abseits allzu ausgetretener Pfade präsentiert. In gewisser Weise ist „Die Nacht der Wölfin“ Stephen Kings „Brennen muss Salem“ („Salem’s Lot“, 1975) vergleichbar (oder Kathryn Bigelows „Near Dark“-Film von 1987). Während Meister King einst den Vampir vom schweren Staub seiner literarischen Vorgeschichte befreite, widmet sich Armstrong nunmehr ebenso erfolgreich der Restauration des Werwolfs. Sie kippt endlich die tot erzählte Mär vom stets tragischen Schicksal des in einer Vollmondnacht im dunklen Wald gebissenen Nachwuchs-Werwolfs auf den Schuttplatz der lykanthropischen Literaturgeschichte und entwirft eine geheime, doch keineswegs verstohlene Gemeinschaft, die zwar strikt ihren eigenen Regeln folgt, sich aber trotzdem in die Welt der Menschen integriert hat (auch wenn diese davon nichts ahnen). Diese Werwölfe leben ganz im Hier und Jetzt – und sie leben gut, denn sie vergeuden ihre animalische Energie längst nicht mehr darauf, ausdrucksstark den Mond anzuheulen, sondern schlagen sich wacker im Big Business, lieben den Luxus und wissen nicht nur den des Nachts selbst gefangenen Hasen, sondern auch ein Fünf-Sterne-Menü zu schätzen.
Das angenehme Leben hat freilich seinen Preis: Armstrongs Werwölfe fürchten nicht nur Silberkugeln; jeder gut gezielte Schuss kann sie verletzen oder das Leben kosten. Wolfsmenschen im buchstäblichen Sinn sind sie trotzdem geblieben. Armstrong gelingt es auch hier, alte Zöpfe abzuschneiden. Die Gruppendynamik eines realen Wolfsrudels projiziert sie geschickt auf ihre Werwölfe, die dadurch als solche dem Leser wesentlich plastischer vor das geistige Auge treten. Für eine Heldin im politisch korrekten, weichgespülten Unterhaltungsroman der Gegenwart ist Elena Michaels erstaunlich unkonventionell geraten. Sie lügt, tötet und geht fremd, ohne sich darüber allzu viele graue Haare wachsen zu lassen; in einer zukünftigen Hollywood-Verfilmung würde dieser Aspekt werwölfischen Wesens garantiert unter den Tisch fallen.
Wie dies besonders für Debütwerke typisch ist, lässt die Handlung gewisse Rückschlüsse auf die Biografie der Verfasserin zu. Kelley Armstrong lebt im ländlichen Südosten des kanadischen Bundesstaates Ontario, wo sie ein ihrer Heldin insofern ähnliches Leben führt, als sie des Tages einem eher unspektakulären Job als Programmiererin nachgeht und erst in der Nacht ihren (schriftstellerischen) Gelüsten frönt. Inzwischen hat die Mutter dreier Kinder Blut geleckt und ihrem Erstling (natürlich) eine Fortsetzung („Stolen“, 2002) folgen lassen; das dritte Elena-Michaels-Abenteuer ist bereits in Arbeit – eine Ankündigung, die aber den lesenden Gruselfreund eher erfreut als erschreckt, was eine angenehme Abwechslung ist.
Der deutsche Nachfolger, „Rückkehr der Wölfin“, ist für November 2004 als Broschur bei |Knaur| angekündigt.
Sara Douglass – Göttin des Sternentanzes, Die (Unter dem Weltenbaum 6)
Band 1: [„Die Sternenbraut“ 577
Band 2: [„Sternenströmers Lied“ 580
Band 3: [„Tanz der Sterne“ 585
Band 4: [„Der Sternenhüter“ 590
Band 5: [„Das Vermächtnis der Sternenbraut“ 599
Der letzte Band des |Weltenbaum|-Zyklus trägt den Titel „Die Göttin des Sternentanzes“, und in ihm entscheidet sich die Zukunft Tencendors.
Aschure ist es gelungen, rechtzeitig zu Axis zu gelangen. Als nächstes macht sie sich zu Faraday auf, doch kaum dreht sie Sigholt den Rücken, geschieht Unfassbares: Gorgrael entführt ihren Sohn Caelum! Kann Aschure ihrem Sohn rechtzeitig zu Hilfe kommen, ohne Faraday im Stich zu lassen?
Faraday hat mit ihrer Pflanzung Smyrdon erreicht, die Hochburg des Pfluggottes Artor. Der neue Wald muss unbedingt mit dem alten Wald von Awarinheim verbunden werden, damit die Bäume Axis in seinem Kampf gegen Gorgrael unterstützen können. Wenn Faraday ihre Aufgabe erfolgreich zu Ende führen will, dann muss Smyrdon weichen. Doch sie trifft auf heftigsten Widerstand!
Axis dagegen ist auf dem Weg zu Gorkenpass, zur letzten entscheidenden Schlacht gegen Gorgraels Heerführer Timozel. Allerdings sind dessen Truppen denen Axis‘ um das Zehnfache überlegen, selbst ohne Greifen. Und Aschure ist nicht bei ihm!
Gorgrael sitzt unsicher in seiner Eisfestung. Er weiß, dass die Prophezeiung Axis über kurz oder lang zu ihm führen wird, er weiß aber auch, dass letztlich die Frage, wer Axis‘ Liebste ist, den Schlüssel zu seinem Sieg oder seiner Niederlage bedeutet. Nur wenn er sie in seiner Gewalt hat, kann er Axis überwinden. Gorgrael muss eine Entscheidung treffen.
Der letzte Band wartet nur noch einmal kurzzeitig mit einer Verwirrung auf, als Caelum entführt wird und der Leser sich fragt, ob wirklich Timozel der in der Prophezeiung genannte Verräter ist. Dann allerdings glättet sich der Handlungsverlauf, was unvermeidlich ist, wenn die Fäden auf das Ende hin zusammengeführt werden sollen. Das Ende ist dann allerdings nicht ganz so spektakulär, wie mancher vielleicht erwarten würde, andererseits zeichnen sich die Kampfbeschreibungen der Autorin onehin eher durch Kürze aus als durch Weitschweifigkeit. Die Spannung ist längst nicht mehr so stark wie in den vorhergehenden Bänden, da die Unsicherheiten, die die vielen Rätsel und Geheimnisse bisher erzeugt haben, nach und nach wegfallen. Spätestens bei der Entscheidung der Awaren ist klar, wie die Sache ausgeht. Danach geht es eigentlich nicht mehr um das „ob“, sondern nur noch um das „wie“. Das „wie“ ist allerdings immer noch interessant zu lesen.
Wer jetzt allerdings glaubt, es seien alle Fragen endgültig beantwortet, der hat sich geirrt. Heißt es doch in der Prophezeiung, Vergebung sei der einzige Weg, Tencendors Seele zu retten. Nun kann man wahrhaftig nicht behaupten, dass Axis Gorgrael vergeben hätte! – Außerdem sind da auch noch alle möglichen Kinder, die im Laufe des Zyklus zur Welt kamen. Caelums Zwillingsgeschwister, von denen der Bruder voll abgrundtiefen Hasses gegen seinen Vater und Caelum erfüllt ist, Faradays Sohn Isfrael und Rivkahs Sohn Zared. Sie alle wurden sicherlich nicht einfach so erwähnt!
Denn eines hat der Gesamtzyklus gezeigt: Die Autorin hat nichts dem Zufall überlassen! Von Anfang an waren alle Handlungsstränge, alle Verwicklungen, alle Wendungen und Vorgänge genau geplant.
Oft ist es so, dass ein Zyklus lediglich eine Aneinanderreihung von kurzen Geschichten darstellt, die sich alle um dieselbe Hauptperson drehen. Das kann man vom Weltenbaumzyklus wahrhaftig nicht behaupten! Sara Douglass hat ein vielschichtiges Handlungsnetz gewoben, dessen Fäden sich ständig kreuzen, sich berühren und wieder trennen, und das ohne sich zu verwirren!
Trotz bereits erwähnter Anlehnungen an Bekanntes hat die Autorin viele eigene Ideen einfließen lassen, die dem Buch zusätzlich zur Spannung und zur Rätselei den Hauch von Zauber verleihen, der eine Fantasy-Welt von der Realität entrückt, darunter die Sache mit dem Rubin am Ring der Herzöge von Ichtar, die Wächter und die Erschaffung des Regenbogenzepters, die Traummagie, die magischen Seen, der Narrenturm …
|Piper| hat die Cover der Bücher diesem etwas romantischen Zug des Zyklus‘ angepasst, und ich finde sie tatsächlich auch sehr schön und gelungen. Die Titel entsprechen dem romantischen Design des Covers, treffen den Inhalt allerdings bei weitem nicht so gut wie die Originaltitel, die man aber schon deshalb nicht einfach übernehmen konnte, weil durch die Aufteilung drei zusätzliche Titel nötig waren. Hier stellt sich noch einmal die Frage, warum man die Bände überhaupt aufgeteilt hat! Wobei: Die Originaltitel hätte man wahrscheinlich trotzdem nicht beibehalten. Wahrscheinlich klangen sie den deutschen Verlagen zu trocken und nicht verkaufsfördernd genug. Und da könnten sie sogar Recht haben.
Alle Bücher enthalten eine Karte von Achar/Tencendor, das Format der Taschenbücher ist allerdings zu klein dafür, sodass man für manche Beschriftungen fast eine Lupe braucht. Außerdem enthalten die Karten der letzten beiden Bände einen Fehler! Hier wird plötzlich der südliche Teil Awarinheims als Bardenmeer bezeichnet. Diesen Namen trägt aber der Wald, den Faraday angepflanzt hat, und der sich jenseits des Verbotenen Tals nach Süden bis zum Wald der Schweigenden Frau erstreckt. Der ist auf der Karte gar nicht eingezeichnet. Wenn man sich aber schon die Mühe macht, die Karte für die letzten beiden Bände der Handlung entsprechend zu ergänzen, dann doch bitte richtig!
Das Lektorat, das im ersten Band noch perfekt war, hat in den Folgebänden dann doch noch ein paar Schnitzer durchgehen lassen, bei knapp 2.500 Seiten hielt es sich aber in vertretbarem Rahmen.
Der |Weltenbaum|-Zyklus ist ein geniales Werk und war zu Recht ein Bestseller. Stellt sich noch die Frage, wie lange es dauern wird, bis die Nachfolgebände erscheinen. Denn wie oben angedeutet, ist die Sache irgendwie noch nicht so ganz ausgestanden.
Unter dem Titel „The Wayfarer Redemption“ ist auf Englisch bereits eine Fortsetzungstrilogie erschienen. Wer nach sechs Bänden also immer noch nicht genug hat, kann mit „Sinner“, „Pilgrim“ und „Crusader“ weitermachen.
Sara Douglass arbeitete zuerst als Krankenschwester, bevor sie ein Studium in historischen Wissenschaften begann. Sie promovierte und arbeitete in den folgenden Jahren als Dozentin für mittelalterliche Geschichte. Das Schreiben fing sie nebenbei an, als Ausgleich zum Stress. Nach dem Erfolg ihres |Weltenbaumzyklus| stieg sie aus ihrem Beruf aus und konzentrierte sich aufs Schreiben und ihren Garten. Sie lebt in einem Cottage in Bendigo/Australien. Außer dem |Weltenbaumzyklus| schrieb sie diverse weitere Romane und Kurzgeschichten.
Johansen, Iris – Und dann der Tod
_Das geschieht (Teil 1: Einleitung)_
Nachdem sie im vom Bürgerkrieg geschüttelten Kroatien Zeugin furchtbarer Gräuel wurde, soll ein ausgedehnter Urlaub der jungen Fotojournalistin Elizabeth Grady die dringend benötigte Erholung bringen. Aus Schaden leider nicht klug geworden, bleibt sie nicht im Paradies auf Erden – den Vereinigten Staaten von Amerika -, sondern reist schon wieder ins Ausland, obwohl ihr wie jedem guten US-Bürger klar sein sollte, dass in der Fremde stets das Böse lauert. Darüber hinaus geht es auch noch nach Mexiko, das seit Pancho Villa selig bekanntlich eine Brutstätte des Chaos, der Korruption und der latinischen Ausschweifungen ist.
Elizabeth wird begleitet von ihrer älteren Schwester Emily, einer erfolgreichen Chirurgin, die selbst ein wenig Ruhe vertragen kann. Dass Tenajo, ein Dörflein tief und abgelegen im mexikanischen Hinterland, schwerlich die richtige Wahl als Ferienort war, wird den Schwestern klar, als sie bereits hinter dem Ortsschild die erste Leiche finden. Aber das ist nur der Anfang: Auf den Straßen, in den Häusern liegen die Bürger, wie sie ein unsichtbares Verhängnis dahingerafft hat. Elizabeth und Emily reagieren politisch korrekt: Geschockt aber pflichtbewusst suchen sie die Totenstadt nach Überlebenden ab und finden tatsächlich ein gesund gebliebenes Baby!
_Das geschieht (Teil 2: Die Jungfrau, der Drache & der Ritter)_
Da keine gute Tat auf dieser Welt unbestraft bleibt, naht nunmehr hakennasig das Böse in Gestalt des verbrecherischen Colonels Esteban. Tenajo und seine ahnungslosen Bewohner sind (bzw. waren) Schauplatz eines unmenschlichen Experiments, bei dem Terroristen (dieses Mal aus Libyen) eine neue Bio-Waffe testen wollten. Dumm gelaufen, dass sich ausgerechnet in diese Einöde zwei Gringas verirrten! Da diese außerdem aus den USA stammen, duckt sich Esteban (der gerade kalt lächelnd ein paar Dutzend Landsleute über die Klinge hat springen lassen), als Uncle Sams Schatten ihn trifft. Er ruft seinen psychopathischen Killer Kaldak und lässt Elizabeth gefangen nehmen, während Emily spurlos verschwindet.
Esteban wartet, bis Elizabeth durch Drogen und Drohungen außer Gefecht gesetzt ist. Dann taucht er an ihrem Krankenbett auf, wo er mit seinen Schandtaten prahlt und als Engel des Todes bewundert werden möchte. Haha, aber nicht mit den Girls aus Michigan! Elizabeth zieht Esteban eins mit der Bettpfanne über, nur der zufällig auftauchende Kaldak rettet seinen Chef. Dem steht ob der Demütigung der Schaum vorm Mund. Feigling, der er ist, fordert er Kaldak auf, seine Gefangene hübsch langsam und qualvoll zu Tode zu bringen und ihm anschließend davon zu erzählen; er selbst traut sich nicht einmal an die gefesselte Elizabeth mehr heran.
Die wird ausgerechnet vom finsteren Kaldak aus dem Gefängnis geschmuggelt (und kann dabei noch das Baby retten). Zwar muss sie beobachten, wie er dabei ein paar Hälse bricht, aber das ist unwichtig, als Kaldak verkündet: „‚Ich arbeite seit ein paar Jahren für die CIA.'“ Plötzlich ist Elizabeth fast schon wieder zu Hause: |“Sie fühlte sich erleichtert. ‚Das hätten sie mir doch gleich sagen können.'“|
_Das geschieht (Teil 3: Triumph der Gerechtigkeit)_
Nun flüchtet man gemeinsam durch den Tropenwald, verfolgt vom wütenden Esteban und seinen tumben Schergen, die dort nicht einmal einen Elefanten finden könnten, geschweige denn eine amerikanische Bürgerin, die gerade ihr Waldläuferblut wiederentdeckt hat. Also entkommen die Schöne und das Biest, um daheim Pläne zu schmieden, a) Emily zu retten, b) die Welt = die USA vor einem terroristischen Giftanschlag zu bewahren, und c) Emily zu retten. (Elizabeth ist da sehr hartnäckig). Wie es sich für eine echte Demokratie gehört, arbeitet der US-Geheimdienst dabei eng und offen mit Elizabeth, einer besorgten Bürgerin & Steuerzahlerin zusammen. Und da Kaldak jetzt als einer der Guten identifiziert ist, findet Elizabeth ihn plötzlich auf aufregend verbotene Weise attraktiv …
|Papier ist geduldig, der Leser hoffentlich nicht|
Mit „Und dann der Tod“ begründet Iris Johansen ein Subgenre des modernen Thrillers: die Action-Schmonzette. Mit diesem Schöpfungsakt ist die kreative Kraft der Autorin aber sichtlich verpufft; was folgt, ist eine inhaltlich wie formal plump zusammengebolzte Story ohne Sinn, Verstand und Profil. Man fühlt sich in eine dieser billigen ‚Weltpremieren‘ des deutschen Privatfernsehens versetzt („Rette Deine Schwester und die Welt! – Todesschreie aus dem Virencamp“). Die Liste der Dinge, die erst stören und dann ärgern, ist schier endlos und geht über die penetranten US-Hurra-Patriotismen weit hinaus.
Bereits die ‚Entwicklung‘ der an sich schon wenig innovativen Ausgangsidee ist eine starkes (bzw. schwaches) Stück. Im zweiten Drittel bricht die Handlung sogar völlig zusammen und irrt endlos im Leerlauf umher, weil sich der schändliche Esteban nicht über die Grenze in die USA traut – er würde sich wahrscheinlich wie ein Vampir in Staub auflösen -, seine Opfer mit albernem Telefonterror und Halloween-Scherzchen piesackt und ihnen den dämlichsten Killer der Welt auf den Hals schickt.
Zumindest Elizabeth und Kaldak benötigen diese Pause, denn sie sollen sich ja nach dem Willen der Autorin näher kommen, und das braucht seine Zeit. Schließlich ist Elizabeth eine moderne und selbstbewusste Frau, die nur einen echten Traumprinzen an sich heranlässt! Freilich gleicht das uralte menschliche Balzritual deshalb eher einem scharfen Kreuzverhör, was jegliche Romantik nachhaltig verfliegen lässt.
|Die Lady Gaga des Thriller-Genres|
Was uns zur Figurenzeichnung bringt, der eigentlichen Achillesferse der Autorin. Elizabeth Grady erreicht auf jeder Nervensägen-Skala dieser Welt absolute Spitzenwerte. Schon die hysterische Naivität, mit der sie auf das Drama reagiert, das sich um sie herum abspielt – |“Das dürfen Sie nicht! Lassen Sie das! Wo ist der amerikanische Botschafter?“| – reizt noch den nachsichtigsten Leser zur Weißglut.
Als Romanfigur ist Elizabeth Grady jedoch auch sonst eine Zumutung. Wo sie geht und steht, markiert sie das tapfere Cowgirl, das dem bösen Feind quasi reflexartig die Stirn bietet, ihm ständig empört flammende Reden ob seiner Sündhaftigkeit hält, um dann als Rambo & Ripley in Personalunion und mit einem heldenhaft geretteten Eingeborenenbaby auf dem Arm den Verfolgern und den Unbilden der Natur zu trotzen (und vermutlich unterwegs noch achtlos im Wald fortgeworfenes Bonbonpapier aufliest).
Unbarmherzig sitzt sie später den eigenen Jungs (Army/Navy/Air Force, Geheimdienst etc.) im Nacken und erinnert sie in jedem Satz mindestens zweimal an ihre patriotischen Pflichten – und zum Teufel mit den Hoheitsrechten irgendwelcher sowieso unterentwickelter Dritte-Welt-Operettenstaaten, wenn dort ein US-Bürger in Gefahr schwebt!
Ärgerliche Banalitäten dieser Art ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Geschichte. Kaldak, der als un- und übermenschliche Mordmaschine eingeführt wird, degeneriert bald zum netten Teddybären, der nur die Bösen killt (und auch die nicht gern), kleine Kinder liebt und nach dem Essen das Geschirr abspült. Kein Wunder, dass ihn die spießige Elizabeth prompt anhimmelt, sobald er sich als CIA-Agent und damit als einer der ‚Guten‘ entpuppt! Merke: Töten ist o. k., solange es nur terroristisches Gezücht aus dem Ausland trifft, denn dann ist es gerechte Strafe!
Schurken mit der Tendenz zum Todlachen
Über Esteban und seine Handlanger muss erst recht kein Wort verloren werden. Sie sind gnadenlos überzeichnet und als Bösewichte etwa so überzeugend und Furcht erregend wie der Räuber Hotzenplotz: Da hat die Große Terroristische Geißel im Hintergrund sieben Jahre (!) am Giftgas-Krieg gegen die USA getüftelt – und alles, was dabei herauskommt, sind ein paar Anschläge auf Hinterwäldler-Nester im Nirgendwo, durchgeführt von einer Bande Trottel, denen ein durchgeknallter Psychopath vorsteht, der für die Rache an einer neurotischen Weltverbesserin den ‚genialen‘ Plan aufs Spiel setzt. Wenn dies die Realität widerspiegeln sollte, wissen wir jetzt, wieso Saddam, Muammar, Fidel & Co nie ein Bein auf die Erde jenseits der Grenzen ihrer privaten Königreiche bekommen haben.
Im letzten Drittel wird’s einfach grotesk. Johansen schreckt nicht dafür zurück, Elizabeth Gradys traumatische Erlebnisse in Kroatien mit dem Tenajo/New Orleans-Handlungsstrang zu verknüpfen. Dies soll wohl die erschreckende Vision eines weltweiten Komplotts heraufbeschwören, wirkt aber einfach nur lächerlich, weil es so dilettantisch umgesetzt wird. Das eigentliche Grauen scheint für Elizabeth ohnehin darin zu liegen, dass sie ihr Prinz trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch aufs Kreuz gelegt hat. (Dies bitte ruhig zweideutig verstehen.) Heulend aber ungebrochen nimmt sie es nunmehr eben allein mit dem Reich des Bösen auf.
Zum großen Finale ist Kaldak rechtzeitig wieder da, um sich als Buße für sein chauvinistisches Tun eine Kugel einzufangen, die eigentlich für Elizabeth bestimmt war. Es dürfte ihm nicht schwer gefallen sein, sie und den schließlich doch in die USA geschlichenen Esteban zu finden, hat dieses Genie des Bösen sein Hauptquartier doch ausgerechnet in einer Windmühle aufgeschlagen …
Hiermit soll es genug sein. Was Iris Johansen und ihre Thriller immer wieder |“auf die obersten Plätze der Bestsellerlisten“| bringt, wie es im Klappentext vollmundig heißt, ist angesichts dieses Machwerks ein Rätsel – es sei denn, dass sich außer den sprichwörtlichen Fliegen auch ein paar Millionen Leser nicht irren können …
|Taschenbuch: 366 Seiten
Originaltitel: And Then You Die … (New York : Bantam Books 1998)
Übersetzung: Norbert Möllemann
ISBN-13: 978-3-548-25451-7|
[Autorenhomepage]http://www.irisjohansen.com
[Verlagshomepage]http://www.ullsteinbuchverlage.de
(Michael Drewniok)
Ursula Spuler-Stegemann (Hrsg.) – Feindbild Christentum im Islam. Eine Bestandsaufnahme
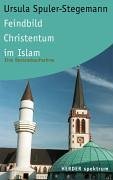
Ursula Spuler-Stegemann (Hrsg.) – Feindbild Christentum im Islam. Eine Bestandsaufnahme weiterlesen
Feindbild Christentum im Islam
Die „Feindbild Christentum im Islam“ herausgebende Professorin lehrt Islamwissenschaften an der Universität Marburg und hatte zuvor bereits mit „Muslime in Deutschland“ das wohl beste Werk über die ausländischen Islam-Angehörigen in unserem Land vorgelegt. In diesem Band hat sie nun eine ganze Reihe von Fachleuten versammelt, die sich dem interreligiösen Dialog widmen, der seit dem 11. September 2001 mit größerem Interesse als zuvor in der Bevölkerung wahrgenommen und beobachtet wird.
Der Islam ist aufgrund des Terrorismus ein Feindbild geworden, aber dies gilt seit dem Einmarsch von George W. Bush in Afghanistan und dem Irak auch umgekehrt. Die Muslime fühlen sich – nicht einmal zu Unrecht – vom Christentum bedroht. Die im Sammelband vertreten Ansichten sind sehr unterschiedlich, aber es zeichnet sich durchweg eine kritischere Betrachtung und Einschätzung des Dialoges zwischen den Kulturen ab, als dies gegenwärtig stattfindet. Vor allem die evangelische Kirche, welche seit Anfang der achtziger Jahre den Dialog aufgrund der „islamischen Revolution“ im Iran vorantreibt, geht sehr realitätsfremd mit den Wirklichkeiten um. Blauäugig wird alles ausgeklammert, was Konflikte darstellen würde. Der Dialog ist sehr einseitig, denn die Christen beginnen in unserer Zeit eigentlich erst mit dem Dialog. Für die Muslime ist dieser längst abgeschlossen und wurde schon im Koran geführt.
Demnach sind Christen wie Juden zwar durchaus Anhänger des „Buches“ und stehen in der Tradition der Gottesgläubigen, aber dennoch sind sie auch zu verurteilende Ungläubige. Nur in der Anfangszeit Mohameds war dieser christenfreundlich, da die christlichen Gemeinden, mit denen er in direktem Kontakt stand, seine Lehre sogar als eine christliche Splittergruppe einstuften. In späteren Zeiten Mohameds galten Christen aber bald als die gleichen Ungläubigen wie Juden und Heiden. Ein gläubiger Moslem ist nicht bereit, sich auf eine Wahrheit im Christentum einzulassen. Auch ist es nicht erlaubt, mit Christen zu verkehren, außer im Sinne der Missionierung. Und der Dialog gilt im Islam als Missionierung. Dies betrifft nicht die Gestalt Jesus selbst, dieser gilt als Prophet (der nicht am Kreuz gestorben sei und schon gar nicht Gottes Sohn sein konnte) und er ist auch tatsächlich im Koran derjenige, welcher am Ende aller Zeiten kommen wird, um zu richten. Trotz dieser Tatsachen lehnen die Autoren den Dialog nicht ab. Zwar ist kein wirklicher Dialog möglich, solange jede monotheistische Religion fundamentalistisch die eigene als alleinig Gültige betrachtet – aber deswegen nicht zu kommunizieren, empfinden auch sie dennoch als den „verkehrteren“ Weg.
Konflikte und Tabus dürfen dann aber nicht – wie es der Fall ist – ausgeklammert bleiben. Die Evangelisten unterstützen viel Islamisches und sehen nicht, dass umgekehrt nichts Derartiges vonstatten geht. Wenn man einen Dialog führt, muss geprüft werden, ob beide Seiten unter den benutzten Begriffen überhaupt das Gleiche verstehen, z. B. der Begriff „Frieden“ ist bei uns mit Harmonie und Gewaltlosigkeit und Abwesenheit von Kriegen verbunden. Wenn Islamisten von „Frieden“ sprechen, meinen sie damit allerdings etwas ganz Anderes, nämlich die Ausweitung des Islams auf die ganze Welt. Im bisherigen Dialog werden von muslimischer Seite nur Anklagen und Forderungen erhoben. Die deutschen Protestanten akzeptieren das widerstandslos aus ihren Schuldgefühlen heraus, aufgrund ihrer Rolle im „Dritten Reich“. Nie wieder will man andere Religionen diskriminieren. Ein wenig Angst vor Machtverlust spielt sicherlich auch eine Rolle. Wenn nämlich der Anspruch des organisierten Islam, alle Muslime im Rahmen einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu vertreten, zurückgewiesen wird, bliebe das im Sinne der Gleichbehandlung nicht ohne Folgen für die Kirchen. Wer den Monopolanspruch der orthodoxen Muslime bestreitet, gefährdet das entsprechende christliche Monopol.
Kaum beachtet werden die vielen unterschiedlichen Strömungen des Islams. Man unterscheidet weder die Hauptgruppen der Sunniten und Schiiten noch die diversen Strömungen letzterer Gruppierung und begreift auch nicht, dass ein islamischer Religionsunterricht in den deutschen Schulen schon aus diesen Unterschieden heraus überhaupt nicht möglich ist. Der Dialog wird gnadenlos durchgezogen, ohne die Möglichkeiten der Information über die Personen und Organisationen, die sie vertreten, zu nutzen. Alles, was den Dialog behindert könnte, wird ganz bewusst übersehen und eliminiert. Es kann aber doch nicht wirklich die Aufgabe christlicher Pfarrer sein, dafür zu sorgen, dass Moscheen errichtet werden. Islamisten dürfen in christlichen Kirchen predigen, umgekehrt findet so etwas nicht statt.
Verhandelt wird mit Organisationen, die als zwei verschiedene Zentralräte der Muslime in Deutschland auftreten, aber diese als solche anzuerkennen, ist eigentlich realitätsfern. Denn beide vertreten Minderheiten (nach Schätzung nur drei bis fünf Prozent) und stehen nicht für die Mehrheit der islamischen Glaubensbewegungen der in Deutschland lebende Muslime. Und eine ganze Reihe dieser dem Zentralrat angehörenden Gruppen, mit denen man kritiklos interkulturelle Aktionswochen zelebriert, wird vom Verfassungsschutz beobachtet und wie beispielsweise „Milli Görüs“ als rechtsradikal eingestuft. Man kann nicht – wie vertreten wird – die Menschenrechte und die Behandlung der Christen in islamischen Ländern ausklammern, diese Betrachtungsweise gehört zum Dialog.
Und da sieht es überall düster aus – von wenigen Lichtblicken abgesehen. Erstaunlicherweise werden im einzigen Staat mit islamischer Verfassung – dem Iran – andere Religionen anerkannt und diese können sogar Vertreter in die Regierung entsenden. Saudi Arabien bezieht sich in seiner Verfassung auch auf den Islam, aber mit dem Iran ist diese nicht vergleichbar. Dort ist wie in den meisten arabischen Ländern die Situation der Christen die einer in ständiger Gefahr befindlichen Minderheit. Wenige Lichtblicke gibt es in Ägypten, wo der Islam mit den koptischen Christen tatsächlich im Austausch und in gegenseitiger Anerkennung existiert.
Das Buch bietet sehr interessantes Wissen über die unterschiedliche Situation in islamischen Ländern, die man kennen sollte. Den christlich-islamischen Dialog aufgrund dieses Wissens zu verwerfen, wäre dennoch nichts anderes als Propaganda für den als unvermeidlich hingestellten Kampf der Kulturen. Aber wir brauchen dafür keine interreligiösen Schmusestunden und auch keinen Austausch von Beweihräucherungen oder verlogenen Zusicherungen des guten Willens. Ehrlichkeit gibt es nur, wenn man ohne Selbstzensur, ohne Tabus und ohne Duckmäuserei miteinander reden kann.
_Ursula Spuler-Stegemann (Hrsg.)
[„Feindbild Christentum im Islam. Eine Bestandsaufnahme“]http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/345105437X/powermetalde-21
189 Seiten, TB
|HERDER spektrum|
Januar 2004
ISBN 3-451-05437-X _
Strobl, Karl Hans – HR Giger\’s Vampirric 3 – Das Grabmal auf dem Père Lachaise
HR Gigers Anthologie von Vampirgeschichten, die 2003 bei Festa unter dem Titel „HR Giger’s Vampirric“ erschienen ist, erlebt in Auszügen eine Neuauflage in vier Hörbüchern. Auf dem dritten Hörbuch findet sich Karl Hans Strobls Vampirerzählung „Das Grabmahl auf dem Père Lachaise“ – das Tagebuch eines Hunger leidenden Naturwissenschaftlers, der ein Jahr in einem Mausoleum auf eben jenem Pariser Friedhof zubringen will.
Ernest erfüllt das Testament einer offensichtlich übermäßig exzentrischen Russin. Diese Anna Feodorowna Wassilska hat nämlich verfügen lassen, dass derjenige zweimal 100.000 Franc erhält, der ein Jahr in ihrem Grabmahl zubringt. Ernest beschließt, dieses Jahr zur Beendigung seines Opus Magnus zu nutzen, mit dem er unsterblichen Ruhm in der Welt der Wissenschaft zu erringen sucht. Doch natürlich lockt den armen Privatgelehrten auch das Geld, mit dem er seiner Freundin Margot ein Leben in Sorglosigkeit bescheren könnte. Und die zwei üppigen Mahlzeiten, die ihm der einzige Diener der Wassilska – ein pockennarbiger Tatar namens Iwan – auf einem Wägelchen vorbeibringt, sind auch nicht zu verachten.
Ernest fragt sich immerhin, was diese außergewöhnliche Russin, die er nicht persönlich kennen gelernt hat, mit dieser seltsamen Verfügung bezwecken wollte. Jemanden in der Nähe zu haben, falls sie lebendig begraben wurde? Ein Schutz vor Grabräubern? Oder die sadistische Befriedigung zu wissen, wie sich jemand ein Jahr lang auf einem Friedhof quält? Diese Möglichkeit scheint Ernest am wahrscheinlichsten, nach allem, was er über die Wassilska in Erfahrung bringen konnte. Eine sinnenfrohe Frau aus der weiten Ferne Russlands, die in Paris offensichtlich Vergnügen und das Absonderliche suchte und auch nicht davor zurückschrecke, dem Bäckerlehrling Geld zu bieten, um ihn beißen zu dürfen. Spätestens hier schrillen bei Horrorkennern die Alarmglocken, doch Ernest ist ein zu treuer Naturwissenschaftler, als dass er sich von solchen Geschichten beunruhigen lassen würde. Er schwört, die Zeit im Grabmahl sinnvoll zu nutzen und sich von absonderlichen Begebenheiten nicht schrecken zu lassen.
Und tatsächlich schwant dem Hörer bald, dass im Grabmahl der Wassilska nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Die Zettel, die Ernest als Denkhilfen für sein Buch ordentlich sortiert hat, werden des nächtens im ganzen Grabmahl verstreut. Außerdem machen ihn das üppige Essen und die mangelnde Bewegung so fett, dass er in einem Augenblick der Klarheit erkennt, dass er wie eine Gans gemästet wird. Doch das Seltsamste ist wohl das grüne Licht, das sich Nacht für Nacht einstellt und den Marmor des Grabmahls weich macht.
Doch anstatt sich vor solchen Erscheinungen zu fürchten, lässt sich Ernest von Iwan Gerätschaften und Prismen bringen, um das Licht zu untersuchen. Eines Morgens jedoch findet er unter seiner auf einem Notizzettel notierten Frage nach der Natur dieses seltsamen Lichts die Antwort: „Es ist der Atem der Katechana“ – in seiner eigenen Handschrift. Halb wahnsinnig von dem Gedanken herauszufinden, was hier gespielt wird, bombardiert er Iwan mit Fragen nach dem unbekannten Begriff, während Margot immer öfter sein Grabmahl heimsucht, um ihn zum Abbruch dieses Jahres zu bewegen. Doch es kommt, wie es kommen muss. Ernest stellt fest, dass es sich bei der Wassilska um einen Vampir handelt, der nun jede Nacht in wilden Küssen über ihn herfällt und das Blut aus seinen fetten Adern saugt. Er lauert ihr auf, um sie zu vernichten… Doch bleibt der Hörer ohne letzte Gewissheit zurück: Ist Ernest tatsächlich wahnsinnig? Bildet er sich die Vampirin Wassilska nur ein? Oder handet es sich tatsächlich um eine Untote und tat Ernest das einzig Richtige?
Der Österreicher Karl Hans Strobl (1877- 1946) zählt zusammen mit Hanns Heinz Ewers zu den bedeutendsten Autoren deutscher Phantastik zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Neben dem „Grabmahl auf dem Père Lachaise“ verfasste er mit „Das Aderlassmännchen“ noch eine weitere Vampirgeschichte, die in ihrer Komposition jedoch komplizierter als „Das Grabmahl auf dem Pere Lachaise“ ist. Strobls Erzählung ist innerhalb der Hörbuchreihe „HR Giger’s Vampirric“ ein wahrhaftes Highlight, wozu auch der Sprecher David Nathan – unter anderem als die deutsche Stimme von Johnny Depp bekannt („Savvy?“) – viel beiträgt. Nathan gibt der tagebuchartigen Erzählung Ernests Charaktertiefe. Auf der einen Seite ist er der forschungswütige, überspannte und an leichter Überschätzung leidende Physiker. Dann wieder ist er der geldgeile Egoist, der die Absonderlichkeit des Testaments der Wassilska erfolgreich verdrängt, um am Ende des Jahre die ausgesetzte Unsumme und täglich zwei warme Mahlzeiten zu kassieren. Und gegen Ende der Erzählung scheint durch Nathans Interpretation auch deutlich Ernests zunehmender Wahnsinn durch – gerade hier kann David Nathan brillieren und dem Zuhörer mit Leichtigkeit Schauer über den Rücken laufen lassen.
Wirklich unheimlich und gruslig wird Strobls Erzählung erst gegen Ende. Bis dahin resultiert das Gefühl des Unwohlseins beim Hörer hauptsächlich aus dem ungewöhnlichen Setting und den seltsamen Begebenheiten, denen Ernest aber mit positivistischer Einstellung gegenübertritt. Diesen subtilen Grusel jedoch kann Strobl über die gesamte Erzählung hinweg aufrechterhalten, sodass „Das Grabmahl auf dem Père Lachaise“ keine Längen aufweist und konstant Spannung erzeugt wird. Dieser Teil der „Vampirric“-Reihe ist definitiv der Höhepunkt der vier Hörbücher. Daher heißt es: Kaufen, kaufen, kaufen!
Alle vier Hörbücher im Überblick:
[HR Giger’s Vampirric 1: 581
Thomas Ligotti „Die verloren gegangene Kunst des Zwielichts“ und
Horacio Quiroga „Das Federkissen“
[HR Giger’s Vampirric 2: 582
Leonard Stein „Der Vampyr“ und
Amelia Reynolds Long „Der Untote“
HR Giger’s Vampirric 3:
Karl Hans Strobl „Das Grabmahl auf dem Père Lachaise“
[HR Giger’s Vampirric 4: 584
Guy de Maupassant „Der Horla“
Jeffery Deaver – Der faule Henker [Lincoln Rhyme/Amelia Sachs 5]
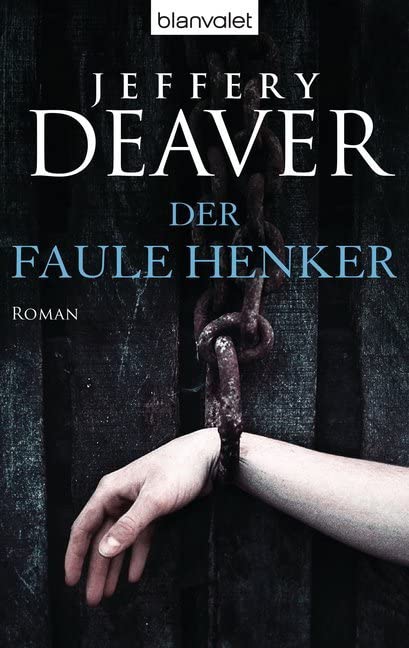
Sara Douglass – Vermächtnis der Sternenbraut, Das (Unter dem Weltenbaum 5)
Band 1: [„Die Sternenbraut“ 577
Band 2: [„Sternenströmers Lied“ 580
Band 3: [„Tanz der Sterne“ 585
Band 4: [„Der Sternenhüter“ 590
Der fünfte Band des Weltenbaum-Zyklus, „Das Vermächtnis der Sternenbraut“, endet noch einmal aprupt mitten im Geschehen.
Faraday ist zutiefst gekränkt, dass Axis sie mit Aschure betrogen hat, erkennt aber auch, wie tief die beiden miteinander verbunden sind. Sie gibt Axis frei, Aschure zu heiraten, und verlässt Karlon, um ihren Anteil an der Prophezeiung zu erfüllen: Sie macht sich auf, den Wald von Tencendor neu anzupflanzen. Dabei erhält sie unerwartete Hilfe, aber auch Gefahr folgt ihr auf dem Fuß …
Axis erhält derweil Nachricht, dass Gorgraels Truppen seine Stellung in Jervois überrannt haben und nach Süden marschieren. Sofort setzt er seine eigenen Truppen in Marsch, um dem Feind zu begegnen. Doch er kann eine verheerende Niederlage nur durch den massiven Einsatz von Magie verhindern, einen Einsatz, der einen schrecklichen Preis fordert.
Aschure hält sich in der Zwischenzeit im Sternentempel auf, einem Heiligtum der Ikarier auf der Insel des Nebels und der Erinnerung. Dort enthüllt sich ihr nicht nur das Geheimnis um ihre Herkunft, sondern auch das um ihre Bestimmung. Dann erreicht sie die Nachricht von Axis‘ Schlacht, und ihr wird klar, dass sie sofort zu ihm reisen muss. Allerdings ist Axis nicht der Einzige, der ihre Hilfe braucht. Aschure muss sich beeilen …
Was die Entwicklung der Personen angeht, so scheint diese bei Aschure inzwischen ziemlich abgeschlossen. Es ist klar, woher sie kam und wohin sie geht, das Ziel muss nur noch erreicht werden.
Anders sieht es bei Axis aus. Er weiß, dass die Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, nicht ausreichen, um Gorgrael zu besiegen, und der Rückschlag in der letzten Schlacht macht seine Selbstzweifel noch schlimmer. Ihm fehlt noch ein entscheidender Schritt …
Faraday hingegen scheint im Gegensatz zu Axis und Aschure keine Probleme mit sich selbst zu haben, obwohl sie weiß, dass ihr noch viel bevorsteht. Abgesehen von ihrer Enttäuschung mit Axis scheint sie ausgeglichen.
Timozel dagegen ist inzwischen ganz in den Klauen Gorgraels und macht nicht einmal mehr den Versuch, sich dem zu entziehen. Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem bleibt ein Gefühl von Endgültigkeit aus. Vielleicht ist er ja doch noch für eine Überraschung gut?
Die Handlung hat ihre Spielebene ungeheuer ausgeweitet. Nach der Niederlage Bornhelds und der Zerschlagung des Seneschalls schien es kurz, als seien von den drei Parteien, von denen jede allen anderen feindlich gegenüberstand, nur noch zwei übrig. Stattdessen hat das Geschehen lediglich eine neue Tür geöffnet, durch die ein anderer auf den Plan getreten ist, um das Dreieck wieder komplett zu machen. Was als Bruderzwist zwischen Axis und Bornheld begann und als Rettung der Welt vor völliger Vernichtung weiterging, ist inzwischen bei einem Kampf angelangt, in den selbst die Götter verstrickt sind.
So stellt sich im Verlauf der Ereignisse die Prophezeiung zunehmend als Gratwanderung heraus, in der der Prophet nur mit Mühe die Balance halten kann. Gorgrael scheint sich der Kontrolle des Dunklen zunehmend zu entziehen, die Awaren lehnen Aschure nach wie vor ab, und Artor, der Gott des Pfluges, versucht, Faraday am Bäumepflanzen zu hindern. Die Lage spitzt sich zu.
Abgesehen vom Spannungsbogen der eigentlichen Handlung, der sich immer straffer spannt, weiß die Autorin jedes gelöste Rätsel durch ein neues zu ersetzen. Hat man sich in den vorigen Bänden noch den Kopf zerbrochen, was es wohl mit Aschure auf sich hat und wer Axis wohl verraten wird, fragt man sich inzwischen, was für eine seltsame Verwandlung mit den Wächtern vor sich geht und welchem Zweck sie dienen mag, oder was es mit dem geheimnisvollen Regenbogenzepter auf sich haben wird. Überhaupt ist die letzte Strophe der Prophezeiung noch längst nicht klar …
Es bleibt also noch genug Stoff für den letzten Band, sodass nicht zu befürchten steht, es jetzt nur noch mit einer einzigen großen Schlacht zu tun zu haben, zumal es fraglich ist, ob die Entscheidung zwischen Gorgrael und Axis durch eine Schlacht gefällt wird. Eigentlich erscheint eine solche Lösung zu plump angesichts der vielen feinen Fäden, in denen die Autorin bisher ihre Handlung gesponnen hat. Nun, in einigen hundert Seiten werden wir es wissen …
Sara Douglass arbeitete zuerst als Krankenschwester, bevor sie ein Studium in historischen Wissenschaften begann. Sie promovierte und arbeitete in den folgenden Jahren als Dozentin für mittelalterliche Geschichte. Das Schreiben fing sie nebenbei an, als Ausgleich zum Stress. Nach dem Erfolg ihres |Weltenbaumzyklus| stieg sie aus ihrem Beruf aus und konzentrierte sich aufs Schreiben und ihren Garten. Sie lebt in einem Cottage in Bendigo/Australien. Außer dem |Weltenbaumzyklus| schrieb sie diverse weitere Romane und Kurzgeschichten.
Jess Walter – Stummes Echo
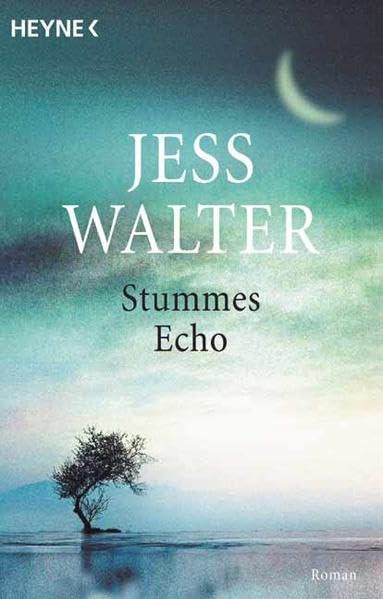
Terhart, Franjo – Schatz der Tempelritter, Der
Terhart ist einer der jüngeren Tempelritter- und Katharerforscher und legt zu diesem Thema sein zweites Buch nach [„Die Wächter des Heiligen Gral“]http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3404701828/powermetalde-21 (2001) vor. Augenfällig ist gleich, dass sein Folgeband nicht mehr zuerst als Hardcover erschienen ist. Der interessierte Leser kann darüber viel spekulieren. Beispielsweise wäre es nahe liegend, dass bei all der Fülle an Publikationen in den letzten Jahren das Interesse einfach nachlässt, weil nichts wirklich Neues mehr dazukommt. Andererseits halte ich es für wahrscheinlicher, dass der Verlag sich zu Recht für das Taschenbuch-Original entschied, weil der Inhalt eigentlich mehr wie ein Überbleibsel gestrichenen Materials aus dem ersten Band erscheint. Im Grunde wäre das Meiste Stoff für einen umfangreichen Anmerkungsanhang gewesen. Aufgrund ursprünglicher Kürzungen scheint nun einfach ein Folgeband nachgeschoben. Akribisch werden darin alle Plätze und Vermutungen, wo sich der verschwundene Templerschatz befinden könnte, aufgezeigt. Durchaus eine Leistung, aber interessiert das noch wirklich den zeitgenössischen Gralsforscher, der vor einigen Jahren durch die Veröffentlichungen der englischen Autoren Baigent und Leigh mit den Enthüllungen um den geheimnisvollen Blutslinien-Orden Jesu („Prioré de Sion“) auf sensationelle Weise einmal mehr auf die Katharergeheimnisse aufmerksam gemacht wurde?
Um das Buch nicht ganz zu schmälern: Sicherlich finden sich überall versteckt neue kleine Puzzle-Stücke, die das Gesamtbild komplettieren und die zu erfahren sich lohnt. Dafür ist aus Preisgründen eine Taschenbuchausgabe geradezu gerechtfertigt. Recht interessant sind Verknüpfungen zum alten Pilgerweg nach Santiago de Compostela in Bezug auf die Schatzsuche. Neu geschrieben – also nicht als Anmerkungen für den vorhergehenden Band zu betrachten – ist die Auseinandersetzung mit dem Kult der abgeschnittenen Köpfe. Aber diese scheint in der Hauptsache eine Zusammenfassung des 1999 erschienenen Buches „Das Haupt Gottes“ von Keith Laidler zu sein, welche nur noch um wenige eigene Vermutungen ergänzt wird.
Leider ist noch keiner der Autoren, die sich mit dem Baphomet-Kopf und den Kopf-Riten alter Völker befassen, auf die Idee gekommen, dies mit den Geschichten um die geheimnisvollen Kristallschädel aus dem indianischen Kulturkreis in Verbindung zu setzen. Meines Erachtens wäre das eine sehr lohnenswerte Sache, die ebenso Spektakuläres an den Tag bringen wird wie einst die ersten Enthüllungen über die „Prioré de Sion“. Auch die Kristallschädel stammen aus matriarchal-religiösen Überlieferungen und das Wissen darüber wird heute noch von „Großmütter“-Zusammenkünften gehütet, was zu den neueren Thesen – welche auch Terhart im vorliegenden Buch vervollständigt – passt, die besagen, dass die Templer mit ihrem Marienkult auf alte Göttinnenverehrung zurückgreifen, die über die ägyptische Isis weiter zum Stamm der Benjamiten (welche, während Moses die Gesetzestafeln erhielt, unten ums Goldene Kalb tanzten) führte, und dass auch Maria dieser Stammeslinie zugehörig war. Jedenfalls bleibt die Sache mysteriös und die Zusammenhänge werden dennoch immer besser ersichtlich, so auch zur Bundeslade, welche zur Zeit König Davids zur geheimnisvollen Königin von Saaba wechselte (worüber die Freimaurer in ihrem Hiram-Abif-Mythos – „Sohn der Witwe“, gleichzeitig auch wieder ein Kopfkult – noch heutzutage geheimes Wissen überliefern).
Auf alle Verknotungen einzugehen, die in diesem Buch wieder und wieder aufbereitet werden, wäre zu mühsam. Deswegen nur noch einige Highlights, z. B. der „Sternenweg“ nach Compostela im Zusammenhang zu Sirius und der Priesterschaft Johannes des Täufers, die in eine geistige Linie zu Seth, Typhon, dem Schlangengott, Lucifer, Johannes und Jesus gestellt wird. Oder die Überlieferungen der Sinti und Roma, die noch heute zu Sara Kali beten, einer Tochter von Jesu, die mit Maria Magdalena überlebt habe und über Ägypten nach Frankreich geflohen sei. Maria Magdalena selbst ist in diesen Darstellungen die große Hure Babylons und ihre Priester waren Sexualmagier bis hin zu Johannes, der Simon Magus, den bedeutenden gnostischen Magier mit seiner Gefährtin Helena – ein Pendant zu Jesus und Maria – als Schüler hatte. Simon Magus brachte das überlieferte Wissen nach Irland, nach keltischen Legenden zum Hochdruiden Mog Ruith und der Inhalt dieses Wissen zeigt wiederum deutliche Parallelen auf zum indianischen Medizinrad und den dortigen Schädeln. Doch wie gesagt, darüber steht leider nichts im Buch.
Deutlich bleibt nach der Lektüre jedenfalls die Sichtweise, dass es um Göttinnenwissen geht, dass Maria-Jesus immer wieder archetypisch wiederkehrende Vorbilder in den alten religiösen Legenden haben, und dass es um das Wissen um die Schöpfungsursache geht und damit um Sexualmagie im gnostisch-philosophischen Sinne, die aufgrund der Vereinigung vorhandener Polaritäten diese überhaupt erst bewirkt.
McCollum, Michael – Antares-Krieg, Der
„Der Antares-Krieg“ vereint Michael McCollums Antares-Trilogie mit ihren Romanen „Antares: Dämmerung“, „Antares: Passage“ und „Antares: Sieg“ in einem 909-seitigen Sammelband.
Zwischen den ersten beiden Bänden (1986/87) und dem abschließenden Finale der Trilogie (2002) klafft eine große zeitliche Lücke, der Roman „Antares: Victory“ ist übersetzt deshalb auch ausschließlich als Teil dieses Sammelbandes erhältlich. In Deutschland erschien der erste Band bereits unter dem Namen „Antares erlischt“. Damalige Leser dürfte McCollum mit dieser Wartezeit ziemlich vergrault haben … für Neuleser ist der Sammelband dagegen optimal: Als Einzelromane unbefriedigend und unabgeschlossen, ist die Trilogie dagegen eine runde, abgeschlossene Sache.
Aus den Namen wird bereits ersichtlich, was der Leser zu erwarten hat: Military Science-Fiction – im Zusammenhang mit dem Stern Antares. Der 1946 in Phoenix, Arizona, geborene Autor Michael McCollum ist Raumfahrtingenieur und hat an vielen amerikanischen Raumfahrzeugtypen mitgearbeitet. Das merkt man seinen Romanen auch an: Ein solides wissenschaftliches Fundament, weitgehend realistische Technologien und eine spannende Story zeichnen die Antares-Trilogie aus. Schreiberisch kann McCollum leider nicht auftrumpfen, er begeistert eher mit den zuvor genannten Stärken.
_Gestrandet im Weltraum_
Die Menschheit hat vor einigen Jahrhunderten eine Möglichkeit entdeckt, schneller als das Licht durch den Weltraum zu reisen: Manche Sonnensysteme haben sogenannte |Faltpunkte|, deren |Faltlinien| in Nullzeit direkt zu einem anderen, weit entfernten Faltpunkt führen. So werden Distanzen nicht mehr in Lichtjahren, sondern in Sprüngen gemessen. Von großer Bedeutung ist dabei der rote Riesenstern Antares: Wie die meisten Überriesen hat das System viele Faltpunkte, wobei allerdings Antares gleich sechs davon besitzt, die zusätzlich auch noch direkt in bewohnbare Sonnensysteme führen!
Im Jahr 2512 kommt es zur Katastrophe: Unerwartet kollabiert Antares und wird zur Supernova, alle Faltpunkte erlöschen oder verschieben sich: Das gesamte Faltpunktnetz des Menschenraums wird völlig verändert! Das Valeria-System wird besonders hart getroffen: Sein einziger Faltpunkt erlischt – die Bewohner Altas sind in ihrem System gefangen.
Knapp hundert Jahre später taucht ein riesiges Raumschiff im Valeria-System auf. Eine Erkundungsmission unter Captain Richard Drake kehrt mit erfreulichen und bestürzenden Neuigkeiten zurück: Es gibt offensichtlich wieder einen Faltpunkt im System, durch den die als Kriegsschiff der terranischen Hegemonie identifizierte |TNS Conqueror| gekommen ist. Doch das Schlachtschiff ist nur noch ein Wrack, es wurde offensichtlich in einem Gefecht schwerstens beschädigt, nahezu alle Datenspeicher und die gesamte Besatzung ausgelöscht.
Eine Expedition wird mit Drakes Schlachtkreuzer |ANS Discovery| zum Faltpunkt entsandt und stößt in das Napier-System vor. Dort erfährt man durch einen Datenspeicher Bestürzendes: Das nur wenige Lichtjahre neben Antares gelegene Sonnensystem bereitete sich auf eine totale Evakuierung der Bevölkerung in das Hellsgate-System vor, da die harte Strahlung der Nova alles Leben im System auszulöschen drohte. Die Evakuierung war im vollen Gange, als durch einen neu entstandenen, instabilen Faltpunkt im System Schiffe einer „Ryall“ genannten Rasse eindrangen. Diese bombardierten die Hauptwelt New Providence, konnten aber zurückgeschlagen werden. Weitere Angriffe erfolgten, der letzte vernichtete alles Leben auf New Providence, nur ein Bruchteil der Bevölkerung war zu diesem Zeitpunkt bereits evakuiert. Captain Drake schwant Übles – dem Zustand der |Conqueror| nach zu schließen, ist nach wie vor ein Krieg im Gange. Und seine Heimatwelt Alta könnte über den Zugang im Napier-System jederzeit davon erfasst werden …
_Die zweibeinigen Ungeheuer vom bösen Stern_
Bis auf die an Wurmlöcher erinnernden – und auch genauso „funktionierenden“ – Faltpunkte schreibt McCollum Realo-SF: So dauern Flüge im Weltraum Tage, wenn nicht Wochen, der Funk ist nicht überlichtschnell, der Tod im Weltall ist kalt und schnell, niemand hört dich schreien…
Zum Glück hat McCollum nicht vergessen, eine spannende Geschichte zu erzählen. Die anfängliche Suche der |Discovery| ist bereits sehr unterhaltsam, wird aber von der weiteren Entwicklung noch einmal getoppt: Die |Discovery| wird Kontakt zu einer seit Jahrzehnten im Abwehrkampf gegen die Ryall stehenden, monarchistischen Menschenkolonie aufnehmen, einen Weg zur Erde entdecken und das Blatt im Kampf gegen die Ryall wenden können.
So weit die ein wenig an „Kampfstern Galactica“ erinnernde Storyline. Interessant wird es im zweiten Band: Drakes Verlobte Bethany freundet sich mit |Varlan von den Duftenden Wassern|, einer kriegsgefangenen Ryall, an. Diese gewährt ihr Einblicke in die Psyche der Ryall: So sind diese durchaus rational und können sich mit Menschen problemlos verständigen, doch selbst Varlan sieht in Bethany nur „ein die Brut fressendes, zweibeiniges Ungeheuer vom bösen Stern“. Die Ryall führten auf ihrer Heimatwelt Jahrtausende lang Krieg gegen eine zweite, halbintelligente Spezies, die ihre Brut fraß und die amphibischen Ryall ans Land jagte: Die „Schnellen Esser“. Diese entstanden wohl infolge von Mutationen, die durch die Strahlungen einer Supernova ausgelöst wurden. Die Ryall sehen Novae als böse Omen an, und just zu dem Zeitpunkt der Explosion des Antares verband sich der Lebensraum der Ryall mit dem der Menschheit durch Faltpunkte – solange noch ein Mensch in Freiheit lebt, sind die Ryall überzeugt, in ihrer Existenz gefährdet zu sein!
Wie verständigt man sich mit einer an und für sich vernünftigen Alienrasse von Sozialdarwinisten, die von der Unausweichlichkeit eines totalen Krieges gemäß der Maxime „survival of the fittest“ fest überzeugt sind, zudem sie noch wohlbegründete archaische Urängste vor anderen Intelligenzwesen haben?
Ein interessanter Punkt, denn im dritten Band wendet sich das Blatt: Die Menschheit hat die Ryall nun am Haken, und es werden Stimmen zu einer Beendigung des Krieges laut. In den Augen vieler Menschen gleichbedeutend mit einem Genozid an den Ryall. Hier gewinnt das Buch eine fast schon philosophische Tiefe, man merkt deutlich, dass der dritte Band knapp 15 Jahre nach den ersten beiden erschienen ist. Als hätte der Autor so lange über die folgende Problematik nachgedacht: Wird die Menschheit die Ryall auslöschen? Kann man sich noch irgendwie verständigen? Wollen die Menschen, im Bewusstsein des nahen Sieges, überhaupt noch verhandeln? McCollum hat sich hier viel Mühe gegeben, zu welchem Resultat er kommt, möchte ich nicht verraten.
_Fazit_
Wirkt McCollums Schreibstil im ersten Buch teilweise noch etwas sprunghaft und ungelenk, steigert er sich im weiteren Verlauf doch erheblich. Anfangs hatte ich arge Befürchtungen, die interessanten Weltraumexpedition würde von der recht dürftigen Liebesgeschichte zwischen Captain Drake und Bethany Lindquist, ein paar politischen Intrigen der Altaner und den so gerne in SciFi-Soaps üblichen Konflikten zwischen den hilflosen Altanern und der vermeintlich ultra-absolutistischen Kriegerkultur von Sandar überschattet. Doch zum Glück kam alles anders als ich dachte, besonders nachdem Bethany mit der Ryall Varlan ins Gespräch kommt – viel interessanter als ihr Geturtel mit Richard Drake. Die seichten Nebenhandlungen des ersten Teils merzt McCollum bereits im zweiten Band rigoros aus, bravo.
Ein Wortakrobat wird er jedoch nie, seine Figuren bleiben auch eher blass und ordnen sich der Story unter. Diese und seine Konzepte können jedoch begeistern! Straff, spannend und abwechslungsreich. Da dieses Buch ein Sammelband ist, bekommt man die Romane auch nicht häppchenweise mit Cliffhanger und unbefriedigendem Ende geliefert, sondern am Stück. Zwar gehört dieses Buch weitgehend zum Genre Military Science Fiction, allerdings ist diese Bezeichnung irreführend: |Space Exploration| charakterisiert es besser. Ballerei aus fadenscheinigen Gründen zum Selbstzweck findet man hier nicht, ganz im Gegenteil. Weltraumkrieg ist bei McCollum mehr eine Frage der Logistik und bildet nur die Rahmenhandlung für den Kontakt zu den Ryall.
Ein schöner, dicker SF-Schmöker, der gut unterhält und ein interessantes Thema anschneidet. Zwar fehlt der kultige |sense of wonder| der Abenteuer eines Raumschiffs Enterprise, dafür ist McCollums „Antares-Krieg“ ernsthafter, realistischer und deshalb auch etwas gehaltvoller – auf seine Art vielleicht sogar unterhaltsamer.
Matthew Reilly – Showdown
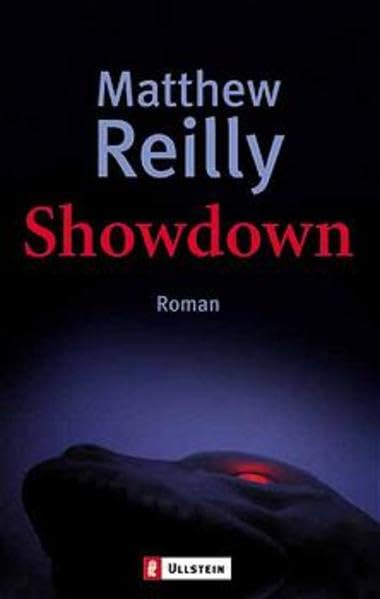
Matthew Reilly – Showdown weiterlesen
Herbert Asbury – Gangs of New York
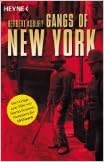
Was sich hier wie der Ausschnitt aus einem wüsten Horrorthriller liest, ist tatsächlich geschehen – im Juli des Jahres 1863, aber nicht auf einem der Schlachtfelder des Amerikanischen Bürgerkrieges (1861-1865), sondern fern der Front in den Straßen von New York! Dort tobte eine mehrtägigen Orgie unvorstellbarer Gewalt und Zerstörung, die von der Armee und nur mit Haubitzen niedergeschlagen werden konnte, mindestens 2000 Menschen das Leben und 8000 die Gesundheit kostete und mehr als einhundert Gebäude in Schutt und Asche legte. Hier entlud sich ganz offensichtlich der Zorn einer rechtlosen Unterschicht, die einmal zu viel mit Füßen getreten worden war.
Von den Volksaufständen der französischen und der russischen Oktober-Revolution haben wir in der Schule erfahren. Aber wer hätte gedacht, dass sich Vergleichbares ausgerechnet in den Vereinigten Staaten von Amerika abgespielt hat, wo man sich als Wiege der modernen Demokratie gern selbst zu feiern pflegt? Die Krawalle von 1863 stellen ein fast völlig vergessenes Kapitel der Weltgeschichte dar. Dabei bilden sie nur den traurigen, aber eigentlich logischen Höhepunkt einer Entwicklung, die man nur als ungeheuerliches Trauerspiel bezeichnen kann: Die braven Bürger von New York hatten den Mob, der ihnen an die Kehle ging, praktisch selbst und systematisch herangezüchtet! Über ein halbes Jahrhundert brüteten die Slums der Stadt mit ihren Lebensbedingungen, die jeglicher Beschreibung spotteten, ganze Generationen verrohter und brutalisierter Wilder aus, die schließlich ganze Viertel besetzten und sich ihre eigene Welt mit bizarren Regeln schuf, zusammengehalten durch mörderische Gewalt – die Gangs von New York!
Wenn man heute das Wort „Gang“ hört, beschwört es das Bild jener Gang-ster-Banden herauf, die im Chicago Al Capones ihr Unwesen trieben. Wer macht sich schon Gedanken darüber, dass diese Verbrecher-„Kultur“ der 20er und 30er Jahre wohl kaum aus dem Nichts entstanden ist, sondern ihre eigenen historischen Wurzeln besitzen muss? Und selbst wenn: Wie könnte man – zumal hier in Deutschland – entsprechende Informationen erhalten?
Da tritt als Retter in der Not ausgerechnet Martin Scorsese, der charismatische Filmemacher abseits des langweiligen Hollywood-Mainstreams, auf den Plan. Nachdem er u. a. mit „Wise Guys – Drei Jahrzehnte in der Mafia“ und „Casino“ schon mehrfach einen Blick auf das organisierten US-Verbrechen der letzten fünf Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts geworfen hat, ging er in seinem Epos „Die Gangs von New York“ weiter zurück – etwa ein volles Jahrhundert, um genau zu sein; in jene Phase, als Gangs mit malerischen Namen wie „Dead Rabbits“, „Five Points“ oder „Hell Kitchen Gophers“ ihr gar nicht romantisches Schreckensregiment ausübten.
„Die Gangs von New York“ ist in den USA aber auch ein Klassiker des „True Crime“-Sachbuchs, das sich mehr oder weniger exakt, aber nicht wissenschaftlich streng seinem Thema nähert. Verfasst wurde es vom zu seiner Zeit sehr populären, heute aber weitgehend vergessenen Journalisten Herbert Asbury (1889-1963) bereits im Jahre 1928.
|“Dieses Buch soll keine soziologische Abhandlung sein und ist nicht als Versuch zu verstehen, Lösungen für die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kriminologischen Probleme aufzuzeigen, die die Bandenkriminalität aufwirft“|, schickt Asbury seinem Werk voraus; eine lobenswerte Einschränkung, auf die viele seiner schriftstellernden Zeitgenossen lieber verzichteten, sich mit Wonne zum Sprachrohr für Volkes Stimme machten und verlogen in düsteren Schauergeschichten über vertierte Verbrecher als direkte Sendboten der Hölle schwelgten. Asbury kann sich von diesem Klischee nicht völlig trennen: |“In der Regel … war der Gangster ein stupider Raufbold, der in Schmutz und Elend geboren und inmitten von Laster und Korruption aufgewachsen war. Er folgte seiner natürlichen Bestimmung“|, heißt es im Vorwort.
Andererseits wollte Asbury hier eindeutig dem kritischen Establishment seiner Zeit den Wind aus den Segeln nehmen. Auf mehr als vierhundert Seiten verzichtete er darauf, dem Publikum die bittere Pille zu versüßen: |“Der Urtyp des Gangsters … war im Wesentlichen das Produkt seiner Umwelt: Armut, chaotische Familienverhältnisse und gesellschaftliche Unsicherheit brachten ihn hervor, und die politische Korruption mit all ihren üblen Begleiterscheinungen gab ihm Auftrieb.“| Das ist deutlich und klingt recht modern, und Asbury versucht nicht einmal, die echten Ursachen des Bandenunwesens in New York zu verschleiern.
Seite um Seite füllt er mit Fakten und Namen und legt Zeugnis ab über die ungeheuerlichen Verbrechen von Politikern, Geschäftsleuten und Kirchenfürsten, die in enger Zusammenarbeit mit dem „Gesetz“ und seinen Vertretern eine ganze Stadt als ihre persönlichen Pfründe betrachteten, die zum Himmel schreiende Verelendung ganzer Stadtviertel ignorierten und jene, die sich nicht wehren konnten, mit einer Rücksichtslosigkeit ausbeuteten, die selbst den in punkto sozialer Gerechtigkeit seit jeher nicht zimperlichen Amerikanern übel aufstieß: |“Im Schlagstock eines Polizisten steckt mehr Recht als in einem Beschluss des Obersten Gerichts.“| (Alexander S. Williams, Kommandant des 29. Polizeireviers von New York)
Sicher, die Zeiten waren anders, und auch in Europa gab es so etwas wie verbindliche Regeln zum Schutze derjenigen, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte, noch nicht, geschweige denn ein soziales Netz, das diesen Namen verdiente. Aber sogar die Zeitgenossen wussten spätestens 1857, dass die übliche Korruption und Unterdrückung in New York jegliches Maß verloren hatten, als der Staat die gesamte Verwaltung vom Bürgermeister abwärts sowie die gesamte Polizeibehörde ihrer Posten enthob – und diese den Gehorsam verweigerten! Der Bürgermeister verbarrikadierte sich im Rathaus, und über Wochen lieferten sich die „alten“ mit den „neuen“ Polizisten vor den Augen der gleichermaßen fassungslosen Bürger und Verbrecher in den Straßen wilde Schlachten um die Vorherrschaft, bis schließlich wieder einmal die Armee einmarschieren musste.
Es fragt sich also, wer die eigentlichen „Gangs von New York“ waren … Asburys Buch platzt geradezu vor Schilderungen absurder Geschehnisse, die den Leser mit offenem Mund zurücklassen. Der Autor beschränkt sich in seiner Skandalchronik mit einer für 1928 erstaunlich anmutenden Konsequenz auf die nüchterne Darstellung. Sofern man das in Unkenntnis der primären Quellen sagen kann, hat Asbury aufwendig und sauber recherchiert. Er nennt geradezu pedantisch Orts- und Personennamen und wartet mit präzisen Zeitangaben auf – kein Wunder, konnte er doch nicht nur auf eine Fülle seither vom sprichwörtlichen Zahn der Zeit vertilgter Akten, Berichte oder Briefe zurückgreifen, sondern selbst noch viele Zeitgenossen befragen.
An dieser Stelle ließe sich noch endlos schwelgen in den (Un-)Taten von Männern mit Namen wie Eat ‘Em Up Jack McManus, Louie the Lump oder Gyp the Blood, in Anekdoten wie der von der wahnwitzigen Entführung des Finanzmagnaten A. T. Stewart 1878 (zwei Jahre nach seinem Tod …) oder in Reminiszenzen an halb verschüttete oder längst vergessene große (noch John Carpenter stützte sich 1987 in „Big Trouble in Little China“ auf die berüchtigten „Tong-Kriege“, die zwischen 1900 und 1912 New Yorks Chinatown verheerten) und kleine Geschichten (Wer hätte gedacht, dass die ersten Polizisten New Yorks keine Uniform trugen, sondern nur einen Stern aus Kupfer – „Copper“ im Englischen; bis zum „Cop“ ist es dann nicht mehr weit …). Aber es soll genug sein und ist gewiss mehr als genug gewesen, neugierig zu machen auf dieses veraltete, aber in jeder Beziehung unterhaltsame Werk, dessen einzige inhaltliche Kritik sich gegen Asburys absurde Behauptung richten muss, die Tage des korrupten New Yorker Stadtregiments und des organisierten Verbrechens seien spätestens seit dem I. Weltkrieg Vergangenheit. Auch Asbury hat 1928 gewusst, was sich längst abzeichnete: Beide waren virulenter denn je und begannen gerade erst zur Höchstform aufzulaufen.
Taschenbuch: 448 Seiten
www.heyne.de
Sara Douglass – Sternenhüter, Der (Unter dem Weltenbaum 4)
Band 1: [„Die Sternenbraut“ 577
Band 2: [„Sternenströmers Lied“ 580
Band 3: [„Tanz der Sterne“ 585
„Der Sternenhüter“ heißt der vierte Band des |Weltenbaum|-Zyklus, und wie erwartet, ist in diesem Teil wieder einiges los:
Axis und Bornheld haben sich dazu durchgerungen, ihre Rivalitäten bis nach dem Winter zu vertagen, um Gorgraels Angriffen standhalten zu können. Axis kann die Angreifer sogar zurückschlagen und kommt wohl oder übel Bornheld zu Hilfe, der die Hauptlast des Ansturms zu tragen hat. Bornheld ist ihm dafür keinesfalls dankbar, und kaum ist der Winter vorrüber, bricht der Waffenstillstand auseinander.
Noch bevor Bornheld Axis angreifen kann, hat der sich bereits auf den Weg in die Provinz Skarabost gemacht, wo ein Vasalle Bornhelds die Bevölkerung tyrannisiert, um sie am Überlaufen zu Axis zu hindern. Während Axis durch das östliche Achar zieht, macht Bornheld sich auf den Weg in die Hauptstadt, weiß er doch, dass Axis letztlich ebenfalls dorthin kommen wird.
Vor den Toren der Stadt kommt es zur Schlacht, doch die endgültige Entscheidung fällt nicht auf dem Schlachtfeld …
Der vierte Band wird zu einem großen Teil von Kämpfen und Schlachten bestimmt. Dabei nimmt der Kampf gegen Gorgraels Kreaturen den weitaus größeren Raum ein, wenngleich seine neueste Waffe seltener vorkam, als ich es am Ende von „Tanz der Sterne“ erwartet hätte. Die Schlacht vor Karlon ist dagegen erstaunlich kurz. All diese Schlachten sind ziemlich unblutig beschrieben, gehen eher auf strategische Dinge und auf die Verschiebung von Machtverhältnissen ein als auf bloßes Gemetzel.
Den Höhepunkt der Kämpfe stellt natürlich der letzte Kampf zwischen Axis und Bornheld dar, der in dieser Hinsicht wesentlich drastischer ist. Im Hinblick auf zwei Folgebände kann zu diesem Zeitpunkt der Kampf wiederum nur zu Gunsten Axis‘ ausfallen, allerdings geht es dabei um wesentlich mehr als nur um die Entscheidung zwischen den Rivalen.
Die andere Hälfte des Buches dreht sich großteils um das Dilemma zwischen Axis, Aschure und Faraday. Weder Axis noch Aschure sehen sich in der Lage, den gordischen Knoten zu lösen, den Axis da geknüpft hat, und letztlich ist es Faraday, die die Entscheidung trifft, nicht ohne ein Samenkorn der Rache mit hineinzupacken.
Mit dem Entscheidungskampf zwischen Bornheld und Axis und auch mit den Ereignissen, die zu Faradays Entscheidung führen, wurden einige Rätsel gelöst, an denen der Leser bisher eifrig geknackt hat. Noch immer steht aber nicht fest, wer der Verräter in Axis‘ Reihen ist, und was der Dunkle Mann eigentlich mit seinem Tun bezweckt. Und Faradays Abschied gibt wieder erneutes Rätselraten auf.
Die Prophezeiung, deren Wortlaut in jedem Band enthalten ist, dröselt sich immer mehr auf, pro Band – in der deutschen Ausgabe pro zwei Bände – eine Strophe, so scheint es, doch ganz so einfach ist es nicht, bleiben doch immer noch mehrere Möglichkeiten der Deutung offen, so zum Beispiel, wer die dunklere Macht sein mag, die sich als Bringer des Heils erweisen soll.
Die ungewöhnlichen Ereignisse außerhalb des Schlachtengeschehens zeigen den Einfallsreichtum der Autorin. Und immer wieder gelingt es ihr elegant, überraschend Fäden miteinander zu verbinden, die gar nichts miteinander zu tun zu haben schienen, erweist sich am Rande Erwähntes, das unwichtig schien, als bedeutsam. Das gilt besonders für die feinen Handlungsfäden, die neben den großen Strängen herlaufen: die Wächter, die Charoniten, Timozel.
Im bisherigen Gesamtverlauf ist man jetzt an einem vorläufigen Höhepunkt angelangt. Der Bürgerkrieg ist beendet, die folgende Handlung wird auf den endgültigen Gipfel zustreben, den Kampf gegen Gorgrael. Bisher fehlt Axis‘ Heer jedoch noch die Unterstützung der Awaren, die sich ihm nicht anschließen, sondern auf die Baumfreundin, Faraday, warten wollten. Und Aschure erwartet eine Reise zu ihren Wurzeln. Die beiden folgenden Bände stehen also im Zeichen des Endspurts, und bereits am Ende von „Der Sternenhüter“ hält sich erwartungsvolle Anspannung. Obwohl der vorläufige Höhepunkt hinter einem liegt, kommt man nicht mehr richtig zur Ruhe, wie es nach der Belagerung Gorkens noch der Fall war. Das Geschehen hat den Leser voll im Griff. Und das Szepter des Regenbogens aus der Prophezeiung verheißt zusätzlich auch noch ein paar ausschmückende Ideen. Etwas anderes als Weiterlesen kommt an dieser Stelle schon längst nicht mehr in Frage.
Sara Douglass arbeitete zuerst als Krankenschwester, bevor sie ein Studium in historischen Wissenschaften begann. Sie promovierte und arbeitete in den folgenden Jahren als Dozentin für mittelalterliche Geschichte. Das Schreiben fing sie nebenbei an, als Ausgleich zum Stress. Nach dem Erfolg ihres |Weltenbaumzyklus| stieg sie aus ihrem Beruf aus und konzentrierte sich aufs Schreiben und ihren Garten. Sie lebt in einem Cottage in Bendigo/Australien. Außer dem |Weltenbaumzyklus| schrieb sie diverse weitere Romane und Kurzgeschichten.