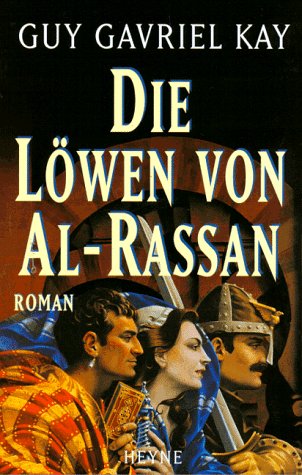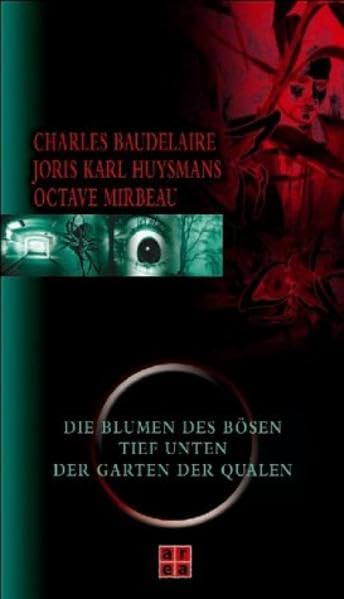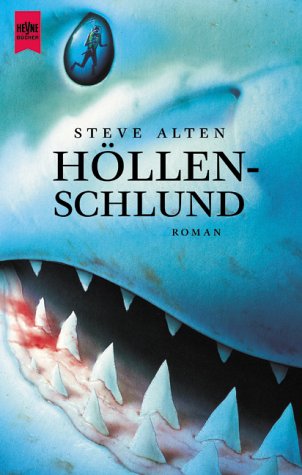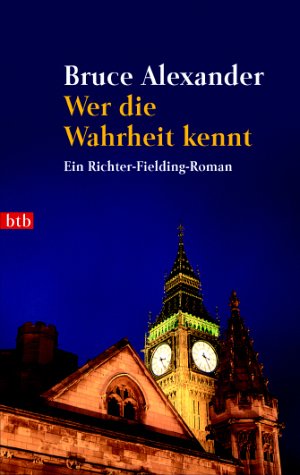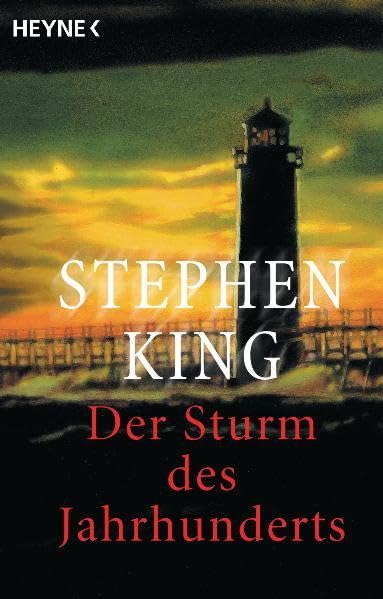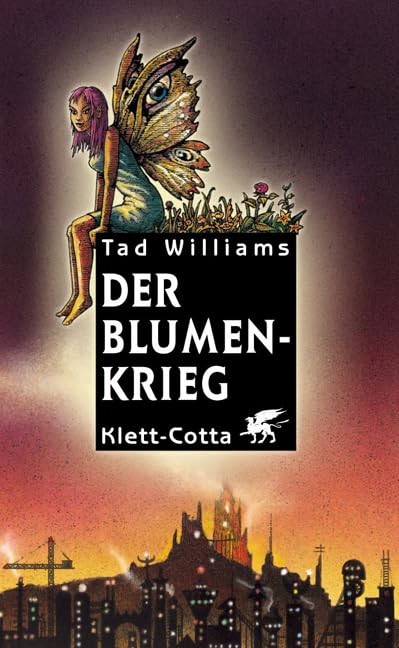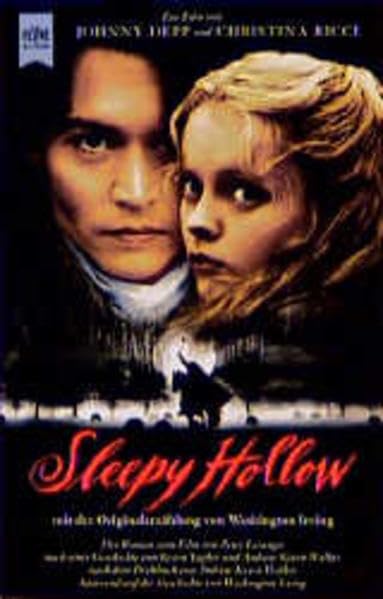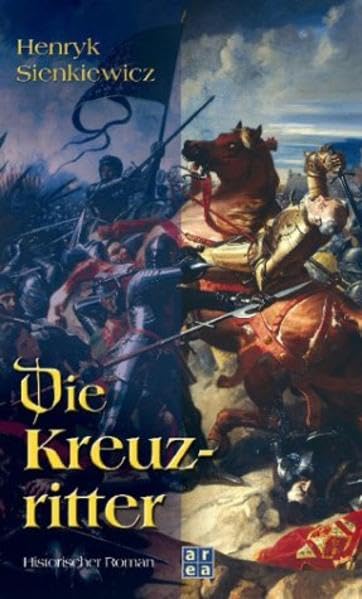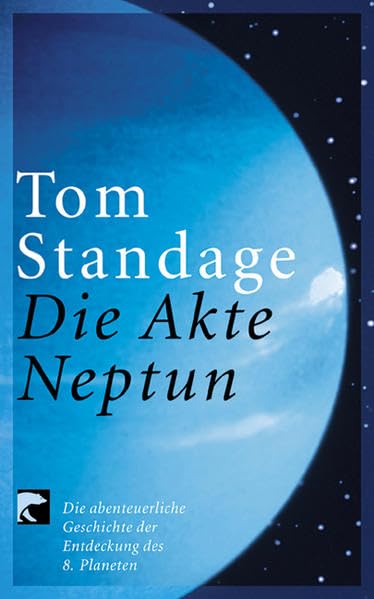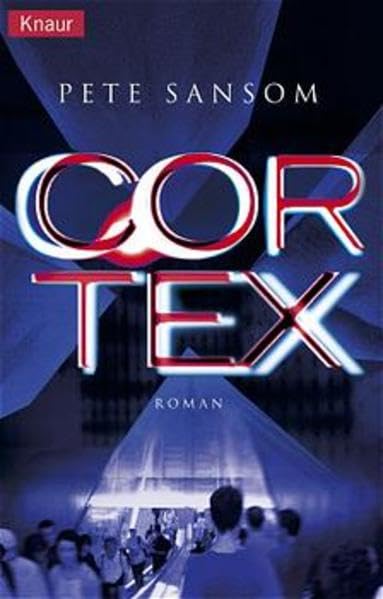_von Mathias Bröckers_
Nach zwei Büchern über die Verschwörungstheorien des 11. September werde ich in der Presse und bei Diskussionsveranstaltungen oft als „Verschwörungstheoretiker“ vorgestellt. Eigentlich ist gegen die Bezeichnung nichts einzuwenden. Dennoch beginne ich meine Beiträge, wie unlängst bei einer Diskussion mit einem Redakteur des |SPIEGEL| an der Uni Göttingen, gern mit der Richtigstellung einer Verwechslung: Ich befasse mich zwar mit Verschwörungen und Verschwörungstheorien, vertrete selbst aber keine Theorie des 11.9.; im Unterschied zu den Kollegen beim |SPIEGEL| und in den großen Medien, die seit dem 11.9. eine Geschichte wiederholen, für die bis heute keine gerichtstauglichen Beweise vorliegen: die Legende der Alleintäterschaft von Osama Bin Laden und den 19 Hijackern – eine lupenreine Verschwörungstheorie.
Noch einmal kurz zur Begriffsbestimmung: Verschwörungen sind das Selbstverständlichste der Welt: A und B verabreden sich hinter dem Rücken von C, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Das geschieht im Wirtschaftsleben genauso wie in der Natur, ist in der Politik ebenso an der Tagesordnung wie am Arbeitsplatz – sowie, vor allem, im Liebesleben. Die am meisten gehegte Verschwörungstheorie überhaupt ist wahrscheinlich der Verdacht, dass der Liebespartner heimlich noch ein anderes Verhältnis haben könnte. Verschwörungstheorien sind also Annahmen über mögliche Verschwörungen, die auf Indizien, Verdachtsmomenten, Hinweisen – oder auch purer Einbildung – beruhen; wird die Theorie durch einen definitiven Beweis erhärtet – der Partner wird beim Seitensprung ertappt, oder Dokumente über illegale Polit-Machenschaften geraten an die Öffentlichkeit –, fliegt die Verschwörung auf und ist beendet. Oft aber ist solch ein definitiver Beweis nicht zu erbringen und so fristen Verschwörungen bisweilen ein ebenso langes Leben wie Verschwörungstheorien.
Für die Vorhersage, dass den Verschwörungstheorien des 11.9. solche Langlebigkeit blühen wird, bedarf es keiner großen Prophezeiungsgabe. Nach drei Jahren und der angeblich größten Polizeifahndung aller Zeiten wissen wir kaum mehr als nach drei Tagen: dass 19 Araber im Auftrag Osamas mit Teppichmessern vier Flugzeuge kaperten, das |World Trade Center| zum Einsturz brachten und fast 3.000 Menschen ermordeten. Die erst nach 15 Monaten und auf Druck der Opferfamilien eingesetzte 9/11-Untersuchungskommission hörte zwar viele Zeugen und wälzte tausende von Dokumenten – brachte zu den Hintermännern, der Finanzierung und dem genauen Ablauf der Tat aber nichts wirklich Neues ans Licht. Von Augenzeugen, die aus erster Hand hätten berichten können – etwa aus der Zeit, die die Hijacker in Florida verbracht hatten –, wurde kein einziger auch nur gehört. Ein Vorwurf, den sich die zehn vom Präsidenten bestimmten Mitglieder der Kommission gelassen anhören können, bestand doch ihr offizieller Auftrag gar nicht in der Aufklärung der Anschläge – sondern in Empfehlungen, wie sie künftig zu verhindern seien. Da sich die Prävention künftiger Terrorattacken ohne Aufklärung vergangener Anschläge aber nicht so recht planen lässt, forderte die Kommission auch Beweismittel über den 11.9. an – wie Flugschreiber-Daten, Aufzeichnungen des Funkverkehrs, Protokolle der Luftabwehr und weiteres –, die jedoch unter Berufung auf die „nationale Sicherheit“ nur auszugsweise oder überhaupt nicht freigegeben wurden. Die von Bush’s Vize Dick Cheney handverlesene Kommission, deren Mitglieder sich alle durch enge Verbindungen zur Öl-, Militär,- oder Geheimdienst-Branche auszeichnen, nahm diese Blockaden klaglos hin; das einzige halbwegs unabhängige Kommissionsmitglied, das sich über die Verhinderung der Ermittlungen lautstark beklagte – Senator Max Cleeland – wurde umgehend ausgetauscht. Nachdem der Bericht dann fertig gestellt war, stellte der Kommissionsleiter Thomas Kean fest, dass „alle wichtigen Beweismittel“ zur Verfügung gestanden hätten.
Wie wichtig die Aufklärung dieses Massenmords von der Regierung eingestuft wurde, lässt sich schon an dem Budget der Kommission ermessen – es betrug ursprünglich 3 Millionen Dollar und wurde nach Protesten auf 15 Mio. $ erhöht. Zum Vergleich: Für die Aufklärung von Clintons „Monicagate“ wurde seinerzeit fast fünfmal soviel ausgegeben: 70 Mio. $.
Warum weigerte sich das Weiße Haus hartnäckig, die Anschläge überhaupt von einer Regierungskommission untersuchen zu lassen und agierte, nachdem öffentlicher Druck eine Untersuchung unvermeidlich gemacht hatte, ganz so, als ob ihr an der Nicht-Aufklärung des Verbrechens mehr gelegen sei als an seiner Aufdeckung? Diese Frage führt uns mitten in das Feld, auf dem die Verschwörungstheorien des 11.9. blühen – und eine erste Antwort könnten die Vorbereitungen der Irak-Invasion liefern.
Verteidigungsminister Rumsfeld und sein Vize Wolfowitz haben mittlerweile mehrfach bekannt, dass die konkreten Planungen zum Irakkrieg direkt nach den Anschlägen auf WTC und Pentagon begannen. An jenem Tag, an dem das FBI die Liste der verdächtigen 19 Hijacker veröffentlichte, von den 15 aus Saudi-Arabien stammten. Zweifel an ihrer Identität tauchen zwar auf, werden aber nur oberflächlich bereinigt, weitergehend untersucht wird nichts, Täter und Hintermänner bleiben nebulös – aber die „Spin-Doktoren“ übernehmen nun die propagandistische Verarbeitung. Mit Erfolg: Achtzehn Monate später, kurz vor dem Einmarsch in Irak, ergeben Umfragen in den USA, dass 60 Prozent der Bevölkerung die Hijacker für Iraker halten – und den Marsch auf Bagdad für eine gerechte Bestrafungsaktion. Die Nicht-Aufklärung des wahren Hintergrunds der Täter und ihre Fortexistenz als phantomhafter Wechselbalg namens „Al Quaida“ hat sich für die US-Regierung also als sehr nützlich erwiesen. Gerade konkret genug, um geographisch („Araber“) und ideologisch („Islamisten“) ein Feindbild abzugeben, aber auch so diffus, dass es mit ein paar Drehungen an der Spin-Schraube flexibel einsetzbar bleibt.
Nur die Nicht-Aufklärung der Katastrophe, die Nicht-Ermittlung der konkreten Planer und Hintermänner ermöglichte ihre optimale Ausbeutung für propagandistische Zwecke – und mit dem Abschlussbericht der 9/11-Kommission ist die Legende von „Osama und den 19 Hijackern“ als Alleintätern – und die von „Pleiten, Pech und Pannen“ von Geheimdiensten, Luftüberwachung und Polizei – zur offiziellen Geschichtsschreibung geworden.
Wie dabei alle widersprüchlichen, nicht ins Bild eines Überraschungsangriffs islamistischer Fanatiker passenden Nachrichten verschwanden, zeigt beispielhaft die Berichterstattung über die letzten Tage des verdächtigen „Terrorchefs“ Mohammed Atta. Am 16. September 2001 berichteten zahlreiche Medien – von der „Washington Post“ bis zum Lokalblatt „Charleston Post & Courier“ – detailliert und unter Berufung auf den Barkeeper Tony Amos, dass Atta in „Shukkums Restaurant“ in Hollywood/Florida zwei Abende vor dem Attentat gezecht hatte: Nach drei Stunden hatte er fünf „Stolichnaya“-Wodka intus und sein Kumpan Al-Shehhi ebenso viele „Captain Morgan“-Rum; und es kam wegen der Bezahlung der Rechnung zu einer lautstarken Auseinandersetzung, bei der sich Atta als Pilot der „American Airlines“ ausgab. Elf Tage später liest sich die Geschichte dieses Trinkgelages schon ganz anders. Im Bericht der „Los Angeles Times“ sind die Alkoholika verschwunden: „Am selben Abend (7. Sept.), unten an der Küste Floridas, gingen Atta und Al-Shehi in Shuckums Sports Bar in Hollywood, zusammen mit einem noch unidentifizierten dritten Mann. Der Betreiber, Tony Amos, sagt, dass Atta ruhig für sich saß, Preiselbeersaft trank und Videogames spielte und Al-Shehi mit dem anderen Gast Mix-Drinks konsumierte und diskutierte …“
Der Barkeeper ist nur einer von vielen Augenzeugen, die auf das Desinteresse der 9/11-Kommission stießen – auch keine der Aussagen von Nachbarn, Vermietern oder Taxifahrern aus dem Rentnerstädtchen Venice, die mit Atta persönlich zu tun hatten, wurde bei den Ermittlungen berücksichtigt. Schon gar nicht Attas Freundin Amanda Keller, die sechs Wochen mit ihm ein Appartment geteilt hatte. Der Investigativ-Journalist Daniel Hopsicker, der seit dem 11.9. in Florida recherchiert, hat mit vielen dieser Augenzeugen gesprochen, und sein Report („Welcome to Terrorland“, Frankfurt 2004) macht klar, warum sie für die „Aufklärung“ unerwünscht sind: Ihre Aussagen decken sich nicht mit dem Bild des islamistischen Fundamentalisten, das FBI und Medien von „Terrorchef“ Atta gezeichnet haben. Neben dem Konsum von Alkohol belegen diese Zeugen weitere gänzlich unislamische Vorlieben Attas, wie Striptease-Bars, Schweinekottelets oder Kokain – kurz: Atta verhielt sich nicht wie ein vernagelter Islamist, sondern eher wie ein weltläufiger Agent. Als wir seinen ehemaligen Arbeitgeber in Hamburg, bei dem Atta während seines Studiums einen Job als Planzeichner hatte, zwei Jahre nach den Anschlägen zu diesen Fakten befragen, schüttelt er den Kopf: „Das ist nicht der Mohamed, den wir kennen. Wissen Sie, diese Geschichte ist mittlerweile so verrückt, ich könnte mir vorstellen, dass er jeden Moment hier hereinspaziert kommt, weil sich alles als Missverständnis aufgeklärt hat.“ Die Arbeit der 9-11-Kommission hat nicht dazu beigetragen, die Unklarheiten zu beseitigen, im Gegenteil bekundet Hopsicker, der die letzten öffentlichen Hearings in Washington verfolgte: „Wir waren platt, als die Präsentation offensichtlich den bereits veröffentlichten und von den großen Medien berichteten Fakten über die letzten Tage Mohammed Attas widersprach. Es war falsch und es war so offensichtlich falsch, dass man sich fragen musste, was hier eigentlich vorgeht.“
Denn Atta war nicht nur am 7. September in dieser Bar in Florida – auch am 9. September, als er laut Untersuchungskommission auf dem Weg von Baltimore nach Boston gewesen sein soll, hielt er sich noch an der Goldküste Floridas auf. Dieses Mal in Pompano Beach, wo er bei „Warrick Rent a Car“ mit Marwan Al Shehhi einen Mietwagen zurückgab, wie eine Kopie des Mietvertrags beweist. Der offizielle 9/11-Report jedoch behauptet:
„Am 7. September flog er von Fort Lauderdale nach Baltimore, … Am 9. September flog er von Baltimore nach Boston. Dort trafen zu diesem Zeitpunkt Marwan al Shehhi und sein Team für Flug 175 ein. Atta wurde mit Al Shehhi in seinem Hotel gesehen.“
Wenn Atta am 7. September stundenlang in einer Bar in Florida zubrachte und am 9. September dort auch noch ein Mietauto zurückgab – wie kann er gleichzeitig am 7. im Flugzeug nach Baltimore und am 9. auf dem Weg nach Boston sein? Wenn wir davon ausgehen, dass der wahabitische Wodkaliebhaber Atta nicht über die Gabe der Bilokation verfügt, bleibt eigentlich nur die Möglichkeit eines Doppelgängers, wie wir sie anhand weiterer Widersprüchlichkeiten von Zeugenaussagen über den „Terrorchef“ in unserem letzten Buch „Fakten, Fälschungen und die unterdrückten Beweise des 11.9.“ erörtert haben. Jene „zwei Attas“, von denen der eine als verkniffener fundamentalistischer Islamist posiert, der nie einer Frau die Hand reichen würde – und der andere mit dem Strip-Girl Amanda Keller zusammenlebte, Wodka trank und gern Schweinskoteletts aß … Während Atta 1 sich auf Selbstmordmission befindet und als Beweis für seinen Fanatismus sein Testament am Flughafen hinterlässt, eröffnet Atta 2 am 25. August 2001 laut „Boston Globe“ ein „Frequent Flyer“-Konto zum Meilensammeln …
Die Merkwürdigkeiten sind offensichtlich. Wie aber kommt es, dass nach drei Jahren, der angeblich größten FBI-Fahndung aller Zeiten und 20 Monaten Untersuchung durch diverse Regierungskommissionen, diese Widersprüche und Ungereimtheiten nicht aufgeklärt sind? Fragen wie diese sind keine Kleinigkeiten, schließlich handelt es sich hier um den vermeintlichen Haupttäter eines Massenmords; und die wenigen Journalisten, die sie stellen, sind weder böswillig noch verrückt. Sie stellen nur die Fragen, die jeder Ermittler, jeder Kriminalist und natürlich jeder Untersuchungsauschuss stellen müsste, dem es wirklich um Aufklärung des Falles geht. Doch darum geht es der US-Regierung und ihren Kommissionen ganz offensichtlich nicht.
Stephen Brill beschreibt in seinem Report „After: The Rebuilding and Defending of America“ (New York 2003, S. 37) folgende denkwürdige Szene am 12. September 2001:
Als FBI-Chef Robert Mueller Bush versicherte, alles werde getan, um die an den Anschlägen Beteiligten zur Strecke zu bringen, bürstete Bush ihn ab: »Unsere Prioritäten haben sich geändert«, sagte er. »Wir müssen uns darauf konzentrieren, den nächsten Angriff zu verhindern, statt uns darüber Sorgen zu machen, wer diesen verursacht hat.«
Am 12. September also – die Trümmer der Twin Towers rauchten noch – wurde der Beschluss gefasst, die Fahndung nach den Tätern und Hintermännern des Massenmords einzustellen, weil sich die „Prioritäten“ geändert hatten – in Richtung Irak. Der Nachrichtensender CBS meldete im April 2002:
|»Wie CBS erfahren hat, sagte Verteidigungsminister Rumsfeld am 11. September, kaum fünf Stunden nach dem Einschlag der Maschine ins Pentagon, seinen Mitarbeitern, die Pläne für einen Angriff auf Irak hervorzuholen, auch wenn es keinen Beweis für eine Verbindung Saddam Husseins mit den Anschlägen gibt.«|
http://www.cbsnews.com/stories/2002/09/04/september11/main520830.shtml
Dieser Intention wurde vom ersten Tag an also alles untergeordnet – die Terroranschläge wurden nicht aufgeklärt, sondern für die Propagandazwecke dienstbar gemacht.
Vize-Verteidigungsminister Paul Wolfowitz bekundete nach der Tat:
|»Diese Operation war zu ausgeklügelt und zu kompliziert, als dass sie von einer Terroristengruppe allein hätte durchgeführt werden können …«|,
– und hier geben wir ihm völlig Recht. Die Lüge, die Wolfowitz dieser wahren Feststellung dann hinzufügte:
|»… ohne einen staatlichen Geldgeber. Der Irak musste ihnen geholfen haben«| (Zit. n. Clarke, Richard A.: Against all Enemies, S. 30)
– diese Lüge aber ist mittlerweile als solche entlarvt. Es bleibt also nur noch die Kleinigkeit zu klären, wer diese staatlichen Planer, Hintermänner und Geldgeber waren.
Das letzte Beispiel zeigt, wie Mythen – in diesem Fall die Verschwörungstheorie einer Verwicklung des Irak in die Taten des 11.9. – geschaffen und konstruiert werden. Ein rationaler, einleuchtender Kern – dass die Luftverteidigung einer Supermilitärmacht nicht allein von einem Dutzend Studenten mit Teppich-Messern zwei Stunden lang ausgeschaltet werden kann, scheint logisch – dieser logische Kern wird mit einer von Fakten völlig ungedeckten Behauptung – „der Irak steckt dahinter!“ – zusammengepackt – und fertig ist Verschwörungs-Legende. Um zum Mythos zu werden – laut Definition (|Encyclopaedia Britannica|) „eine Geschichte, die durch viele Nacherzählungen zur akzeptierten Tradition einer Gesellschaft wird“ – bedarf es jetzt nur noch der vielfältigen, dauerhaften Nacherzählung und im Medienzeitalter ist bekanntlich nichts leichter als das. Die multimediale Wiederholungsschleife der Nacherzählung hat nicht nur den in der PR-Branche „Penetration“ genannten Effekt der massenhaften Verbreitung und Memorierung in der Bevölkerung, sie sorgt auch für ein weiteres Charakteristikum des Mythos, nämlich seine Urheberlosigkeit. Der Ursprung, der Autor, der Erfinder der Geschichte werden im Zuge der permanenten Nacherzählung verwischt und der allgemeinen Überlieferung zugeschrieben. Praktischerweise ist dann später – wenn sich die Unwahrheit des Mythos herausstellen sollte – auch niemand konkret verantwortlich und haftbar zu machen.
Fakten sind sozusagen der natürliche Gegner von Mythen – wo alle Unklarheiten mit eindeutigen Tatsachen dokumentiert sind, ist kein Platz mehr für die nebulöse Unschärfe des Mythos. Um nützliche Mythen aufrecht zu erhalten, müssen Fakten deshalb ferngehalten oder manipuliert werden. Eine Paradebeispiel dafür lieferten die „aufgesexten“ Dossiers, mit denen Englands Premier Blair uralte Erkenntnisse über den Irak zur akuten 45-Minuten-Bedrohung durch ABC-Waffen hochstilisierte – die von den UN-Inspektoren ermittelten aktuellen Tatsachen einer weitgehend abgewrackten irakischen Armee mussten dafür ausgeblendet werden.
Bevor US-Soldaten nach dem Einmarsch in Bagdad die Saddam-Statue stürzten, schmückten sie diese mit einem |Stars & Stripes|-Banner – es war die Fahne, die am 11.9. über dem Pentagon geweht hat. Der symbolische Akt, mit dem die GIs demonstrierten, in welchem Glauben man sie in den Irak geschickt hatte, zeigt einmal mehr, wie Mythen instrumentalisiert und inszeniert werden. Und wie wichtig es in diesem Zusammenhang war, die Täter des 11.9. nicht zu ermitteln, sondern im Status des mythisch Nebulösen zu belassen. Diese Operation ist den „Spin Doktoren“, den PR-, Propaganda- und Stimmungsmachern des Weißen Hauses, hervorragend gelungen – unter dem Namen „Al Quaida“ wurde ein Allzweckteufel und Universaldämon geschaffen, der zwar nicht konkret fassbar, aber als potenzielle Bedrohung überall einsetzbar ist.
Dass es keine terroristische Organisation dieses Namens gibt, dass „ana raicha al quaida“ im umgangssprachlichen Arabisch „Ich muss mal aufs Klo“ bedeutet – und höchstens eine Komikertruppe so einen Namen wählen würde –, dass ihr vermeintlicher Chef Osama Bin Laden in mehreren Interviews nach den Anschlägen jede Beteiligung daran zurückwies, dass es sich bei den geständigen Kronzeugen und angeblichen Masterminds des 11.9. – Binalshib & Khalid Scheich Mohamed – um zwei Phantome handelt, die kein Richter, kein Staatsanwalt und keine Untersuchungskommission je befragen konnte oder zu Gesicht bekam; dass die 9/11-Kommission nach knapp drei Jahren bekennen muss, die Finanzierung (sprich: die Planer & Hintermänner der Terroristen) sei weiterhin „unklar“… – all dies zeigt – und es ließen sich noch mindestens zwei Dutzend weitere Anomalien und Merkwürdigkeiten aufführen –, dass die Ergebnisse der angeblich größten Fahndung aller Zeiten nahezu gleich Null sind. Und die Legende der Alleintäterschaft von Osama & der Wilden Neunzehn tatsächlich nichts anderes ist als ein Mythos.
Nicht mehr habe ich in der Kolumne bei „telepolis“ und in den Büchern immer wieder behauptet – aber auch nicht weniger – und wurde vermutlich eben deshalb so vom Zorn der Großmedien getroffen, die ihrem Publikum – zwischen der Werbung – eben diesen Mythos bis heute als Realität verkaufen. Allen voran der |SPIEGEL|, der letzte Woche „Die dunkle Welt der Folter“ auf dem Titel hatte und es an Entrüstung nicht fehlen ließ, war sich vor einem Jahr nicht zu schade, aufgrund von Aussagen, die wahrscheinlich unter Folter erpresst wurden, einen reißerischen Aufmacher zu produzieren: „Das Geständnis“. Darin wurde behauptet, zu den offenen Fragen und der Vorgeschichte des Verbrechens des 11.9 könnte nun „ein genaues Bild“ gezeichnet werden. Dass es sich dabei um alles andere als um ein genaues Bild, sondern um eine unüberprüfbare Legende handelte, wurde bei den Gerichtsverhandlungen gegen die Hamburger Wohngenossen Mohamed Attas in Hamburg deutlich. Dass bis heute niemand für die Verbrechen verurteilt wurde, hat einen einfachen Grund: Es gibt keine Beweise.
Richard Clarke schreibt in seinem Buch „Against all Enemies“:
|“Verschwörungstheoretiker hängen gleichzeitig zwei einander widersprechenden Überzeugungen an. A) dass die US-Regierung so inkompetent ist, dass sie Erklärungen übersieht, die von Theoretikern enthüllt werden können, und b) dass die US-Regierung ein großes, saftiges Geheimnis für sich behalten kann. Die erste Überzeugung hat eine gewisse Berechtigung. Die zweite Vorstellung ist reine Fantasie.“|
Hätte der einstige „Antiterrorzar“ der Vereinigten Staaten mit Letzterem Recht, könnten Staaten so gut wie gar nichts geheim halten, was natürlich Unsinn ist. Als Mann vom Fach weiß Clarke natürlich auch genau, dass er hier Unsinn redet, aber eben solchen, der seinen Zweck erfüllt: nämlich „Verschwörungstheorien“ als „Phantasie“ erscheinen zu lassen. Als gäbe es keine verdeckten Operationen, als hätte eine US-Regierung noch nie zu solchen „black ops“ gegriffen, um ihre Interessen im In- und Ausland durchzusetzen, als hätten Ereignisse wie die „Schweinebucht“, „Watergate“ oder „Iran-Contra“ nie stattgefunden. Das „Manhattan Project“ – die Entwicklung der Atombombe in den 40er Jahren – blieb zum Beispiel ebenso über Jahre „top secret“, wie die Entwicklung des „Stealth“-Bombers in den 80ern – beides Großprojekte, an den Hunderte von Mitarbeitern beteiligt waren. Es gibt also sehr wohl klandestine Operationen – „saftige Geheimnisse“ in Clarkes Worten – die erfolgreich geheim gehalten werden können.
Dass Richard Clarke als einziger leitender Beamter der Bush-Regierung die Courage hatte, sich bei der Bevölkerung für sein Versagen zu entschuldigen, zeichnet ihn aus; angesichts der Augenwischerei, mit der er uns hier die Unmöglichkeit geheimer Regierungspolitik präsentiert, verstärken sich freilich die Bedenken, dass auch sein „mea culpa“ vor dem 9/11-Untersuchungsausschuss eine wohlkalkulierte Inszenierung im Rahmen ihrer „Operation Whitewash“ war. Zumal Clarke einige wichtige Bausteine für die „Pleiten, Pech und Pannen“-Theorie lieferte, allen voran das schöne Bonmot des FBI, als es ihm die Namen der „Hijacker“ mitteilte: „Die CIA hat vergessen, uns von ihnen zu erzählen“. So was kommt natürlich vor, genauso wie Klatsch und Tratsch im Weißen Haus – Gedächtnisaussetzer, menschliche Schwächen, Behördenschlamperei, „not connecting the dots“ – aber Verschwörungen, die gibt es nicht … Es gibt nur „Verschwörungstheorien“ und die sind reine Phantasie …
Zum Parteitag der Republikaner in New York vergangene Woche wurde eine repräsentative Umfrage über den 11.9. unter den Bewohnern von New York City durchgeführt. Danach ist die Hälfte der Bürger von New York, 49,3 Prozent,(Zogby Poll) mittlerweile der Meinung, dass die Regierung von den Anschlägen vorher informiert war und sie aus Opportunitätsgründen geschehen ließ. Ähnliche Umfrageergebnisse sorgten vor einem Jahr in Deutschland für große Aufregung – sie wurden mit dem „Anti-Amerikanismus“ erklärt und einer handvoll Autoren – darunter Andreas v. Bülow, Gerhard Wisniewski und mir – in die Schuhe geschoben, die die Vorurteile der Bevölkerung mit verantwortungslosen Verschwörungstheorien fütterten. Dass dies völliger Humbug ist, zeigt das aktuelle Meinungsbild der direkt Betroffenen aus New York, denen man schwerlich Anti-Amerikanismus vorwerfen kann. Und auch nicht, dass sie von einem Dutzend skeptischer Websites und Alternativblätter manipuliert worden sind. Nein – diese Ergebnisse zeigen schlicht und einfach, dass die offizielle Version unglaubwürdig ist – und die dafür vorgebrachten Beweise in keiner Weise überzeugend. Die Schlüsse, die daraus zu ziehen wären, sind ebenso schlicht und einfach: Weitere Ermittlungen sind notwendig, sei es in Form von Gerichtsverfahren – eine Witwe des 11.9. , Ellen Mariani, hat die US-Regierung wegen Mitwisserschaft und Vertuschung des Verbrechens verklagt –, sei es in Form wirklich unabhängiger Untersuchungskommissionen oder eines internationalen Tribunals.
Zum Abschluss will ich die meines Erachtens wichtigsten Punkte und Themenfelder nennen, die weiterer Ermittlungen bedürfen:
Die wirkliche Identität der 19 Hijacker, die nach wie vor ungeklärt ist – die Original-Passagierlisten der vier Todesflüge, die die Namen der jeweiligen Entführer enthalten müssten, sind bis heute unveröffentlicht.
Die Zeugen in Venice, wo sie sich monatelang aufhielten und zahlreiche Kontakte unterhielten. Atta traf sich regelmäßig mit einer Gruppe deutscher „brothers“, wie er sie nannte, lebte sechs Wochen mit einem Dessous-Modell zusammen und legte auch ansonsten ziemlich unislamisches Verhalten an den Tag.
Das Umfeld der Flugschulen in Venice, Florida, wo die Hijacker trainierten. Sie weisen alle Anzeichen von CIA-Tarnfirmen auf – und gehörten nicht dem Holländer Rudi Dekkers, sondern einem dubiosen Finanzier, Wally Hilliard. In derselben Woche, in der sich Atta bei Hufman Aviation anmeldete, wurde eine seiner Maschinen mit 40 Pfund Heroin an Bord beschlagnahmt.
Die Hintergründe, warum die Fahndung nach den verdächtigen Flugschülern durch die FBI-Zentrale blockiert wurde und die z. T. seit Jahren wegen Terrorverdachts auf verschiedenen „watch lists“ stehenden Flugschüler sich in den USA so frei bewegen konnten.
Die Aussagen der ehemaligen FBI-Übersetzerin Sibel Edmonds, die nach dem 11.9. auf Abhörprotokolle aus den Wochen davor stieß, aus denen sich ein Zusammenhang der Anschläge mit einer groß angelegten Waffen-, Drogenschmuggel und Geldwäsche-Operation ergab. Ihr wurde von Justizminister Ashcroft ein Aussageverbot erteilt, mit der Begründung, dass die „nationale Sicherheit“ und die „Interessen eine befreundeten Nation“ davon betroffen seien.
Die Vorwarnungen, die dazu führten, dass prominente Politiker wie Justizminister Ashroft oder auch San Franciscos Bürgermeister Willie Brown vor und am 11.9. keine Linienmaschinen mehr benutzten.
Die „wargames“, die am Morgen des 11.9. stattfanden und bei denen die Entführung von Zivilflugzeugen simuliert wurden. Nur eines dieser Manöver taucht im Abschlussbericht der Kommission einmal in einer Fußnote auf. Auch in den Monaten zuvor waren ähnliche Manöver durchgeführt worden, unter anderem das Szenario einer ins Pentagon einschlagenden Maschine.
Der Zusammenhang dieser Wargames mit dem völligen Ausbleiben der Luftabwehr am Morgen des 11.9. – sowie mit der Aussage von Condy Rice, dass man sich Flugzeuge als Bomben einfach nicht vorstellen konnte.
Die Nichterreichbarkeit von Verteidigungsminister Rumsfeld, der nach den Einschlägen in New York laut Abschlussbericht fast eine Stunde lang im Pentagon unauffindbar war – sowie die des obersten Militärs Richard Myers, der im Kongressgebäude über seine Beförderung sprach und erst nach dem Crash der vierten Maschine auftauchte.
Die Untersuchung der gesamten technischen Ungereimtheiten – von den zahlreichen Handyanrufen aus großer Flughöhe, die sendetechnisch nur schwer möglich sind, über die Pulverisierung des gesamten riesigen Boeing-Jets im Pentagon, bei dem dann zwar keine größeren Flugzeugteile, aber angeblich noch alle Passagiere identifizierbar waren, bis hin zu dem gegenüber den Twin Towers liegenden Hochhaus „WTC 7“, das völlig unerklärlich und ohne „Feindeinwirkung“ am Nachmittag des 11. 9. zusammenstürzte.
Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen – ich will es bei diesen offenen Fragen bewenden lassen. Sie zeigen deutlich genug, dass von einer Aufklärung der Verbrechen des 11. 9. bis heute nicht die Rede sein kann, ja, nicht einmal von einer ordentlichen polizeilichen Ermittlung. Die Gründe für diese Nicht-Ermittlung haben wir oben genannt: Am 12. 9. hatte die US-Regierung ihre „Prioritäten“ geändert, am Vorabend soll Bush notiert haben „wir haben heute das Pearl Harbor des 21. Jahrhunderts erlebt“. Von dem Pearl Harbor des letzten Jahrhunderts wissen wir mittlerweile, nachdem die Archive die 50 Jahre lang geheim gehaltenen Unterlagen u. a. über den decodierten japanischen Funkverkehr freigegeben haben, dass die US-Regierung damals über den bevorstehenden Angriff genau informiert war, ihn aber geschehen ließ, um die kriegsunwillige Bevölkerung zum Kriegseintritt zu motivieren. In der historischen Rückschau können wir für diesen schmutzigen Trick gerade als Deutsche nur dankbar sein; ohne Roosevelts Opfer von knapp 3.000 Landsleuten in Pearl Harbor wäre die Befreiung Deutschlands vom Faschismus nicht gelungen. Werden die Historiker der Zukunft – wenn in 50 oder 70 oder 100 Jahren alle unter dem Zauberwort „national security“ verbannten Dokumente eine Aufklärung des Verbrechens ermöglich – dem „Kriegspräsidenten“ Bush ein ähnliches Zeugnis ausstellen?
Ich fürchte nein – auch wenn er mit den Osamas und Saddams stets neue Hitlers als Weltbedrohung aus dem Hut zaubert, und vielleicht demnächst noch ein besonders fettes Kaninchen, termingerecht zur Wiederwahl. Der Mythos, dass 9/11 aus einer afghanischen Höhle organisiert und als Überraschungsangriff ausgeführt wurde – dass also der Schrecken von überall und potenziell jedem droht – ist unabdingbar für die Strategie präventiver imperialer Kriege – und so lange diese in Washington das Maß aller Dinge ist, fürchte ich, werden wir mit der Fiktion, dem Mythos, der Verschwörungstheorie von Osama und der Wilden Neunzehn leben müssen.
[Mathias Bröckers]http://www.broeckers.com
|Vortrag an der Evangelischen Akademie, Bonn-Bad Godesberg, am 7. September 2004|
Mathias Bröckers ist u. a. Autor von „Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Geheimnisse des 11.9.“ sowie „Fakten, Fälschungen und die unterdrückten Beweise des 11.9.“ (zusammen mit Andreas Hauß & Daniel Hopsicker), erschienen bei |zweitausendeins|. Er veröffentlichte zudem zahlreiche Artikel im kritischen Magazin |[Telepolis.]http://www.heise.de/tp |
Siehe auch unsere [Rezension 103 zu „Fakten, Fälschungen und die unterdrückten Beweise des 11.9.“