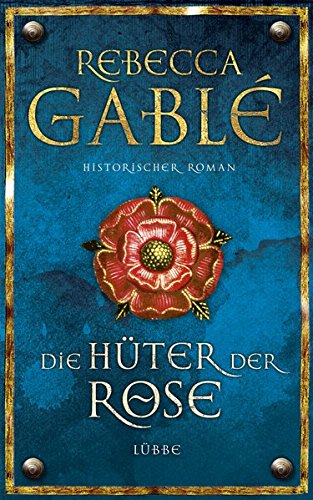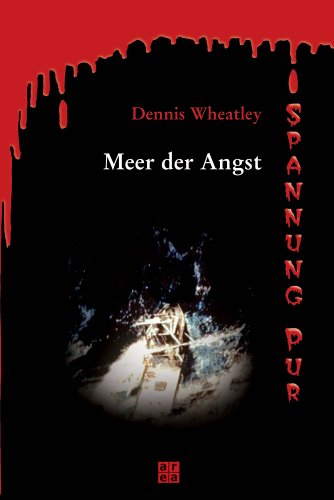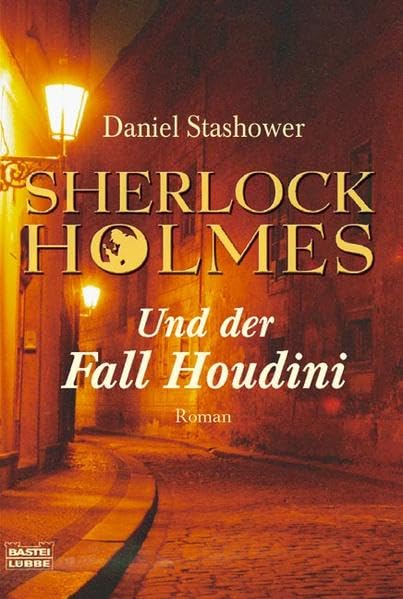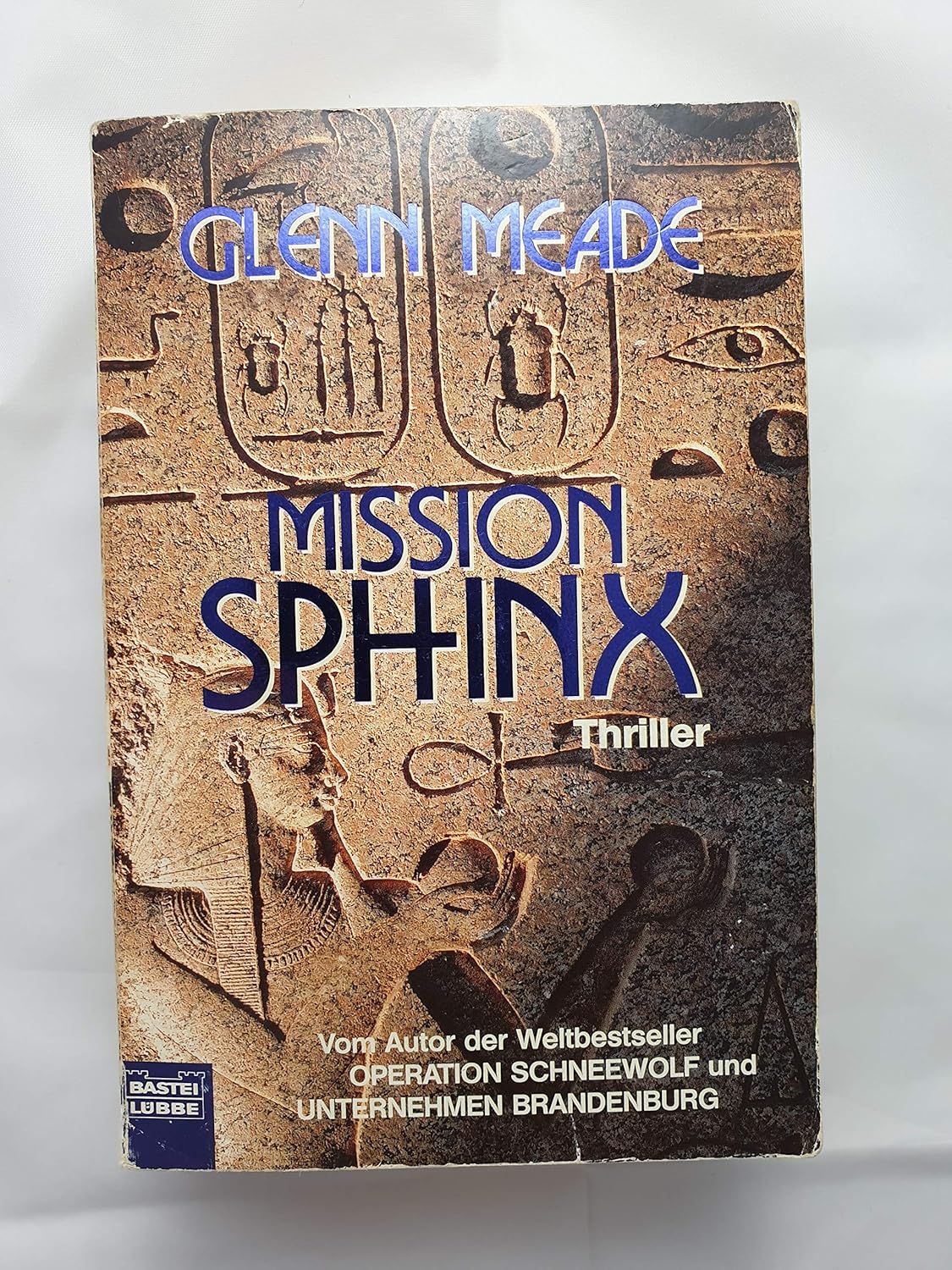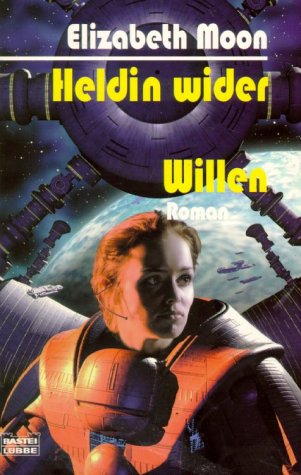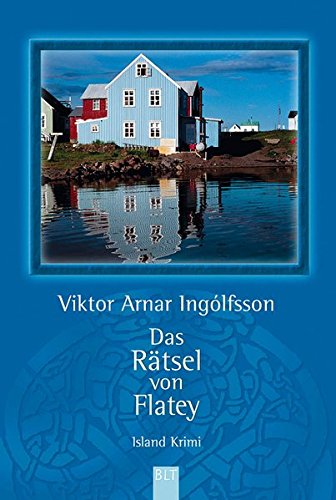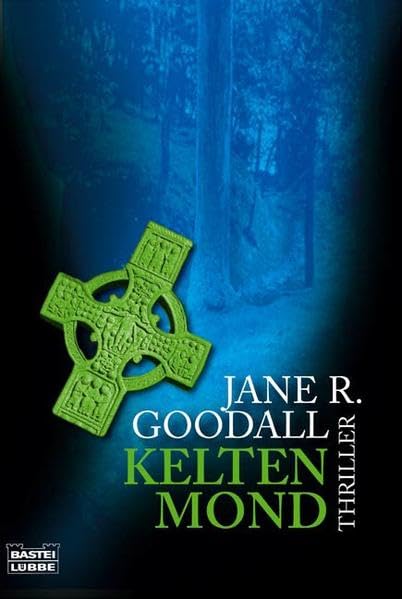
Jane R. Goodall – Keltenmond weiterlesen
Schlagwort-Archiv: Bastei Lübbe
Ian Smith – Der innere Zirkel
Wieder einmal wird Professor William Bledsoe, Naturwissenschaftler und Dozent am Dartmouth College zu Hanover im US-Staat New Hampshire, mit einem hohen Preis ausgezeichnet. Der bescheidene Mann schätzt das Rampenlicht wenig. So stiehlt er sich früh davon, als er gefeiert werden soll, und fährt zu seinem einsam gelegenen Haus im Wald, wo seine Frau auf ihn wartet. Kurz vor dem Ziel, fällt Bledsoe ein am Straßenrand liegengebliebener Wagen auf. Er bietet seine Hilfe an – und erkennt zu spät, dass er in eine Falle geraten ist: Rednecks wollen ihn entführen. Bledsoe kann fliehen, wird jedoch gestellt und umgebracht.
In New York wird Sterling Bledsoe vom Verschwinden seines Bruders informiert. Der FBI-Agent bricht sofort in den Norden auf, um sich in die Ermittlungen der örtlichen Polizei einzuschalten. Als wenig später Williams Leiche gefunden wird, scheint alles auf eine rassistisch begründete Bluttat hinzuweisen: Die Bledsoes sind Afro-Amerikaner, und eine entsprechende Verunglimpfung wurde der Leiche tief in die Brust geschnitten. Ian Smith – Der innere Zirkel weiterlesen
Rick Boyer – Sherlock Holmes und die Riesenratte von Sumatra

Rick Boyer – Sherlock Holmes und die Riesenratte von Sumatra weiterlesen
Manly Wade Wellman – Der Schattensee

Manly Wade Wellman – Der Schattensee weiterlesen
Kathrin Kompisch/Frank Otto – Teufel in Menschengestalt. Die Deutschen und ihre Serienmörder
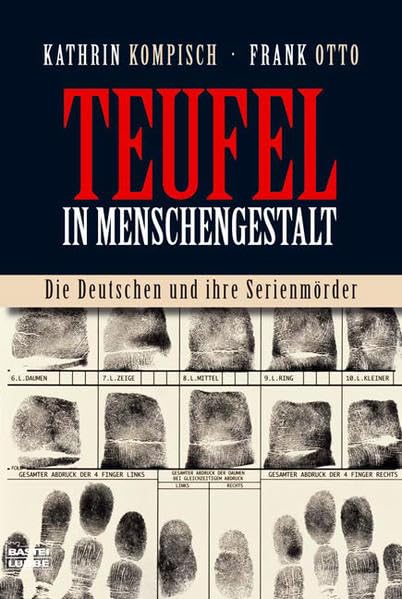
Serienmörder haben Konjunktur. Die Regale der Buchhandlungen biegen sich unter einschlägigen Fallgeschichten, mit denen sich ehemalige Fahnder, Profiler oder Pathologen ein hübsches Zubrot verdienen. Im Kino schlachten die Lecter-Klone, im Fernsehen mussten zeitweise gleich mehrere CSI-Teams bluttriefende Tatorte unter die Lupen nehmen. Auch den Medien sind die Fließband-Killer sehr willkommen, denn sie garantieren Leser- und Zuschauerzahlen.
Wie lange gibt es diese unheilige Symbiose eigentlich schon? In ihrer heute bekannten Form entstand sie nach Kathrin Kompisch und Frank Otto im späten 19. Jahrhundert, als sich die Boulevardpresse vom Journalismus abspaltete. Die Sensation rückte hier in den Mittelpunkt der Berichterstattung, denn vor allem sie sorgte für hohe Auflagen. Der Serienmörder entwickelte sich rasch zum Medienphänomen; nach Ansicht der Verfasser ein Prozess mit ständigen Wechselwirkungen. Kathrin Kompisch/Frank Otto – Teufel in Menschengestalt. Die Deutschen und ihre Serienmörder weiterlesen
Dübell, Richard – Tuchhändler, Der
Im November des Jahres 1475 bereitet sich Landshut auf eine der bedeutendsten und prunkvollsten Hochzeiten des Mittelalters vor: Der Sohn des reichen Herzogs Ludwig von Landshut soll die Tochter des Königs Kasimir von Polen in der reichen Handelsstadt ehelichen. Die Unterbringung der zahlreichen hoch gestellten Gäste samt Hofstaat muss geplant, die Kirche für die Trauungszeremonie hergerichtet, die Versorgung mit den unterschiedlichsten Waren von Nahrungsmitteln bis hin zu Luxusgütern sicher gestellt werden. Sämtliche Beauftragte wie Stadtkämmerer, Baumeister und Richter haben alle Hände voll zu tun, den Termin fristgerecht einzuhalten, und die Entdeckung einer Leiche in der halbfertigen Kirche hätte zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt passieren können.
Was aber schon schlimm genug sein könnte, endet in Entsetzen, als klar wird, wer die Ermordete ist: Die Gräfin Jagiello, die Nichte des polnischen Königs, wurde offensichtlich geschändet und erwürgt – eine Tat, die, sollte sie König Kasimir zu Ohren kommen, die Hochzeit zunichte machen und einen Krieg hervorrufen könnte.
Als der Kaufmann Peter Bernward mitten in der Nacht zu dem Tatort gerufen wird, erwartet ihn sein alter Freund, der Stadtkämmerer Hanns Altdorfer, der ihn sogleich um die Aufklärung des Mordes bittet. In Altdorfers Begleitung befinden sich der Stadtoberrichter Meinhard Girigel, der Kanzler des Herzogs Doktor Mair und der Anführer der polnischen Vorausdelegation, Albert Moniwid. Bernward, ganz und gar nicht von seiner neuen Beschäftigung begeistert, muss sogleich erfahren, dass der Pole nur zu bereit ist, den Vorfall seinem König zu melden. Immerhin lässt sich der halsstarrige Herr dazu überreden, bis zur Ankunft seiner Prinzessin zu schweigen. Sollte bis dahin der Mörder nicht gefunden sein, würde er dem König Bericht erstatten. Zwei Wochen bleiben somit dem Kaufmann für die Aufklärung, der aufgrund seiner Tätigkeit als Untersuchungsbeamter im Dienst des verstorbenen Bischofs von Augsburg für diese Aufgabe ausgewählt wurde.
Ohne einen Anhaltspunkt auf den Mörder oder dessen Motiv versucht Bernward bei der polnischen Delegation Informationen über die Tote zu bekommen, und trifft stattdessen auf eine Frau, die vorgibt, die Zofe der Gräfin zu sein, und wiederum ihm Hinweise zu entlocken versucht. Ein leer stehendes Haus im Zentrum der Stadt erregt ebenso seine Aufmerksamkeit, denn irgendwer scheint sich dort unerlaubt einquartiert zu haben. Seine Beobachtungen bringen ihn selbst in Lebensgefahr, und zwei weitere Morde sowie Moniwids störrisches Verhalten setzen den Kaufmann gehörig unter Druck, den Fall schnellstens aufzuklären. Und doch kommt der entscheidende Hinweis erst wenige Tage vor Ablauf des Ultimatums – von einem Tuchhändler, der Bernward klar macht, dass der Mord irgendwie in direkter Verbindung zu den Ereignissen vom Landshuter Aufstand 60 Jahre zuvor steht und dass der Name des Mörders seinen Preis hat…
_Meine Meinung_
Richard Dübells Debüt ist ein spannender und mitreißender Krimi, der die mittelalterliche Welt wieder in all ihren Faszinationen auferleben lässt. In wenigen Tagen und trotz Zeitmangel habe ich die Geschichte um den sympathischen Kaufmann Peter Bernward in mich eingesaugt. Ein Mann, der unter dem Tod seiner Frau und seines vierten Kindes noch nach einigen Jahren erheblich leidet, und der nach einem traumatischen Erlebnis im Krieg mit Albträumen und Schuldvorwürfen kämpft.
Da der Autor die Ich-Perspektive für den Roman gewählt hat, erlebt der Leser jede Gefühlsregung des Charakters hautnah mit und identifiziert sich binnen kürzester Zeit mit der ausdrucksstarken Persönlichkeit des Kaufmanns. Dadurch entsteht eine sehr angenehme und kurzweilige Atmosphäre, welche die Story von der ersten Seiten an zur Begleitung eines guten Freundes werden lässt. Ich schlotterte innerlich vor Angst, als Bernward überfallen wurde, ich folgte ihm erschöpft nach Hause, wenn der Tag wieder keine weiteren Ergebnisse gebracht hatte, und ich spürte seine neue, langsam erwachende Liebe. Ich freute mich über das ebenso langsam erwachende Vertrauen gegenüber seinen Leuten und ich spürte einen Kloß im Hals, als die Erinnerung an sein Trauma ihn überwältigte.
Die Beobachtungen, die Bernward beschreibt, erwecken Bilder im Kopf des Lesers, die Stadt Landshut erhebt sich lebendig und greifbar aus dem schwarzweißen Muster, das die Buchstaben auf die Seiten zaubert. Der Autor schafft es, den Leser die Stadt – mit ihrem geschäftigen Treiben, ihren dunklen und schmalen Gassen, ihrem freudigen Stolz auf den Bau der Kirche und ihrem starken Ehrgeiz zur Gestaltung einer unvergessenen Hochzeit – mit Haut und Haaren erleben zu lassen, sie zu durchschreiten und zu bewundern. Die Schilderungen ließen in mir den Wunsch entstehen, das damalige Landshut in seinem Reichtum sehen zu dürfen und im heutigen Landshut die Spuren der Geschichte zu suchen.
Unauffällig mischt der Autor geschichtliche Fakten und schriftstellerische Freiheiten – nur Lesern, die sich mit dieser Hochzeit genau beschäftigt haben, werden die kleinen Schummeleien zugunsten der Story auffallen, aber ich denke, niemand würde sie dem Autor verübeln. In seinem Nachwort entschuldigt er sich selbst für seine Abweichungen vom korrekten historischen Pfad und gibt gleich noch zusätzliche interessante Informationen zur damaligen politischen Situation.
Auch sprachlich lässt der Autor keinen Zweifel zu, dass er sein Handwerk versteht. Detailbeschreibungen, die mir so manches Mal einen Roman vermiest haben, werden geschickt mit Dialogen oder Gedankengängen unterbrochen, der Leser lernt seine Umgebung sehr genau, aber nicht auf langweilige Art kennen. Er weiß bereits nach kurzer Zeit, wen der Kaufmann besucht, wenn der Name der Straße fällt. Das Ende eines jeden Kapitels ist der nahtlose Aufhänger des nächsten, und eine Lesepause einzulegen, fiel mir da extrem schwer. Dübell baut von Beginn an Spannung auf, die den Krimi nur selten in ruhige Gewässer fahren lässt, und seine Charaktere springen munter im Kreis herum, um die Fäden der Geschichte zu einem undurchsichtigen Knäuel zu verspinnen, damit die Hinweise auf den Mörder nicht voreilig zu einem bestimmten Namen führen können. Ich jedenfalls hatte bis zum Schluss keinen möglichen Täter gefunden.
Der Kaufmann wurde mein Freund und kaum ein Autor hat bisher so viel Empfinden für seinen Charakter in mir wecken können. Und wenn ich bedenke, dass „Der Tuchhändler“ Dübells Debüt ist, weiß ich wirklich nicht, wie sehr mir die nachfolgenden seiner Bücher an die Nieren gehen werden. Ich hoffe, mindestens genauso stark, denn das macht für mich Lesen aus: hineingezogen zu werden in die Haut einer anderen Person und durch ihre Augen eine neue Welt zu erfahren. Mehr als nur begeistert gebe ich eine glasklare Leseempfehlung ab, und für Fans des historischen Krimi ist dieser Roman so oder so ein zwingendes Muss!
Abschließend möchte ich die sehr sympathisch wirkende [Homepage]http://www.duebell.de von Richard Dübell erwähnen: liebevoll gestaltet, mit vielen Infos zu seiner Person, seiner Familie und seinen Büchern. Die Seite ist also auf jeden Fall einen Besuch wert!
W. J. Maryson – Die Türme von Romander (Der Unmagier 1)

_Inhalt_
W. J. Maryson – Die Türme von Romander (Der Unmagier 1) weiterlesen
Dennis Wheatley – Meer der Angst
Der Dampfer/Seelenverkäufer „Gafelborg“ gerät erst in Seenot und dann in ein abgelegenes Stück Ozean, wo gigantische Tang-Dschungel treiben, in denen Seeungeheuer und andere übelwollende Kreaturen ihr Unwesen treiben … – Britischer „Lost-World“-Klassiker eher trashigen Gruselkalibers, dessen Verfasser sein Garn indes sehr selbstbewusst und auch heute noch unterhaltsam spinnt sowie grottenschlecht-unterhaltsam verfilmt wurde, wobei sogar Hilldegard Knef an Bord dieser „Gafelborg“ ist …
Dennis Wheatley – Meer der Angst weiterlesen
Wendy Morgan – Von schwarzem Herzen
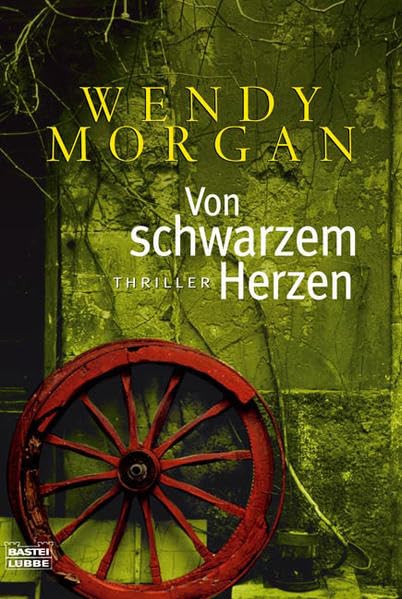
Neal Asher – Skinner: Der blaue Tod

Neal Asher – Skinner: Der blaue Tod weiterlesen
China Miéville – Der Eiserne Rat
In der Welt Bas-Làg gibt es eine Stadt, New Crobuzon, einen Moloch, der als Stadtstaat die mächtigste Organisation ihrer Art ist. Ein anderer Stadtstaat beginnt, New Crobuzon die Herrschaft auf den Meeren streitig zu machen. Betrieben durch elyktrische Kräfte oder Dampf und Segel, liefern sich die Mächte andauernde Seeschlachten, zu Land bekämpfen sich die Heere, die eine neue Ordnung bringen sollen. New Crobuzon versucht, die Macht zu behaupten. Wichtigste Einheiten stellen für sie die Thaumaturgen dar, die Kraft ihres Geistes und allerlei Beschwörungsformeln Macht über Elemente wie Wind oder Wasser oder Elyktrizität besitzen. Doch die andere Seite hat noch unvorstellbarere Mittel, die ihrer Vollendung harren und damit den Untergang New Crobuzons bedeuten würden …
Zwischen die Fronten gerät eine Volkslegende, der Eiserne Rat, der es geschafft hat, sich der Fesseln New Crobuzons zu entledigen und den Häschern zu entkommen. Der Rat gründete sich aus Remade-Sklaven – bio-thaumaturgisch rekonstruierten Wesen – und freien Arbeitern, die sich gegen unzumutbare Bedingungen auflehnten. Das Remaking ist in New Crobuzon eine kunstvoll praktizierte Bestrafung für Verbrecher und Regierungsgegner.
Der Eiserne Rat, ein gigantischer Tross aus Lokomotiven, Wagons und allerlei Volk, das sich den Rebellen zu Fuß angeschlossen hat. Die Schienenleger und Planierer bereiten den Weg für die Stadt auf Rädern, die sich in Fußmarschtempo dahinbewegt. Von hinten werden die Schienen mit Lastkarren wieder nach vorn transportiert, ein ewiger Kreislauf.
Ein Mentor und Mitbegründer des Rats ist Judah Low, ein Golemist, der unbelebte Materie jeder Art zu einem Pseudoleben erwecken und sich dienstbar machen kann. Judah befindet sich in New Crobuzon als Barde des Rats, um die Legende im Volk zu verbreiten und den Keim der Rebellion zu legen. Er ist es, der erfährt, dass der Rat erneut von der Miliz gesucht wird, und er zieht los, um seine Heimat zu warnen. Ihm folgen begeisterte Anhänger aus verschiedenen Gründen: Cutter zum Beispiel ist Judahs junger Liebhaber und folgt ihm, wie er ihm überall hin folgen würde.
Der Rat wird verfolgt, weil der Krieg in der Bevölkerung zu Unruhen führt. Man kann es sich nicht mehr leisten, einen Rebellen ungeschoren zu lassen. Das Vorbild durch den Eisernen Rat soll vernichtet werden …
China Miéville befindet sich wieder in seiner überbordenden Schöpfung, der Welt Bas-Làg. Nach „Perdido Street Station“ (dt: „Die Falter“ und „Der Weber“) und „The Scar“ (dt: „Die Narbe“ und „Leviathan“) soll „Iron Council“ der vorerst letzte Band einer lose über die Stadt New Crobuzon verknüpften Trilogie sein, von der jedoch jeder Teil selbstständig lesbar ist (natürlich sollte man hierbei die Splittung der beiden ersten Teile im Deutschen in je zwei Teile beachten). Nach der Narbe kehrt man nun in die Stadt zurück, doch handelt dieser Teil der Geschichte viele Jahre später.
Der Roman liest sich spannend und flüssig, doch weniger wie Phantastik, als vielmehr wie ein Western. Revolverhelden, Kopfgeldjäger, Spielsucht, Eisenbahner und ihr brachialer Weg durch fremdes Land, ihr Zusammentreffen mit Einheimischen … Trotzdem bleibt die Faszination bestehen, die Miéville mit dieser Welt geschaffen hat. Neue Entartungen schockieren, neue Mächte faszinieren, neue Völker erweitern das Bild der Welt.
Um den Rat selbst dreht sich die Geschichte recht wenig, eher um die Revolution in New Crobuzon, das Verhältnis Cutters zu Judah und dessen Geschichte als Mentor des Rates, mit dem er sich völlig identifiziert und dem er sich jederzeit zu opfern bereit ist.
Was auffällt, ist die Beschaffenheit des Charakters „Judah“: Name, Weltsicht und Fähigkeiten zusammen lassen frappierende Ähnlichkeiten mit dem legendären Juden Rabbi Löw erkennen, ein liebevoller, weiser Vater und Partner, dem das Wohl seiner Vertrauten und seiner Heimat über alles geht. Sowohl der Rabbi als auch Judah Low haben die Fähigkeit, Golems zu erschaffen und ihnen Befehle einzuarbeiten, die bis zur Selbstaufgabe der Golems ausgeführt werden. Und schließlich das Verhängnis Rabbi Löws durch seine eigene Schöpfung – auch hier finden sich entsprechende Verbindungen zu Judah Low. Mit seiner mächtigsten Schöpfung gibt er sich selbst auf – oder verwirkt sein Recht auf Leben, je nach Sichtweise.
Ob es für die anderen Charaktere auch Entsprechungen aus der Weltliteratur gibt, ist nicht ersichtlich. Doch ihr teilweise tragisches Schicksal färbt den Roman in gleicher Weise wie Judahs Einfluss. Miéville verausgabt sich auch nicht an den Mengen handelnder Personen, sondern konzentriert sich auf einige wenige, aus deren Blickwinkel er die Geschichte ablaufen lässt. So haben wir Einblicke in die Gefühle und Gedanken von Normalmenschen, die sich leichter auf die Masse projizieren lassen als die vielleicht reineren und abgehobeneren Beweggründe von Führern.
„Der Eiserne Rat“ ist eine geschickte Mélange aus Dramatik und Erzählung, sein Stimmungsschwerpunkt liegt in der Tragik. Mit jedem Einzelschicksal konfrontiert sich der Leser mit Fehlern in Beziehungen, Scheidepunkten in Lebenswegen und Einflüssen höherer Gewalt, die manchmal nur wenige Auswege offen lassen. Und eines ist sicher: Trotz aller Brutalität und Abstrusität ist Bas-Làg auch eine Welt voller Wunder, die sich zu entdecken lohnt. Sollte es China Miéville gefallen, erneut den Pfadfinder durch diese Welt zu spielen, hat er sich eine große Reisegruppe verdient.
Gentle, Mary – 1610: Der letzte Alchemist
Mary Gentle (* 1956, Sussex) ist spätestens seit der [Legende von Ash, 303 für die sie im Jahr 2000 mit dem |British Science Fiction Award| sowie dem |Sidewise Award for Alternate History| ausgezeichnet wurde, als Spezialistin für die Verschmelzung von Historie und Phantastik bekannt.
Ihre akademischen Abschlüsse in Geschichtswissenschaft des 17. Jahrhunderts (Bachelor) und Kriegswissenschaft (Master) dürften ihr bei der Recherche für ihren neuesten Roman „1610“ nur zum Vorteil gereicht haben, denn eine der schillerndsten literarischen Figuren dieser Zeit hat sie sich zum Helden auserkoren:
Valentin Rochefort, Spion, berüchtigter Duellant und oft auch gedungener Mörder. Bekannt als einer der schillerndsten Antagonisten der drei Musketiere in den Romanen von Alexandre de Dumas, wurde Rochefort auch in zahlreichen Verfilmungen vom Schurken bis hin zum stets gegen d’Artagnan verlierenden Finsterling charakterisiert.
Mary Gentle stellt Rochefort aus einer völlig neuen Sicht dar: Sie lässt ihn und auch andere Handlungsträger aus ihren fiktiven Memoiren erzählen. Rochefort präsentiert sich als ein sehr objektiver und amüsanter, sogar selbstkritischer Ich-Erzähler.
_Königsmörder wider Willen_
Rochefort wird vom Jäger zum Gejagten: Er soll im Auftrag der Königin, Maria von Medici, ein Attentat auf Heinrich IV. verüben. Weigert er sich, wird man seine Vertrauten Maignan und Santon umbringen. Doch Rochefort steckt in einem Dilemma: Als Gefolgsmann des Duc de Sully würde er damit seinen eigenen Herren, der ein gutes Verhältnis zum König pflegt, kompromittieren.
Also beschließt Rochefort, das Attentat zusammen mit dem unfähigen François de Ravaillac durchzuführen, in der festen Gewissheit, dass man diesen töten und das Attentat scheitern wird. Der Rest ist Geschichte: Das Attentat gelingt wider Erwarten, und Rochefort muss aus Frankreich fliehen – gejagt von den Agenten Maria von Medicis wegen Mitwisserschaft und offiziell als vermutlicher Beteiligter an der Ermordung des Königs. Zudem muss Sully ihn für einen Verräter halten.
Begleitet wird Rochefort auf seiner Flucht von dem jungen Duellanten Dariole, den er abgrundtief hasst; da die beiden sich in den vergangenen Tagen jedoch wiederholt für die Öffentlichkeit sichtbar getroffen haben, ist auch Darioles Leben in Gefahr. Auf der Flucht nach England retten sie an der Küste Frankreichs den gestrandeten japanischen Samurai Saburo, der dem englischen König James ein Geschenk überbringen soll.
In England angekommen, geraten die Drei unter den Einfluss des Mathematikers und Astrologen Robert Fludd. Fludd kann die Zukunft berechnen und vorhersagen, und was er sieht, gefällt ihm nicht. Rochefort versucht sich ihm zu entziehen, doch Fludd kennt alle seine Winkelzüge bereits im voraus. Er wird von Fludd erpresst, die Zukunft nach seinen Vorstellungen zu verändern: Er soll König James ermorden; nach Fludds Berechnungen kann nur Rochefort das Attentat erfolgreich ausführen und die Zukunft in die gewünschte Richtung lenken. Doch nicht nur er beherrscht diese häretische Kunst. Die Karmeliterin Schwester Caterina warnt Rochefort: Sollte er James ermorden, wird eine ihm sehr wichtige Person innerhalb eines Monats ebenfalls sterben …
_Historie mit einem Hauch Phantastik_
„1610: Der letzte Alchimist“ ist der sehr unglücklich titulierte erste Band der Übersetzung von „1610: A Sundial in a Grave“. Denn Robert Fludd ist Mathematiker und Astrologe, kein Alchemist, und wer würde einen Rochefort als Hauptperson eines Romans mit diesem Titel vermuten?
Wie bereits „Die Legende von Ash“ wurde das Buch aufgeteilt, leider hielt es |Lübbe| nicht für nötig, darauf hinzuweisen. Bis auf den relativ nutzlosen Vermerk „Teil 1 & 2“ – von wie vielen? Der Übersetzer wird weder im Buch noch auf der Homepage von Lübbe genannt; ob es sich um Rainer Schumacher wie bei „Ash“ handelt, kann man nur vermuten. Das verwundert um so mehr, da die Übersetzung nur eine Bezeichnung verdient: erstklassig. Keine Flüchtigkeits- oder Setzfehler, flüssig zu lesen und stimmig. Was nicht gerade selbstverständlich ist, denn Mary Gentle lässt Engländer, Franzosen und sogar einen japanischen Charakter mit den typischen Redewendungen ihrer Sprache um das Jahr 1610 kommunizieren.
So endet das Buch leider bereits nach der etwas langen Einführung, die jedoch keineswegs langweilig ist. Die Vorstellung Rocheforts ist sehr gelungen, auch die anderen historischen Charaktere können überzeugen, Gentles Eigenschöpfungen Dariole und Saburo geben der Geschichte Würze und Humor. Die Ansichten Saburos über die in seinen Augen ungepflegten „Gaijin“ und der Konflikt zwischen europäischer und asiatischer Kultur, insbesondere bezüglich ihrer Ehrbegriffe, die für einen zwielichtigen Charakter wie Rochefort, der durchaus seine Art von Ehre besitzt, keine Entsprechung hat, sind das Salz in der Suppe. Der Pfeffer ist eindeutig der junge Messire Dariole, der den älteren Rochefort ständig in seinem Stolz verletzt und dessen Mordgelüste weckt, aufgrund der Umstände und seiner Schlagfertigkeit aber stets mit dem Leben davonkommt und einen vor Hassliebe schäumenden Rochefort zurücklässt. Der sprechende Name charakterisiert bereits seine Figur, „Dariolet“ bedeutet im Französischen in etwa Mitwisser, Vertrauter, aber auch Zuckerwerk oder Konfekt.
Bis auf die Prophezeiungen Robert Fludds ist das Buch durch und durch historisch exakt: Die Ermordung Heinrich IV. ist tatsächlich bis heute rätselhaft, man geht von einer Mittäterschaft eines Vertrauten des Königs aus, ansonsten hätte de Ravaillac niemals den König auf offener Straße dreimal niederstechen können. Mary Gentle hat diese Affäre geschickt in die Handlung eingebunden, die so auch abseits ihrer schillernden und unterhaltsamen Charaktere mit ihrer Finesse glänzen kann. Doktor Fludd, Caterina und Rochefort haben sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wie die Zukunft aussehen sollte, während Fludd einen starken König wünscht, will Caterina eine Zukunft ohne Adel und Könige. Rochefort ist das alles gleich, er wird erpresst und steckt in einem Dilemma; wie er sich auch entscheidet, es scheint kein gutes Ende für ihn zu geben.
_Fazit:_
Rochefort ist eine weitaus gelungenere Hauptfigur als Mary Gentles Söldnerführerin Ash. Sie schafft es, den verrufenen Duellanten amüsant und sympathisch wirken zu lassen; der Kniff, die Geschichte aus dem Blickwinkel der Memoiren des sonst als Bösewicht bekannten Rochefort zu erzählen, ist gelungen.
Die historischen Elemente sind vorzüglich recherchiert und in Szene gesetzt, deutlich über den sonst üblichen Standards historischer Romane. Das fantastische Element beschränkt sich auf die mathematischen Zukunftsprognosen Fludds, die jedoch von höchster Brisanz sind. Mary Gentle spielt hier ein historisches Was-wäre-wenn-Spiel, bei dem sie jedoch hohe Voraussetzungen an das geschichtliche Vorwissen ihrer Leser stellt. Der Nachfolger von James I. / Jakob I. war sein Sohn Charles I. / Karl I., der unter dem berüchtigten Lordprotektor Oliver Cromwell enthauptet wurde; in der Folge erklärte das Unterhaus England für eine kurze Zeitspanne zur Republik.
Doch gerade diesen Machtverlust des Königs möchte Fludd verhindern. Ein Fehler in seinen Berechnungen? Mary Gentle erklärt diesen Widerspruch dem Leser an keiner Stelle, bevor das Buch unabgeschlossen endet; auch sonst setzt sie rücksichtslos Kenntnisse der Geschichte des 17. Jahrhunderts voraus. Auch wenn eine Aufteilung der Übersetzung in mehrere Bände nicht ungewöhnlich ist, der Mangel an Informationen über den Titel des Folgebands und der fehlende Hinweis, dass dieses Buch nur einen Teil des Originals darstellt, ist unverschämt und bewusste Irreführung.
Wer über das nötige Geschichtswissen verfügt, sollte dennoch zuschlagen. Ein vergleichbar intelligentes und unterhaltsames Lesevergnügen findet man bei historischen Romanen nur selten. Mary Gentle sprengt erneut die Grenzen des Genres, diese einzigartige Mischung aus Science-Fiction und Historie scheint ihr Markenzeichen zu werden.
Daniel Stashower – Sherlock Holmes und der Fall Houdini
Im April des Jahres 1910 steht das britische Empire auf dem Gipfel seiner Macht. Doch die Regierung weiß um die anstehenden Umwälzungen, die vor allem das aufstrebende Deutsche Reich unter Kaiser Wilhelm II. in den Kreis der Weltmächte drängen lassen. Diplomaten und Spione geben sich im Parlament und bei Hofe die Klinke in die Hand. Zu allem Überfluss lässt der fragile Gesundheitszustand des Königs sein rasches Ende erwarten. Seinem Sohn ist Edward leider nur als Weiberheld ein Vorbild gewesen. Kronprinz George konnte sich keinen unpassenderen Zeitpunkt für seine Liason mit der deutschen Gräfin Valenka aussuchen. Er hat ihr allerlei Briefe geschrieben, die ihn, den baldigen König George V., zu kompromittieren drohen.
Denn man hat sie gestohlen – aus dem hermetisch verschlossenen Tresorraum von Gairstone House, einem Landsitz der Regierung außerhalb Londons! Für Scotland Yard, hier vertreten durch Inspektor Lestrade, steht der Täter fest: Im Savoy-Theater tritt der Illusionist Harry Houdini auf, der als Ausländer ohnehin verdächtig ist sowie sich als Entfesselungskünster weltweit einen Namen gemacht hat. Indizien lassen auf eine Täterschaft des Künstlers schließen. Also setzt Lestrade Houdini fest. Glücklicherweise hat dessen Gattin Beatrice kurz zuvor den bekannten Detektiv Sherlock Holmes engagiert. Daniel Stashower – Sherlock Holmes und der Fall Houdini weiterlesen
Glenn Meade – Mission Sphinx
1939 reist Playboy und Abenteurer Jack Halder, Sohn einer Dame aus der New Yorker Gesellschaft und eines preußischen Großgrundbesitzers, nach Ägypten, um an archäologischen Ausgrabungen teilzunehmen. Begleitet wird er von seinem besten Freund Harry Weaver, dessen Vater als Verwalter für die Familie Halder gearbeitet hat. Im Schatten der Stufenpyramide des Pharaos Djoser lernen sie die Archäologin Rachel Stern kennen und verlieben sich beide in die junge Frau. Die unbeschwerte, gemeinsam verbrachte Zeit endet abrupt, als Hitler seine Truppen in Polen einmarschieren lässt: Der II. Weltkrieg hat begonnen. Die Wege der drei Freunde trennen sich.
Vier Jahre später hat der Krieg seinen Höhepunkt erreicht. Jack Halder ist nach Deutschland zurückgekehrt. Zwar lehnt er das Hitler-Regime ab, aber seit seine Familie einem Luftangriff zum Opfer fiel, hat er den Alliierten Rache geschworen. Er ist zu einem der besten Spione der Abwehr geworden und hat sich auf Unternehmungen im nordafrikanischen Raum spezialisiert.
Rachel Stern musste als Jüdin die volle Grausamkeit des „Dritten Reiches“ erleiden. Daher bleibt ihr kaum eine Wahl, als ihr die Abwehr das ‚Angebot‘ unterbreitet, mit Jack Halder nach Ägypten zu gehen, um dort mit ihm ein hochbrisantes Unternehmen vorzubereiten: In Kairo werden sich im November 1943 US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill treffen – für die Nazis eine Gelegenheit, beide Staatsoberhäupter auszuschalten.
Die deutschen Aktivitäten in Ägypten sind nicht unbemerkt geblieben. Im Generalhauptquartier für den Nahen Osten arbeiten Briten und Amerikaner fieberhaft daran, den Anschlag zu verhindern. Lieutenant Colonel Harry Weaver vom Nachrichtendienst der US-Army wird die Leitung über ein Team übertragen, das die Attentäter entlarven soll. In der Wüste, den Labyrinthen alter Städte wie Kairo oder Alexandria und in den Ruinen Sakkaras beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel. Für Jack, Harry Rachel wird die Auseinandersetzung zu einer besonderen Zerreißprobe. Obwohl sie nun Gegner sind, finden sie erneut zueinander – bis sich herausstellt, dass eine/r von ihnen ein Verräter ist …
Vergangenheit und heikle Vergangenheit
Mit einem historischen Thriller, der zur Zeit des „Dritten Reiches“ spielt, lässt sich das Wohlwollen der Literatur-Kritik besonders in Deutschland schwerlich gewinnen. Angesichts der jüngeren Geschichte ist durchaus verständlich, dass es problematisch kann, die Welt zur Zeit des II. Weltkriegs als Abenteuer-Spielplatz für tapfere Helden und finstere Bösewichte zu benutzen. Das gilt erst recht, wenn auch die Prominenz des „Dritten Reiches“ persönlich auftritt. Die Versuchung ist groß, dieser die Züge typischer Hollywood-Schurken aufzuprägen, was der Handlung eines Romans zum Vorteil gereichen, angesichts des realen Grauens, das diese Männer vor gar nicht so langer Zeit entfacht haben, jedoch leicht einen schalen Nachgeschmack hinterlassen kann.
An dieser Stelle soll nicht erörtert werden, ob die unbekümmerte US-amerikanische oder britische Sicht auf dieses heikle Thema generell zu verurteilen oder unkommentiert zu akzeptieren ist; dies muss jede/r selbst für sich entscheiden. In den genannten Ländern (doch nicht nur dort) ist es jedenfalls legitim, das „Dritte Reich“ als Schablone für reine Unterhaltungsgeschichten zu verwenden. Am besten fährt der kritische Leser wohl, wenn er sich vor Augen führt, dass Meades Nordafrika trotz aller aufwendigen Recherchen (die der Autor in einem Nachwort beschreibt) rein fiktiv ist und mit der zeitgenössischen Realität etwa so viel gemeinsam hat wie das Rom Ben Hurs, der Wilde Westen John Waynes oder die Gotham City Batmans. Der spielerische Einsatz operettenhafter Nazi-Schergen negiert in keiner Weise die banale Bösartigkeit ihrer realen Vorbilder. Nur sehr schlichte oder vom Ungeist übertriebener „political correctness“ angekränkelte Gemüter setzen das eine mit dem anderen gleich.
Thriller mit vorab bekanntem Ausgang
Glenn Meade vermeidet die schlimmsten Fangstricke, indem er „Mission Sphinx“ auf einem Nebenschauplatz des II. Weltkriegs ansiedelt. Schriftstellerische Freiheiten kann man ihm vor der farbigen Kulisse des Nahen Ostens leichter verzeihen. Zwar vermag er der Versuchung nicht ganz zu widerstehen und bringt mit General Walter Schellenberg und Admiral Wilhelm Canaris vom deutschen Sicherheitsdienst zwei reale Figuren der Zeitgeschichte ins Spiel, aber er erspart seinen Lesern den in diesem Genre üblichen, von wagnerianischem Theaterdonner und Schwefeldunst begleiteten Auftritt von NS-Größen wie Göring, Himmler oder gar Hitler selbst.
Ansonsten müht sich Meade entschlossen, das große Manko seiner Geschichte zu überspielen: Da er einen gewissen Anspruch auf historische Genauigkeit erhebt, kann er es sich nicht erlauben, die Realität umzuschreiben. Im Klartext: Der Leser weiß, das alliierte Kommando-Unternehmen wird scheitern, denn weder Roosevelt noch Churchill sind 1943 einem Anschlag zum Opfer gefallen. So gilt es, dieses Scheitern an das Ende einer möglichst packenden Handlung zu stellen, um die Spannung zu erhalten, obwohl zumindest das historische Finale vorgegeben ist. Dies gelingt Meade im Großen und Ganzen gut. Dennoch seien einige kritische Anmerkungen gestattet.
Die dramatisch-tragische Geschichte dreier ‚normaler‘ Menschen in der Hölle des Krieges ist schon tausendfach erzählt worden. In dieser Hinsicht kann Meade mit keinen Überraschungen aufwarten. Sind seine drei Helden wider Willen erst einmal in Nordafrika eingetroffen, löst sich der Plot in eine einzige, vielhundertseitige Verfolgungsjagd auf. „Mission Sphinx“ könnte in diesem Teil um einige hundert Seiten gekürzt und die künstlich aufgeblähte Geschichte zu ihren Gunsten gestrafft werden. Die endlose Jagd durch die Wüste ist reiner Selbstzweck; sie wird wenigstens mit Schwung und Einfallsreichtum abgespult.
Kulissen statt Schauplätze
„Mission Sphinx“ spielt in Nordafrika, einem zumal in der Mitte des 20. Jahrhunderts fernen, fremden Land mit einer uralten, reichen Kulturgeschichte. Davon ist in dem Roman leider nur beiläufig die Rede. Kairo, Sakkara, Alexandria sind für Meade nur klangvolle Namen für exotische Orte aus 1001 Nacht und fantastische Kulissen für die aus Europa und Amerika importierten Helden und Bösewichter. Einige Szenen inmitten malerisch untergegangener Pharaonen-Herrlichkeit sind ein Muss für einen Roman, der in Ägypten spielt – dies unabhängig davon, wie logisch das im Gefüge des Handlungsgerüstes tatsächlich ist.
Der einheimischen Bevölkerung bleibt nur eine Statistenrolle. Als Individuen treten höchstens hinterlistige Handlanger der Nazis oder treuherzige Gehilfen der Helden auf, denen der Autor großzügig ihren Augenblick literarischen Ruhms gewährt, wenn sie eine verirrte Kugel trifft, was gleichzeitig den Guten Anlass für rührselige Gefühlsausbrüche bietet, die ihre edle Gesinnung unterstreichen sollen.
Auffällig sind die Verrenkungen, die Autor Meade unternehmen muss, um die Figur des Jack Halder als tragischen Helden aufzubauen. Deutscher Spion und hochrangiger Angehöriger des Sicherheitsdienstes darf er sein, Nazi aber auf keinen Fall. Also wird aus Halder ein „guter Deutscher“, der Hitler hasst und ihm nur dient, weil er als Soldat dazu verpflichtet ist – so sind sie halt, die Deutschen, wie Meade ‚weiß‘. Der Autor erledigt solche Schwarzweiß-Malereien lieber sofort, ehe er es später für das Drehbuch einer (erhofften) Verfilmung sowieso tun muss.
Diese (und andere, hier unerwähnt bleibende) Klischees mindern das Vergnügen an der Lektüre nicht entscheidend, solange man sich über eines im Klaren ist: „Mission Sphinx“ ist gewiss nicht der Fixstern am Literaturhimmel, als den die Kritik dieses Buch (besonders in den USA) der potentiellen Leserschar verkauft, sondern reine Kolportage – ein Unterhaltungs-Produkt, dessen Umfang eine Bedeutsamkeit suggeriert, die ihm indes nicht zukommt, das seinen eigentlichen Zweck aber hervorragend erfüllt.
Autor
Glenn Meade wurde am 21. Juni 1957 in Finglas, einer Vorstadt von Dublin, geboren, in der hauptsächlich Arbeiter lebten. Eigentlich wollte er Pilot werden, was an einer Augenkrankheit scheiterte. So studierte Meade Ingenieurswesen und bildete in New Hampshire Piloten am Flugsimulator aus. Später wurde er Journalist und schrieb u. a. für die „Irish Times“ und den „Irisch Independent“.
Parallel dazu begann Meade zu schreiben. Zunächst verfasste (und produzierte) er zwölf Stücke für das Strand Theatre in Dublin, mit denen die Darsteller auch auf Europa-Tournee gingen. Anfang der 1990er Jahre inspirierte der Fall der Berliner Mauer Meade zu einem ersten Roman. „Brandenburg“ (dt. „Unternehmen Brandenburg“) erschien 1994 und wurde auch außerhalb Großbritanniens ein Bestseller.
Meade verlegt seine Geschichten gern in die Vergangenheit. In diese Kulissen bettet er konventionelle Thriller-Elemente ein, die er mit ausladenden Liebesgeschichten anreichert. Meade-Romane sind lang und reich – an Handlung wie an Klischees. Wohl genau diese Mischung erfreut ein breites Publikum, weshalb Meades Werke in mehr als 20 Sprachen erscheinen.
Mit seiner Familie lebt und arbeitet Glenn Meade in Dublin und in Knoxville, US-Staat-Tennessee.
Taschenbuch: 748 Seiten
Originaltitel: The Sands of Sakkara (London : Hodder & Stoughton 1999)
Übersetzung: Susanne Zilla
http://www.luebbe.de
Der Autor vergibt: 



Elizabeth Moon – Heldin wider Willen
Jener Sektor des menschlich besiedelten Universums, auf den sich hier unser Augenmerk richtet, wird neofeudal regiert von einer Allianz mächtiger Adelsgeschlechter. Da Usurpatoren & Freibeuter über-All lauern, hält man sich ein schlagkräftiges Militär. Kühne Kommandanten steuern die gewaltigen Raumkreuzer des „Regular Space Service“ dorthin wo’s brennt. Darin brennen schneidige junge Burschen und Mädels in schicken Uniformen für jene ekstatischen Momente zwischen Befehlsausgabe und „Sir-jawoll-Sir!“-Bestätigung.
Zum Heer der hoffnungsvollen Nachwuchs-Kampfhähne und -hennen zählt Lieutenant Esmay Suiza. Sie ist Mitglied einer Familie mit langer Militär-Tradition, aber leider geschlagen mit den Erinnerungen an eine gar schlimme Jugend auf dem Hinterwäldler-Planeten Altiplano und – was schwerer wiegt – mit der Gabe des selbstständigen Denkens, die in Soldatenkreisen seit jeher als Fluch gilt. Neulich ist es Esmay gelungen, nicht nur eine Meuterei an Bord der stolzen „Despite“ zu vereiteln, sondern sogar mit dem unter ihrer Führung zurückeroberten Schiff in eine Raumschlacht zu ziehen und den vielfach überlegenen Feind in die x-te Dimension zu blastern. Eine tolle Leistung, die aber so leider nicht im Militär-Protokoll vorgesehen ist, sodass sich Esmay weder belobigt noch befördert, sondern als Meuterin vors Kriegsgericht gestellt wird: Wo kämen wir dahin, wenn jeder Soldat sich zukünftig vom Menschenverstand leiten ließe? Esmay sieht‘s ein und ergibt sich gefasst in ihr Schicksal.
Weil sie ja trotzdem irgendwie richtig gehandelt hat, stößt man sie nicht ohne Raumanzug aus einer Schleuse der „Despite“, sondern versetzt sie auf das ölige Reparaturschiff „Koskiusko“ irgendwo am Arsch des Spiralnebels Omega Harrington. Da die Lex Kirk – dramatische Ereignisse spielen sich ungeachtet jeder Logik stets dort ab, wo der Held oder die Heldin sich gerade aufhalten – auch in Esmays Universum Gültigkeit besitzt, tauchen die Piraten und Terroristen der gefürchteten „Bluthorde“ auf, die besagtes Schiff erobern und entführen. Die Besatzung unterwirft sich feige den Schurken, aber tief in den Eingeweiden der „Koskiusko“ rührt sich Widerstand. Angeführt von Esmay und ihrer neuen Liebe, dem Haudegen Barin Serrano, stemmen sich die mutigen Krieger gegen die teuflische Übermacht, bis schließlich – man glaubt es kaum – … aber das soll an dieser Stelle Überraschung bleiben …
Disziplin und Abenteuer
Elizabeth Moon blieb es einst überlassen, diesen Rezensenten mit der aufregenden Welt der „Military Science Fiction“ vertraut zu machen. Wenn man schon Neuland betritt, dann besser in Begleitung eines ortskundigen Führers. Moon hat selbst gedient – sogar in Vietnam! Man darf daher davon ausgehen, dass diese Autorin weiß, worüber sie schreibt, wenn sie nun tief eintaucht in die Soldatenwelt der Zukunft. Wer sich nur einigermaßen auskennt im Militärischen, wird mir bestätigen, dass Strukturen und Rituale hier ähnlich stabil und jeglicher historischen Entwicklung enthoben sind wie sonst höchstens in der katholischen Kirche. Somit kann Moon ihr Hintergrundwissen auch vor imaginärem Hintergrund voll ausspielen.
Ungeachtet der Häme, in die der skeptische Rezensent leicht verfällt, wenn es gilt, ein Werk wie „Heldin wider Willen“ zu würdigen, ist dieses Fachwissen ein Wort der Anerkennung wert. Zudem ist Esmay Suiza kein Kampfroboter aus Fleisch und Blut, sondern ein Mensch mit allen positiven und negativen Charaktereigenschaften. Kadavergehorsam & Drill-Masochismus sind seit den Tagen der „Starship Troopers“ glücklicherweise ziemlich out, was andererseits der pazifistisch eingestellten Kritik auch wieder nicht Recht ist: Der Feind, den es zu bekämpfen gilt, soll sich gefälligst weiterhin als Schwein gebärden.
Esmay und ihre Gefährten sind Soldaten – Punkt. Wer mit dieser Ausgangssituation nicht klarkommt, sollte sich die Lektüre von „Heldin wider Willen“ schenken. Zweitens: Esmay & Co. wurden von der Unterhaltungs-Industrie rekrutiert. Moons Geschichte beschäftigt sich nicht mit dem Mikrokosmos Militär, seinen in die Zukunft extrapolierten Regeln oder gar seinen Schattenseiten, sondern ist primär dem kindlichen Spaß an Remmidemmi und Zerstörung geschuldet.
Alte Werte in ebensolchen Schläuchen
Esmays Universum ist ein Abenteuer-Spielplatz, auf dem sich das Gute stellvertretend für die Leserschaft tüchtig austobt und die Bösen anders als in der frustrierenden Realität endlich einmal auf die Bretter schickt. Die Jugendtraumata der Heldin und andere Indizien scheinbarer Tiefgründigkeit sind nichts als Feigenblätter; es ist schick, wenn ein Held eine kleine Macke hat – es lässt ihn oder in unserem Fall sie menschlicher wirken.
Wer die Regel der populärkulturellen Vereinfachung nicht kennt, zwischen Realität und Fiktion nicht trennen will oder gar zu gern über die Verrohung der Welt, die kühl kalkulierte Befriedigung niederer Instinkte & das nahe Ende der Zivilisation lamentiert, liegt ebenfalls falsch bei unserer „Heldin wider Willen“.
Eng wird es für Elizabeth Moon allerdings, wenn man nunmehr kritisch unter die Lupe nimmt, wie sie sich im Rahmen der selbst gewählten Spielregeln schlägt. Hier fällt Nachsicht schwer, da die Verfasserin ihrem Publikum ein gar zu schlichtes Garn vorsetzt. Was da über fast 600 Seiten abrollt, ist buchstäblich eine Räuberpistole, die schon in den Pulp-Magazinen der 1930er Jahre ein wenig zu oft abgefeuert wurde. Dabei ist grundsätzlich nichts gegen eine Wiederbelebung des wunderbaren Weltraum-Schwachsinns à la Flash Gordon einzuwenden. Die „Star Wars“-Saga zeigt, wie man‘s richtig macht, indem man sich nicht gar zu ernst nimmt. Leider meint Moon es jederzeit bitter ernst mit ihrem Krawall-Epos: Witz und Selbstironie sind Elemente, die in der „Military Science Fiction“ jenseits des berüchtigen Landser-Humors ganz und gar nicht geduldet werden.
Die Seele der Soldatin
Richtig übel wird es, wenn Moon Gefühl ins Spiel kommen lässt – oder das, was sie dafür hält, wobei schriftstellerisches Unvermögen eine gewichtige Rolle spielen dürfte. Esmays Reise ins Herz der eigenen Finsternis ist besonders im ersten Drittel und noch einmal im Finale eine qualvoll in die Länge gezogene Lektion in sentimentalem Edelkitsch und unfreiwilliger Komik.
Echter Ärger kommt auf, wenn Moon Esmays ewigen Clinch mit den Vorgesetzten schildert. Diese gebärden sich als Herrscher über das Universum oder wenigstens jene Bereiche, in denen Rangabzeichen getragen werden. Dort verteilen sie zum Besten der Welt und ihrer ruppig geliebten Untergebenen fleißig Arschtritte, für die sie von den auf diese Weise Niedergestreckten umso heftiger respektiert werden. Esmays Befehlshabern unterläuft vielleicht der eine oder andere Fehler, der hier und da ein paar Köpfe rollen lässt, aber sie haben die Autorität und damit letztlich immer Recht: Hier endet zumindest dieses Rezensenten Bereitschaft, in jene Bereiche der SF-Welt vorzudringen, wo er noch nie zuvor war.
Nicht verantwortlich kann die Autorin indes für jene Verwirrung gemacht werden, die den Leser auf den ersten einhundert Seiten immer wieder befällt. Da rekapituliert Esmay ausführlich dramatische Ereignisse, die sie augenscheinlich gerade überstanden hat. Aus dem Text geht klar hervor, dass der Leser eigentlich mehr darüber wissen müsste. Tatsächlich ist „Heldin wider Willen“ der vierte Teil eines groß angelegten Zyklus‘, der sich locker um den Serrano-Clan rankt. Aus unerfindlichen Gründen startet der Bastei-Lübbe-Verlag mittendrin; ob‘s daran liegt, dass unbedingt eine starke Frau à la Honor Harrington in die Riege der verkaufsstarken SF-Helden aufgenommen werden sollte?
Autorin
Susan Elizabeth Norris Moon wurde am 7. März 1945 in McAllen, einer Stadt im Süden des US-Staates Texas, geboren. Nach einem Studium der Geschichte und einem Intermezzo als Rettungs-Sanitäterin drängte es sie 1968 dazu, Nützliches für ihr Land zu tun. Also meldete sie sich erst zum Marine Corps und ging dann nach Vietnam, wo sie allerdings nicht mit Napalm oder M16, sondern am Computer half, möglichst viele „Charlies“ zu erwischen.
1969 kehrte Moon in die USA zurück und heiratete einen ehemaligen Kommilitonen und Kameraden. Mit ihrem Mann zog sie nach dem Ende ihrer aktiven Dienstzeiten in einen Vorort der texanischen Hauptstadt Austin, wo das Paar noch heute lebt. Moon begann ein Biologiestudium, das sie 1975 abschloss.
In den 1980er Jahren begann Moon Kurzgeschichten zu schreiben. „The Sheepfarmer‘s Daughter“ wurde 1986 ihr Romandebüt sowie Startband einer Fantasy-Trilogie. Anschließend widmete sich Moon der „Military Science Fiction“. Vor dem gemeinsamen Hintergrund eines menschlich besiedelten Universums entstanden verschiedene Zyklen, die Abenteuer mit militärischen Werten boten. Bei einem entsprechend gepolten Publikum bereits sehr beliebt, konnte Moon die Literaturkritik erst mit ihrem Roman „The Speed of Dark“ (dt. „Die Geschwindigkeit des Dunkels“) begeistern, der Geschichte eines autistischen Computerprogrammierers, für den sie 2003 mit einem „Nebula Award“ ausgezeichnet wurde.
Elizabeth Moons Website
Taschenbuch: 588 Seiten
Originaltitel: Once a Hero (Riverdale/New York : Baen Books 1997)
Übersetzung: Thomas Schichtel
http://www.luebbe.de
Der Autor vergibt: 




Robin Hobb – Der weiße Prophet (Die zweiten Chroniken von Fitz dem Weitseher III)
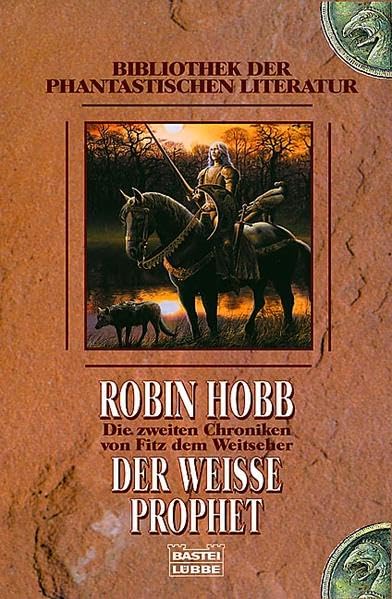
Band 2: Der goldene Narr
außerdem: Der Adept des Assassinen (Die Legende vom Weitseher 1)
und ergänzend: Der Ring der Händler
Prinz Pflichtgetreu hat es nicht gerade leicht. Als einzigem Erben des Weitseher-Throns ist es an ihm, den Frieden zwischen den Sechs Herzogtümern und den Äußeren Inseln der als Piraten gefürchteten Outislander zu schließen. Zumal es noch nicht lange her ist, dass man mit diesen in einen brutalen Krieg verwickelt war, der seinen Vater König Veritas das Leben gekostet hat.
Robin Hobb – Der weiße Prophet (Die zweiten Chroniken von Fitz dem Weitseher III) weiterlesen
Tilman Röhrig – Die Ballade vom Fetzer

Tilman Röhrig fasziniert die Geschichte des Mannes, der sich damals schnell den Beinamen ‚Fetzer‘ einhandelte, von jeher so sehr, dass er irgendwann beschloss, das kurze Leben des Mathias Weber bzw. den Lebensabschnitt, in dem er vom Tagedieb zum Anführer einer Räuberbande wurde, in einem Buch aufzurollen und den in Vergessenheit geratenen ‚Fetzer‘ der heutigen Generation vorzustellen. Die Arbeit des Autors stellte sich dabei als äußerst schwierig und langwierig vor. Nach intensiver Recherche, die fast schon aussichtslos erschien, fand er unter dem Namen ‚Schinderhannes‘ schließlich erste Informationen zu Weber, die er später in einem 61-seitigen Bericht näher intensivieren konnte. Eine halbe Ewigkeit hat Röhrig schließlich damit verbracht, Daten zu sortieren, Informationen zu bündeln, Einzelheiten im Detail zu erforschen und das Leben einer Person, die gerade mal 25 Jahre alt geworden war, lückenlos darzustellen – was ihm schließlich auch hervorragend gelungen ist!
Viktor Arnar Ingólfsson – Das Rätsel von Flatey
Flatey ist eine kleine Insel an der Nordwestküste Islands. Im Jahre 1960 leben hier 40 Menschen, die als Fischer, Vogelfänger und Seehundjäger ihr bescheidenes Auskommen haben. Jeder kennt jeden, Geheimnisse gibt es scheinbar nicht. Doch eines Junitages wird auf dem unbesiedelten Inselchen Ketilsey die fast vollständig skelettierte Leiche des dänischen Historikers Gaston Lund entdeckt. Er hatte Flatey besucht, um dort das in skandinavischen Forscherkreisen berühmte Rätsel des Flateyjarbóks zu lösen. Dies stammt aus dem 14. Jahrhundert und sammelt isländische Sagen und Legenden aus noch älterer Zeit. Das Rätsel ist jünger; seine Lösung ergibt sich aus dem Inhalt des Flateyjarbóks. Noch jeder ist daran gescheitert. Lund sah sich auf einer heißen Spur.
Wieso wurde er auf einer einsamen Insel ausgesetzt, wo er verhungerte und erfror? Der für Flatey zuständige Bezirksamtmann schickt seinen Angestellten Kjartan nach Flatey, einen jungen Mann mit dunkler Vergangenheit, die er sorgsam zu verbergen trachtet. Kjartan ist kein Ermittler und folglich unerfahren in seinem Versuch, Lunds letzte Tage auf Flatey zu rekonstruieren. Die Inselbewohner sind freundlich, aber in ihrer entlegenen Welt ticken die Uhren anders. Es ist die Natur, die ihr Leben bestimmt. Wind, Wasser, die Jahreszeiten – das sind Faktoren, die zählen. Kjartan muss sich dem Rhythmus von Flatey erst anpassen. Viktor Arnar Ingólfsson – Das Rätsel von Flatey weiterlesen
Reaves, Michael / Pelan, John [Hg.] – Sherlock Holmes: Schatten über Baker Street
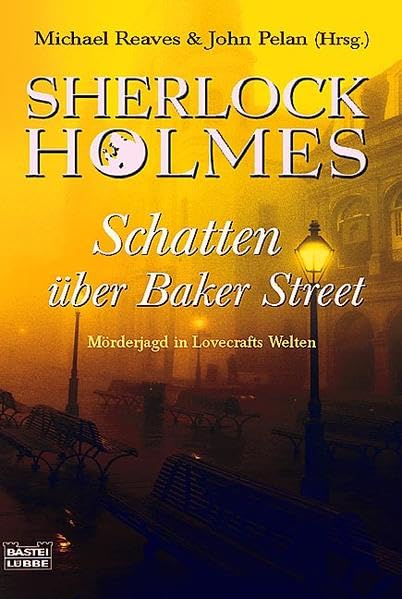
Reaves, Michael / Pelan, John [Hg.] – Sherlock Holmes: Schatten über Baker Street weiterlesen
Rebecca Gablé – Die Hüter der Rose