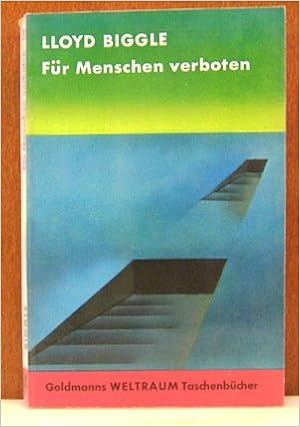Victor Gunn – Gute Erholung, Inspektor Cromwell! weiterlesen
Schlagwort-Archiv: Goldmann
Ben Benson – Die Partie steht unentschieden

Ben Benson – Die Partie steht unentschieden weiterlesen
John Cassells – Der Nebelkreis

John Cassells – Der Nebelkreis weiterlesen
Henry Holt – Die Tongabohne

Henry Holt – Die Tongabohne weiterlesen
Nick Stone – Der Totenmeister
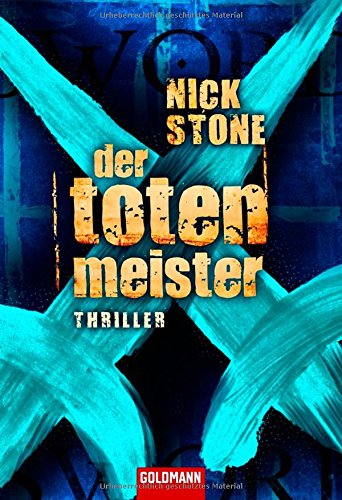
Durch die Sklaverei kam dieser Glauben, der auch für viele Magie beinhaltet – schwarze wie auch weiße, auf die westindischen Inseln. Voodoo ist aber keine „böse“ Religion, oder ein fanatischer Irrglaube, Voodoo beschäftigt sich auch viel mit Medizin, Trance und alternativen, natürlichen Heilverfahren. Inzwischen hat sich der Voodoo-Glauben in vielen Regionen mit den Glaubenslehren des Islams vermischt. Oftmals besonders in afrikanischen Staaten wird der christliche Glaube neben dem Voodoo-Kult praktiziert, und viele Menschen glauben dort an Gott genauso wie an ihre traditionellen Geister des Voodoos.
David Moody – Todeshunger (Hater 2)

Charles Eric Maine – Zwei … eins … null

Das geschieht:
Kaluiki, eine öde Insel irgendwo im tropischen Pazifik. Heiß ist es hier und einsam – gerade der richtige Ort für ein Experiment, das Geschichte machen wird: Abseits allzu neugieriger Sowjets, Chinesen und anderer Kommunisten-Strolche erproben Amerikaner und Briten das erste durch Antischwerkraft ins All zu hievende Raumschiff. „Projekt Agnes“ ist top secret, Kaluiki hermetisch vom Militär abgeriegelt. Nur fünf Wissenschaftler blieben unter der Leitung des genialen Professors Guy Strang auf der Insel zurück, zu ihnen gesellen sich der Sicherheitsoffizier George Earl und der Journalist Russ Farrant, der im Auftrag der beteiligten Regierungen Countdown und Start dokumentieren soll.
Die hochkomplexen Vorbereitungen werden sich über 72 Stunden hinziehen, während derer die sechs Männer und zwei Frauen völlig auf sich gestellt bleiben. Farrant langweilt sich und lässt sich daher gern von Earl rekrutieren, der per Radar eine mysteriöse Metallmasse irgendwo auf der Insel geortet zu haben glaubt. Die beiden Männer finden ein merkwürdiges Flugobjekt, doch bevor sie es näher untersuchen können, werden sie geistig von einer unbekannten Macht unterjocht. Earl attackiert Farrant, der seinen Gegner in Notwehr tötet und sogleich die Erinnerung an diese Tat verliert.
Ahnungslos kehrt Farrant ins Lager zurück, wo bald die Hölle losbricht. Auf brutale Weise wird ein Forscher nach dem anderen umgebracht. Jeder verdächtigt und belauert jeden, aber besonders argwöhnisch wird Farrant betrachtet, der für keine Tatzeit ein überzeugendes Alibi vorweisen kann. Der so Bedrängte kämpft gleich an mehreren Fronten: um seine Unschuld, die geliebte Kay Kinley, die misstrauischen Gefährten und den unsichtbaren, mörderischen Feind, der sich nicht unbedingt als außerirdisch erweisen wird …
Großes Drama auf kleiner Insel
Ganz und gar keine große Literatur, aber ein wunderbares, nostalgisches SF-Abenteuer mit ausgeprägten filmischen Qualitäten legt Verfasser Charles Eric Maine hier vor. Die Geschichte ist wahrlich nicht neu; wir kennen sie aus zahlreichen B-Movies der Jahrzehnte nach dem II. Weltkrieg. Das heißt aber nicht, dass wir sie über haben, wenn sie so gut erzählt wird wie hier!
Maine unterhält überaus ökonomisch: Die Kulisse ist überschaubar, die Grenzen sind abgesteckt. Das Personal beschränkt sich auf acht Personen, die sich nach Gestalt, Charakter und Verhalten klar unterscheiden lassen. Der Plot ist simpel, aber bewährt: eine Invasionsgeschichte, die über weite Strecken dem uralten Prinzip der „Zehn kleinen Negerlein“ (die man heute politisch korrekt sicher nicht mehr so nennen darf) huldigt.
So lange unklar bleibt, wer oder was hinter den Morden & Hirnverbiegungen steckt, funktioniert „Zwei … eins … null“ prächtig. Die finale Auflösung enttäuscht ein bisschen, aber das liegt in der Natur von Mysterien. Sie sind gemeinhin interessanter als die Wahrheit, die hinter ihnen steckt. Viele ‚logische‘ Lösungen gäbe es ohnehin nicht. Maine sei aber dafür gelobt, dass er sich trotzdem bemüht, einen Überraschungseffekt einzubauen.
Vorsicht ist besser als Neugier!
Ansonsten lernen wir, dass Misstrauen stets der beste Begleiter des freien Menschen ist. Lange argwöhnen die in Bedrängnis geratenen Wissenschaftler, dass hinter dem üblen Treiben die bösen Roten stecken, die in dieser Zeit des Kalten Krieges – „Zwei … eins … null“ spielt in der unmittelbaren Zukunft des Jahres 1959 – immer und überall darauf lauern, die Weltherrschaft zu übernehmen.
Der ursprüngliche Titel „The Big Countdown“ ist übrigens eine mit britisch schwarzem Humor aufgeladene Zweideutigkeit. Er beschreibt nicht nur die endlosen letzten 72 Stunden des Projektes „Agnes“, sondern auch die Besorgnis erregende Verminderung der Darstellerriege.
Figuren mit klaren Konturen
Russ Farrant ist der Junge, Kay Kinley das Mädchen, womit wir bereits knapp in Worte gefasst haben, dass „Zwei … eins … null“ auch eine Liebesgeschichte der züchtig-korrekten Art erzählt. Den zeitgenössischen Leser mag Kays wissenschaftliche Bildung und ihre Selbstständigkeit verstört haben, aber keine Sorge: Wenn’s richtig gefährlich wird, muss doch wieder ein echter Kerl ‚ran, und ansonsten träumt auch eine gestandene Forscherfrau eigentlich nur davon, endlich geheiratet zu werden.
Wenn er nicht gerade balzt, ist Russ kein besonders schlauer, aber wackerer Streiter für die Dinge, die wirklich zählen im Leben (Vaterland, Job, Kumpels, die Rettung der Welt). Wie es sich für einen echten Helden gehört, steht er sogleich wieder auf, wenn ihn das Schicksal niederwirft (was hier recht häufig geschieht), und setzt den Kampf fort, bis er endlich – natürlich – den Sieg (und das Mädchen) davonträgt.
Die übrigen Darsteller bilden die typische Riege des vordergründig belebten Kanonenfutters, das über einige kräftige Konturen verfügt, damit sie der Leser auseinander halten kann, aber ansonsten ziemlich gesichtslos bleibt. Sie müssen auch gar nicht so markant sein, denn sie werden ohnehin umgebracht und bescheren dann als Leiche den eigentlichen Hauptfiguren schockierende Momente: Auch das belegt das Niveau, auf dem sich dieser Roman bewegt und dabei sehr unterhaltsam bleibt.
Autor
Charles Eric Maine wurde als David McIlwain am 21. Januar 1921 im britischen Liverpool geboren, verbrachte seine Jugendjahre aber in Indien. Nach der Rückkehr wurde er in den späten 1930er Jahren im Science Fiction-Fandom aktiv und gab u. a. gemeinsam mit den späteren Autorenkollegen John Burke ein Fanzine namens „The Satellite“ (1938) heraus. Außerdem schrieb das Duo SF-Geschichten unter dem Pseudonym Charles Eric Maine, das McIlwain später allein übernahm.
Im II. Weltkrieg diente McIlwain als Signaloffizier in der Royal Air Force. 1943 verschlug es ihn nach Nordafrika. Ins Zivilleben zurückgekehrt, wurde er Fernsehtechniker, freier Journalist mit dem Spezialgebiet Elektronik und später Herausgeber einer Zeitschrift für Radio und Fernsehen.
1952 begann McIlwain seine eigentliche SF-Karriere. Er schrieb Hörspiele als Charles Eric Maine, die er, wie gesagt ein ökonomisch arbeitender Autor, zu Romanen und Filmdrehbüchern umarbeitete. In der Filmwelt kreierte Maine solide Durchschnittsware, darunter den gar nicht uninteressanten „Time Slip“ (1955, dt. „Sieben Sekunden zu spät“) über einen zeitversetzten Unglückswurm oder den unterhaltsam-schundigen „Escapement“ (GB 1957, dt. „Mit 1000 Volt in den Tod“).
David McIlwain blieb als Autor aktiv bis zu seinem frühen Tod am 30. November 1981. Zu den wirklich Großen des SF-Genres kann man ihn nicht zählen, aber er hinterließ eine Reihe gut erzählter, spannender Geschichten, was nicht die schlechteste Grabinschrift für einen Schriftsteller ist.
Taschenbuch: 170 Seiten
Originaltitel: The Big Countdown/Fire Past the Future (New York : Ballantine Books 1959)
Übersetzung: Tony Westermayr
http://www.randomhouse.de/goldmann
Der Autor vergibt: 



Clifford D. Simak – Invasionen

Clifford D. Simak – Invasionen weiterlesen
S. A. Steeman – Die schlafende Stadt
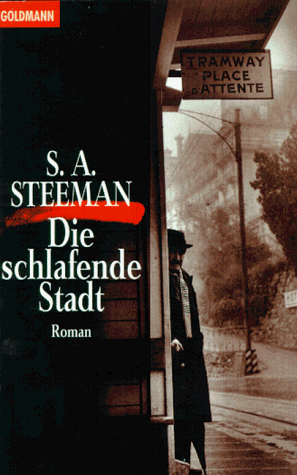
S. A. Steeman – Die schlafende Stadt weiterlesen
Victor Gunn – Der vertauschte Koffer

Victor Gunn – Der vertauschte Koffer weiterlesen
Clifford D. Simak – Shakespeares Planet

Clifford D. Simak – Shakespeares Planet weiterlesen
Anthony Gilbert – Begegnung in der Nacht

Lloyd Biggle – Für Menschen verboten
Im Jahre 1986 gelingt in den (alternativen) Vereinigten Staaten von Amerika die Entwicklung eines bahnbrechenden Verfahrens zur Materieübermittlung: Statt mühsam zu reisen oder transportiert zu werden, können Menschen und Fracht nun per Teleportation in Nullzeit an jeden gewünschten Ort geschafft werden. Diese Erfindung wird nicht nur das Verkehrswesen revolutionieren, sondern alle Aspekte des Alltagslebens verändern. Nicht alle Menschen scheinen davon begeistert zu sein. Privatdetektiv Jan Darzek wird mit einer perfiden Form von Sabotage konfrontiert. Angeheuert hat ihn Ted Arnold, leitender Ingenieur der Teleportations-Gesellschaft, nachdem Reisende zwar abgestrahlt, aber am Zielort nicht empfangen wurden.
Paul Hoffman – Die linke Hand Gottes

Das Leben für die vielen Jungen ist äußert unbarmherzig. Der Kriegerorden kennt so etwas wie Gnade und Erbarmen nicht. Ihre Ausbildung ist voller Enthaltsamkeit, dafür regiert die Gewalt hinter den Klostermauern. Schon von Kindesbeinen an wird ihr Willen systematisch gebrochen, um sie später als Kriegsmaschinen gegen die Antagonisten einzusetzen: Ketzer und Abtrünnige vom wahren und einzigen Glauben an den göttlichen „Erlöser“.
Harry Carmichael – Notausstieg

Harry Carmichael – Notausstieg weiterlesen
Keith Roberts – Der Neptun-Test

Keith Roberts – Der Neptun-Test weiterlesen
Timothy R. O‘Neill – Das Grau der Hölle

Timothy R. O‘Neill – Das Grau der Hölle weiterlesen
J. S. Fletcher – Verbrechen in Mannersley

J. S. Fletcher – Verbrechen in Mannersley weiterlesen
Victor Gunn – Das Wirtshaus von Dartmoor

Victor Gunn – Das Wirtshaus von Dartmoor weiterlesen
J. M. Walsh – Die Nebelbanditen
_Das geschieht:_
Inspektor Quaile von Scotland Yard ist gut beschäftigt: Im dichten Londoner Nebel treibt eine neue, gut organisierte Räuberbande ihr Unwesen. Die „Nebelbanditen“ schalten ihre Opfer mit Betäubungsgas aus und verschwinden spurlos mit fetter Beute. In der Unterwelt raunt man, dass eine junge Frau als Anführerin über die Halunken gebiete.
Frank Slade, der normalerweise für den Geheimdienst tätig ist und Quaile als Assistent zugeteilt wurde, wird durch private Gefühle von der Ermittlung abgelenkt. Er rettet die junge Lady Anne Sanford, als sie ihm auf der Flucht vor dem Erpresser Lanty vor den Wagen läuft, und verliebt sich in sie. Auch Lord Sanford, Annes Vater, steht unter Druck: Er hat sich an der Börse verspekuliert und wird von seinem Gläubiger, dem finsteren Mr. Ashlin, gedrängt, ihm die schöne Anne als Ehefrau auszuliefern; ein Kuhhandel, den diese energisch ablehnt. Die Situation eskaliert, als die Nebelbanditen Lord Sanford überfallen und ausrauben. Weder Ashlin noch Lanty lassen locker, und als Anne eine Verzweiflungstat unternimmt, treibt sie das noch tiefer in die Fangarme der Schurken.
Quaile und Slade nehmen inzwischen über den Hobby-Detektiv Joseph Mallah den Kontakt zur Londoner Gaunerwelt auf. Sie müssen wohl auf eine heiße Spur geraten sein, denn Slades Auto fliegt in die Luft. Der nur knapp entkommene Polizist und sein Vorgesetzter bringen den Grund für solche Nervosität in Erfahrung: Die Nebelbanditen planen einen grandiosen Coup, neben dem ihre bisherigen Raubzüge bedeutungslos wirken werden …
_London bei Nacht: ein Krimi-Klischee-Kaleidoskop_
Er ist dick und gelb und geradezu sprichwörtlich: der Londoner Nebel, der sich im Winter wie eine Glocke aus Dunst und Abgasen über die Stadt legt und eine Intensität erreicht, welche die Sichtweite auf Null reduzieren und die Lungen mit ätzenden Schwefeldünsten füllen kann. Zumindest für diejenigen Zeitgenossen, die das Tageslicht für ihre Geschäfte scheuen, ist der Nebel freilich hilfreich, wie Autor J. M. Walsh anschaulich darstellt: Räuber und Diebe treiben in seinem Schutz ihr Unwesen; sie schleichen sich unerkannt an ihre Opfer heran und flüchten anschließend erfolgreich, während die verfolgende Polizei blind durch die dichten Schwaden stolpert.
Schon 1932 war dieser Nebel freilich auch zum Klischee degeneriert, denn er wurde als Instrument und Stimmungsmittel in Literatur und Film ausgiebig strapaziert, wobei sich vor allem die Routiniers der Unterhaltungsliteratur allzu gern seiner bedienten.
_Schnell voran, damit niemand nachdenkt!_
Walsh muss zu ihnen gezählt werden: ein Vielschreiber, der nicht nur den Krimi-Markt bediente, sondern auch Abenteuer- und Science-Fiction-Storys verfasste. „Die Nebelbanditen“ ist ein typisches Produkt zeitgenössischer ‚Gebrauchs-Literatur‘. Unterhaltsam sollte die Geschichte sein, während das vernunftgemäße Fundament wacklig sein durfte. Walsh packt in die Handlung, was diese vorantreiben kann, während er sich um das Schürzen des Logik-Knotens offensichtlich erst nachträglich Gedanken macht. Nur so lässt sich das Durcheinander erklären, das zeitweilig die Handlung eher verwirrt als bewegt. Es wird verfolgt, erpresst und gedroht auf Teufel-komm-heraus, was der Übersicht gar nicht zuträglich ist, zumal der Leser sich fragt, was dies denn alles mit den Nebelbanditen zu tun hat.
Grundsätzlich wenig, muss das Urteil lauten. Die angeblich so gefährlichen Verbrecher verschwinden immer wieder für viele Seiten aus dem Geschehen. Machen sie sich bemerkbar, dann künden ihre Untaten eher vom Drang aufzufallen als Beute zu machen.
Das Spektakel ist überhaupt Walshes bevorzugtes Stil- und Stimmungselement. Wie sein Zeitgenosse Edgar Wallace geht er lieber sensationell als schlüssig zur Sache: Gangster im Nebel schleudern Gasbomben oder blenden mit flüssigem Ammoniak; eine Autobombe wird platziert, wo eine Revolverkugel wesentlich effektiver wäre; in geheimen Gängen und unterirdischen Gewölben hausen hoch im 20. Jahrhundert unerkannt Banditen. Man tarnt und täuscht mit einer Vehemenz, die man nur als reinen Spieltrieb werten kann.
Gern verlässt Walsh im Sprung eine allzu rätselhafte Szene und beginnt eine neue Verwicklung. Kehrt er später zur offenen Frage zurück, ist gewöhnlich so viel Zeit verstrichen, dass sich das Problem selbst erledigt hat oder mit einigen Sätzen nebenbei abgehandelt werden kann; die Musik spielt ohnehin wieder an anderer Stelle. Nach bewährtem Prinzip werden die losen Fäden im Finale zusammengefasst, was umständliche Erklärungen über viele Seiten erforderlich macht.
_Feine Leute sind anders_
Dass ein Kriminalroman in die Jahre gekommen ist, muss ihm bekanntlich nicht schaden, sondern kann seinen Unterhaltungswert noch steigern. Der einst normale Lebensalltag ist selbst interessant geworden und bildet eine reizvoll altmodische Kulisse, in die sich auch der viel später geborene Leser gut und gern hineindenken kann. Natürlich ist ein Roman kein dokumentarisches Abbild vergangener Wirklichkeit. Es ist nur erforderlich, dass die genannte Kulisse glaubhaft wirkt. In diesem Punkt fragt man sich, wie die zeitgenössischen Leser „Die Nebelbanditen“ beurteilt haben: Selbst mit dem Zugeständnis einer emotionalen Naivität, die viele Romane und auch Filme dieser Zeit prägt, übertreibt es Walsh maßlos. Das London von 1932 war realiter nicht mehr das London der Königin Victoria.
Lord Sanford spekuliert und gibt sich damit als moderner Zeitgenosse zu erkennen. Trotzdem setzt er seine Gesundheit und das Glück seiner Tochter bedenkenlos aufs Spiel, um den Ruf seiner Familie zu wahren. Die Hartnäckigkeit, mit der Vater und Tochter Sanford sich in diesem Punkt immer stärker in die Bredouille bringen, stört und langweilt heute, was durch Annes prompte Ohnmachtsanfälle in ‚heikler‘ Lage gefördert wird. Ein offenes Wort, und die diversen Erpressungsgespinste würden sich schneller auflösen als der Nebel, was allerdings die Handlung zu einem abrupten Ende brächte.
Sympathie vermag keine der zahlreichen Figuren zu wecken. Inspektor Quaile bleibt farblos, Assistent Slade gibt vor allem den verliebten Gutmenschen, der die Maid in Not nicht nur rettet, sondern letztlich heiratet. ‚Normale‘ Polizisten taugen nur zur Fußarbeit. Zu ihrem Glück ist das Gros der Gauner notorisch dumm und kann deshalb regelmäßig eingefangen werden. Die „Nebelbanditen“ verheddern sich in ihrer eigenen Überschläue, hinter der sich ebenfalls jener Hang zum Scheitern verbirgt, der – so macht Walsh deutlich – dem Bösewicht per se innewohnt: Verbrechen lohnt nicht, und zumindest der geistig schlicht gestrickte Leser durfte sich mit dieser Phrase trösten, wenn er das Buch zuklappte. Das präsentieren die Klassiker des Genres wesentlich raffinierter und eleganter, und deshalb werden ihre Werke noch heute aufgelegt, während J. M. Walsh in Vergessenheit geraten ist.
_Der Autor_
James Morgan Walsh wurde am 23. Februar 1897 in Geelong, einer Kleinstadt im australischen Bundesstaat Victoria, geboren. Schon 1913 erschien eine erste Kurzgeschichte, acht Jahre später der erste Roman. 1925 wanderte Walsh nach England aus, wo er sich als Produzent populärer Trivialliteratur etablierte, dessen Romane und Kurzgeschichten vor allem in den „Pulp“-Magazinen dieser Zeit erschienen. Walsh schrieb vor allem Krimis und Spionage-Thriller, verfasste aber auch Sciencefiction. Zumindest als Fußnote ging er mit seiner Space Opera „Vandals of the Void“ (1931) ein, die ein frühes Beispiel für SF aus Australien ist.
Seine Produktivität war so hoch, dass Walsh auch als H. Haverstock Hill, Stephen Maddock und George M. White veröffentlichte. Er blieb auch nach dem II. Weltkrieg bis zu seinem frühen Tod am 29. August 1952 als Autor ungemein aktiv.
_Impressum_
Originaltitel: Lady Incognito (London : Collins 1932)
Übersetzung: Hans Herdegen
Deutsche Erstausgabe: 1935 (Wilhelm Goldmann Verlag/Goldmann’s Detektiv-Romane)
217 Seiten
[keine ISBN]
Diese Ausgabe: 1953 (Wilhelm Goldmann Verlag/Goldmanns Taschen-Krimi Nr. 17)
219 Seiten
[keine ISBN]