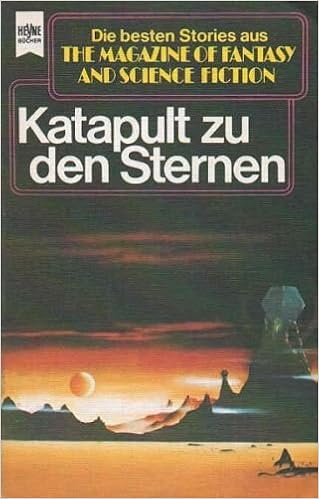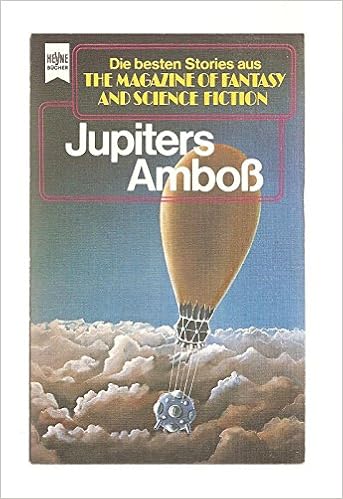Dieser 50. Auswahlband aus dem bekannten amerikanischen SF- und Fantasymagazin bietet folgende Storys:
1) Die Titelstory von der alternden Diva, deren elektronischer Jungbrunnen recht makabere Effekte erzielt.
2) Die Story von dem engelsgleichen buckligen Jungen, den alle mochten, weil ihn die Natur so ungerecht behandelt hatte.
3) Die Story von dem wunderbaren Apparat, der dem Menschen endlich den ewigen Frieden bescherte – um den Preis seiner Privatsphäre.
4) Die Story von der Marsexpedition, deren Teilnehmer eine ganze Weile brauchen, bevor sie erkennen, dass man ihr Kommen längst erwartet hat.
Das Magazin
Das |Magazine of Fantasy and Science Fiction| besteht seit Herbst 1949, also rund 58 Jahre. Zu seinen Herausgebern gehörten so bekannte Autoren wie Anthony Boucher (1949-58) oder Kristin Kathryn Rusch (ab Juli 1991). Es wurde mehrfach mit den wichtigsten Genrepreisen wie dem |HUGO| ausgezeichnet. Im Gegensatz zu „Asimov’s Science Fiction“ und „Analog“ legt es in den ausgewählten Kurzgeschichten Wert auf Stil und Idee gleichermaßen, bringt keine Illustrationen und hat auch Mainstream-Autoren wie C. S. Lewis, Kingsley Amis und Gerald Heard angezogen. Statt auf Raumschiffe und Roboter wie die anderen zu setzen, kommen in der Regel nur „normale“ Menschen auf der Erde vor, häufig in humorvoller Darstellung. Das sind aber nur sehr allgemeine Standards, die häufig durchbrochen wurden.
Hier wurden verdichtete Versionen von später berühmten Romanen erstmals veröffentlicht: „Walter M. Millers „Ein Lobgesang auf Leibowitz“ (1955-57), [„Starship Troopers“ 495 von Heinlein (1959), „Der große Süden“ (1952) von Ward Moore und „Rogue Moon / Unternehmen Luna“ von Algus Budrys (1960). Zahlreiche lose verbundene Serien wie etwa Poul Andersons „Zeitpatrouille“ erschienen hier, und die Zahl der hier veröffentlichten, später hoch dekorierten Stories ist Legion. Auch Andreas Eschbachs Debütstory „Die Haarteppichknüpfer“ wurde hier abgedruckt (im Januar 2000), unter dem Titel „The Carpetmaker’s Son“.
Zwischen November 1958 und Februar 1992 erschienen 399 Ausgaben, in denen jeweils Isaac Asimov einen wissenschaftlichen Artikel veröffentlichte. Er wurde von Gregory Benford abglöst. Zwischen 1975 und 1992 war der führende Buchrezensent Algis Budrys, doch auch andere bekannte Namen wie Alfred Bester oder Damon Knight trugen ihren Kritiken bei. Baird Searles rezensierte Filme. Eine lang laufende Serie von Schnurrpfeifereien, so genannte „shaggy dog stories“, genannt „Feghoots“, wurde 1958 bis 1964 von Reginald Bretnor geliefert, der als Grendel Briarton schrieb.
Seit Mitte der Sechzigerjahre ist die Oktoberausgabe einem speziellen Star gewidmet: Eine neue Story dieses Autors wird von Artikeln über ihn und einer Checkliste seiner Werke begleitet – eine besondere Ehre also. Diese widerfuhr Autoren wie Asimov, Sturgeon, Bradbury, Anderson, Blish, Pohl, Leiber, Silverberg, Ellison und vielen weiteren. Aus dieser Reihe entstand 1974 eine Best-of-Anthologie zum 25-jährigen Jubiläum, aber die Best-of-Reihe bestand bereits seit 1952. Die Jubiläumsausgabe zum Dreißigsten erschien 1981 auch bei |Heyne|.
In Großbritannien erschien die Lokalausgabe von 1953-54 und 1959-64, in Australien gab es eine Auswahl von 1954 bis 1958. Die deutsche Ausgabe von Auswahlbänden erschien ab 1963, herausgegeben von Charlotte Winheller (|Heyne| SF Nr. 214), in ununterbrochener Reihenfolge bis zum Jahr 2000, als sich bei |Heyne| alles änderte und alle Story-Anthologie-Reihen eingestellt wurden.
Die Erzählungen
1) Michael Coney: Die Cinderella-Maschine
Peninsula ist eine Gefängniswelt, wenn auch sehr hübsch mit einem tropischen Klima ausgestattet. Die Häftlinge werden nicht nur als Leibeigene „ausgeliehen“, sondern auch als lebende Organbanken benutzt. Nutznießer ist nicht nur der Ich-Erzähler Joe Sagar, der Knechte beschäftigt, sondern auch seine Bekannte, die alternde Filmdiva Carioca Jones. Die Diva ist Joe verhasst, seit sie die Hände seiner einstigen geliebten Joanne trägt …
Carioca bereitetet eine Art Auferstehung vor. Sie will nicht nur die alten 3D-Filme aus ihrer Jugend zeigen, sondern sich selbst ebenfalls verjüngen. Ein Mann namens Douglas Sutherland führt ihr und Joe seine Maschine vor, die er „Skulptograph“ nennt. Der Computer darin ist nicht nur in der Lage zu berechnen, wie irgendein menschliches Gewebe vor Jahren ausgesehen hat, sondern auch, wie es in der Zukunft aussehen könnte. Joe macht einen kleinen Test: Seine Warze am Finger wird zwar entfernt, aber dafür schält sich danach die abgestoßene Haut.
Als er beim Rennen eine sexy junge Frau aufgabelt, die sich als Carioca entpuppt, ahnt er, dass die Diva ihre Auferstehung ernst meint. Doch er freut sich schon darauf, wie sich ihre Haut schälen wird. Wie schlimm die Sache für sie ausgeht, hätte er sich allerdings nicht in den schlimmsten Albträumen ausgemalt …
|Mein Eindruck|
Die Story ist ein schönes Beispiel dafür, wie man mit nur wenigen Pinselstrichen eine komplexe Kultur zeichnen und ihre Fehler charakterisieren kann. Carioca ist nur der Exponent einer herrschenden Oberschicht von Ausbeutern. Eigentlich sollten wir uns freuen, wenn es ihr schlecht geht, aber das schadenfrohe Lachen bleibt uns im Halse stecken, so geschickt ist die Geschichte vom Autor erzählt. Die bitterböse Pointe hebt er sich für den letzten Satz auf. Carioca ist pars pro toto Opfer der selbst geschaffenen Verhältnisse geworden.
2) Tom Reamy: Der Detweiler-Bub
Bert Mallory ist Privatdetektiv im Los Angeles der sechziger Jahre, als er einen merkwürdigen Anruf erhält. Sein Kumpel Harry Spinner logiert gerade im Brewster Hotel, einer Absteige, als er einen seltsamen Jungen erwähnt, den Bert sich mal ansehen sollte. Als Mallory im Brester eintrifft, findet er Harry mit durchschnittener Kehle vor. Die Hotelbesitzerin, eine alternde, fette Diva, erwähnt diesen „Detweiler-Bub“, der so süß aussieht. Unter einem Vorwand sei er aber schon wieder ausgezogen. Das wird ja immer sonderbarer, findet Mallory. Da er die Sache persönlich nimmt, macht er sich auf die Suche nach dem Detweiler-Bub.
Der ist gar nicht mal so jung, schon über zwanzig, aber die Schwulen im Almsbury Hotel fanden, er habe eine Gesicht wie ein Engel. Rein zufällig ist auch im Almsbury jemand gestorben. Das wundert Mallory schon nicht mehr. In der |Los Angeles Times| der vergangenen vier Monate stößt er endlich auf ein Muster. Alle drei Tage fand ein blutiger Todesfall statt – und immer befand sich ein gewisser Andrew Detweiler in der Nachbarschaft. Er logierte immer nur drei Tage lang.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, mietet sich Mallory in eine Bungalow-Anlage ein, aus der tags zuvor ein blutiger Selbstmord einer jungen Frau gemeldet worden ist. Der Detweiler-Bub logiert in Bungalow Nr. 7. Doch als Mallory mit dem jungen Mann Karten spielt, kann er nichts Schlimmes an ihm feststellen. Der Junge mit dem Buckel und dem Engelsgesicht ist ein Schriftsteller, schreibt Horrorgeschichten. Na, und?
Erst in der Nacht nach dem dritten Tag lüftet sich das Geheimnis …
|Mein Eindruck|
Die Geschichte erinnert mich an Stephen Kings verfilmten Roman „Stark – The dark half“, in der die Hauptfigur, ein Schriftsteller, sich einen finsteren Doppelgänger erfindet, und zwar in seinen Romanen: Machine. Diese andere Hälfte ist zu furchtbaren Taten imstande, die unser Autor niemals wagen würde.
Auch in Tom Reamys Novelle (43 Seiten) hat der Schriftsteller, Detweiler, einen Doppelgänger, einen finsteren Zwilling, der zu finsteren Taten fähig ist. Der Widerspruch zwischen diesem Teufel und dem Engelsgesicht Detweilers ist offensichtlich und symbolisch aussagekräftig. Jeder kann sich selbst einen Reim darauf machen. Aber Detweiler interessiert es nicht, was sein dunkler Zwilling tut – Hauptsache, er gibt ihm, was er selbst braucht. Es ist eine Symbiose. Wenn der eine stirbt, muss auch der andere vergehen.
Die Erzählung liest sich hervorragend, denn Bert Mallory erwähnt nicht umsonst den Detektivroman „Der Malteser Falke“ von Dashiell Hammett, aber erhält sich nicht für dessen Helden Sam Spade, sondern für eine Nummer kleiner. Dieser Selbsteinschätzung zum Trotz leistet Mallory saubere Arbeit, was die Story sehr spannend macht: eben eine klassische Detektivstory, mit viel Blut, vielen Frauen und viel trockenem Humor.
3) Damon Knight: Ich seh dich
Stell dir vor, du hättest einen Guckapparat, mit dem du nicht nur überallhin sehen könntest, sondern auch in jede beliebige Zeit. Nenn‘ das Ding einfach „Gucker“. Es hilft dir, die anderen Kinder zu sehen, wenn sie Verstecken spielen, und es hilft dir bei der sexuellen Aufklärung, wenn du zusiehst, was die Eltern im Bett treiben. Würdest du nicht dem Erfinder dieses tollen Gerätes danken wollen, das es dir erlaubt, alles zu sehen und zu hören, was du dir nur vorstellen kannst?
Jedenfalls bis zu dem Moment, in dem du gewahr wirst, dass du selbst auch beobachtest wirst. Und du merkst, dass auch dein Beobachter beobachtet wird. Und so weiter. Bis in alle Ewigkeit …
|Mein Eindruck|
Damon Knight, ein renommierter SF-Autor und -Herausgeber, hat hier die Idee von Clarke & Baxters Romans [„Das Licht ferner Tage“ 1503 vorweggenommen. Er spielt durch, wie es wohl wäre, wenn es wirklich so einen Apparat gäbe, der nicht nur märchenhaftes Wissen über die Mitmenschen liefern, sondern auch alle Rätsel der Welt lösen würde, beispielsweise den Mord an John F. Kennedy (1963) oder das Rätsel des verlassenen Segelschiffes „Mary Celeste“ (1892). Man bräuchte sich auch nicht mehr auf den Mars zu bemühen oder auf andere fremde Welten. Denn man hat ja den Gucker. So wie heute das TV-Gerät.
Es wäre der absolute Horror und das Ende des Menschseins, wie wir es heute kennen. Nicht nur gäbe es keine Privatsphäre und keine Verbrechen mehr, sondern auch jeden Antrieb, irgendwohin zu gehen, irgendetwas zu verschicken oder in den Fernseher bzw. auf eine Kinoleinwand zu starren. Die Menschen würde paranoid werden, daheim bleiben, dick und fett und krank werden. Gott wäre sowieso als Erstes abgeschafft worden, und Menschen würden nicht mehr heiraten, weil sie ja bereits alle Schwächen des anderen kennen gelernt hätten. Mithin würde nnur noch uneheliche Kinder gezeugt werden – wenn überhaupt.
Stell dir vor, du hättest einen Gucker – und ich würde dich sehen.
4) John Varley: Im Audienzsaal der Marskönige
Die Marsoberfläche. Nach einer Explosion des Kuppelzeltes, die durch Dekrompression drei Viertel des Expeditionskorps tötet, sehen sich die fünf Überlebenden harten Entscheidungen gegenüber. Sie können nicht mehr zum Mutterschiff „Edgar Rice Burroughs“ hinauffliegen, denn Pilot und Kopilotin ihrer Landefähre „Podkayne“ sind tot. Aber sie haben Vorräte für mindestens ein Jahr, bei Rationierung sogar für eineinhalb Jahre, mit Abwürfen der „Burroughs“ sogar noch länger. Sie sind jetzt eine autarke Kolonie.
Die kritischen Faktoren sind jedoch Wasser und Atemluft. Wasser lässt sich aus der Atemluft zwischen Plastikbahnen kondensieren und sammeln. Doch um Atemluft zu produzieren, benötigen sie Pflanzen, welche sie nicht haben. Matthew Crawford, der Historiker, sieht schwarz. Doch seine Gefährten, allen voran die Kommandantin Mary Lang, eine Afroamerikanerin, werfen die Flinte nicht ins Korn, sondern werden von der einheimischen Fauna überrascht. Aus den nährstoffreichen Gräbern der Getöteten erheben sich interessante Gebilde, die wie Windmühlen aussehen: Kreisler. Sie scheinen Wasser zu pumpen. Später gibt es ein Gewächs, das weiße Trauben bildet. Die „Beeren“ enthalten Sauerstoff. Nun haben sie wieder Atemluft, und das Überleben ist gesichert.
Aber für eine Kolonie braucht man auch Paare und Kinder. Diese stellen sich sofort ein, sobald die „Burroughs“, die nichts mehr zu tun hat, wieder zur Erde gestartet ist. Alle ziehen sich nackt aus und treiben es miteinander, bis sich ein Gefühl des Kennens und Vertrauens einstellt. Nach dem Abflauen der Rivalitätskämpfe zwischen den drei Frauen und den zwei Männern stellt sich ein Gleichgewicht her, und es dauert nur acht Monate, bis Lucy McKillian feststellt, dass sie schwanger ist. Aber in welcher Welt wird ihr Baby aufwachsen?
Der Forschungsexpedition, die fast neun Jahre später eintrifft und eigentlich erwartet, nur noch Leichen vorzufinden, steht eine faustdicke Überraschung bevor …
|Mein Eindruck|
Es sind solche Erzählungen in der alten, zuversichtlichen Heinlein-Manier, welche die amerikanische Science-Fiction wieder so attraktiv machten, nachdem sie durch das tiefe Tal der sechziger und frühen siebziger Jahre ging. Dass John Varley ein Heinlein-Jünger ist wie Niven, Pournelle und Spider Robinson, belegt schon der Umstand, dass die Landefähre „Podkayne“ nach der Heldin von Heinleins Jugendroman „Podkayne of Mars“ benannt ist. Und die „Edgar Rice Burroughs“ beschwört die uralte Marsromantik, die der Schöpfer von „Tarzan“ in den Jahren 1912 bis 1943 durch seine vielen Marsromane auslöste.
Anders als bei skeptischen Europäern vom Schlage eines Stanislaw Lem [(„Der Unbesiegbare“) 2795 zeigen sich die Amis auf dem Mars als Pioniere mit Tatkraft und Zuversicht. Als die einheimischen Lebensformen aus dem Boden (und dem 20 Meter darunter liegenden Wassereis) sprießen, erweisen diese sich als an die Menschen angepasst. Gerade so, als wären die Menschen erwartet worden. Wer weiß: Vielleicht haben die Wesen, die diese Sporen zurückließen, einst die Erde während der Steinzeit besucht und wollten die Besucher belohnen.
Hier zeigt sich eine amerikanische Denkweise: Gott (oder Schicksal, Natur usw.) hat vorherbestimmt, dass der Mensch, der sich bemüht, auch belohnt wird, aber nach Gottes eigenem verborgenen Plan. Und der kann ja nun auch Marsbewohner vorsehen. Der grandiose Titel „In the hall of the Martian kings“ wandelt einen Titel aus Edvard Griegs Peer-Gynt-Sinfonie ab, nämlich „In the hall of the mountain king“. Aber wo sind sie, die Marskönige? Kommen sie noch – oder sind sie mit den Pionieren bereits gekommen?
Die Übersetzung
An diesem schmalen Band von nur 140 Seiten waren gleich zwei Übersetzerinnen beteiligt: Birgit Reß-Bohusch und Keto von Waberer. Während Reß-Bohuschs Stil keinerlei Auffälligkeiten zeigt, ist bei Keto von Waberer genau das Gegenteil der Fall. Ich weiß ja nicht, in welcher Gegend man den Ausdruck „wie Schusser in den Höhlen“ (S. 42) gebraucht, aber in Deutschland dürfte er ziemlich wenig bekannt sein. Schusser sind laut DUDEN „Spielkügelchen“, d. h. der Ausdruck bedeutet so viel wie „herumkullern“.
Auf Seite 100 und 101 schreibt Waberer „Rationalisierung“ statt „Rationierung“ bzw. „Rationieren“. Das eine bedeutet „durch Maßnahmen Kosten/Aufwand/Personal etc. einsparen“, das andere „Nahrungsmittel begrenzen und einteilen“ – ein Riesenunterschied, den von Waberer offenbar nicht kannte.
Auf Seite 50 gibt es noch einen blöden Schreibfehler, der die Flüchtigkeit der Übersetzung belegt. Hier heißt es: „ich entdecke, die Spur des Detweiler-Buben …“ statt „ich entdeckte die Spur des D …“. Glücklicherweise war’s das aber auch schon.
Unterm Strich
Drei der vier hier gesammelten Erzählungen sind herausragende Beispiele für die hohe Qualität der Erzählungen während der siebziger Jahre – im Gegensatz zu einigen der Romane wie etwa Nivens „Luzifers Hammer“ oder Heinleins späte Machwerke. Es war eine Zeit des Umbruchs, die Zeit, als Konventionen abgestreift wurden und man nach neuen und aktuellen Ideen suchte; man denke an die Stories von Le Guin, Tiptree/Sheldon und Joanna Russ.
Dem widersprechen jedoch drei der vier Erzählungen in diesem Band. Varley knüpft an die Heinlein-Tradition der Weltraumeroberung an, und Reamy bedient sich der Folie des klassischen Detektivromans, um seine Aussage zu erzählen. Der gute alte Damon Knight erzählt noch in der Form der vierziger und fünfziger Jahre. Seine Story ist die einzige, die über keine Handlung im üblichen Sinne verfügt.
Nur bei Michael Coney kann ich keine alten Vorbilder erkennen, und deshalb ist mir diese Geschichte am sympathischsten. Coney hatte Anfang der siebziger Jahre begonnen, seine Storys zu veröffentlichen – sie sind in „Monitor im Orbit“ gesammelt – und entwickelte seine Kunstfertigkeit und seine Aussagekraft immer weiter, bis solche Werke wie „Die Cinderella-Maschine“ entstanden, die in hochverdichteter Form eine ganze Gesellschaft beschreiben und kritisieren.
Lesetipp
Wem diese Sammlung gefallen hat, der sollte auch zu den Nebula-Preisträger-Auswahlbänden greifen, die ab 1981 bei |Moewig| erschienen, so etwa „Der Plan ist Liebe und Tod“ (Nr. 6730, 1982).
Taschenbuch: 144 Seiten
Originaltitel: The magazine of fantasy and science fiction, 1976/77
Aus dem US-Englischen von Birgit Reß-Bohusch und Keto von Waberer
www.heyne.de
Der Autor vergibt: