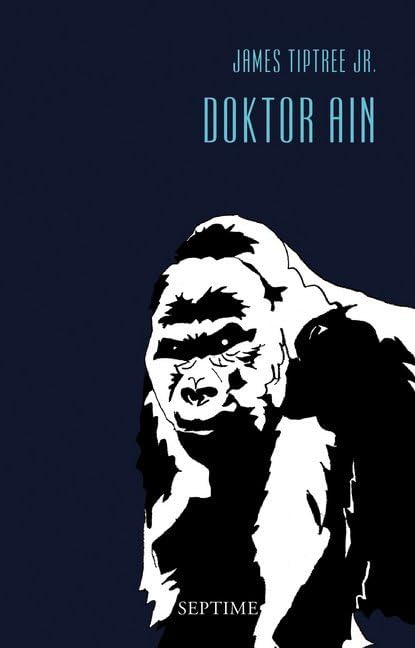
„Doktor Ain“ (Band 1 der Reihe) zeigt die humorvollen Anfänge von James Tiptree Jr. am Ende der 60er-Jahre. Ihre Erzählung ‚Geburt eines Handlungsreisenden‘ war der Durchbruch der Autorin. Ein Zollbeamter in einer interplanetarischen Verladestation, eigentlich Burn-out-gefährdet, muss im Minutentakt entscheiden, wie herkömmliche Güter verpackt werden sollen, da diese in anderen Sonnensystemen durchaus als Kriegserklärung aufgefasst werden könnten oder indiziert sind. Ein Feuerwerk von Pointen und Spitzen werden auf Leserin und Leser losgelassen, wenn man den in jeder Weise multitaskingfähigen Beamten bei der Arbeit beobachtet.
Die in zwei Episoden (‚Hilfe‘ und ‚Mutter kommt nach Hause‘) erzählte Geschichte eines CIA-Büros, das eigens für den Fall einer Landung von Außerirdischen installiert wurde, treibt Leserin und Leser erneut Tränen in die Augen, wenn man den überforderten Protagonisten folgt, als tatsächlich ein UFO die Erde heimsucht. Trotz des Humors, den die Autorin in diese Erzählung packt, hat jedoch auch diese ein nachdenkliches Ende.
Dem gegenüber stehen aber auch die ersten kritischen Texte James Tiptree Jrs. Die titelgebende Erzählung ‚Doktor Ains letzter Flug‘ schildert den von einem Wissenschaftler inszenierten Weltuntergang und die Ausrottung der Menschheit, weil er die Erde liebt.
Sämtliche Erzählungen sind neu übersetzt. Weiters sind hier vier Storys James Tiptree Jrs. erstmals in deutscher Sprache enthalten.… (Verlagsinfo)
Die Autorin
Alice Hastings Bradley Sheldon alias James Tiptree jr. alias Raccoona Sheldon wurde 1915 in Chicago geboren. Ihre Mutter war eine Reiseschriftstellerin, ihr Vater Anwalt. Sie lebte in ihrer Jugend in Afrika und Indien, aber anscheinend war sie lange Jahre für die Regierung, die CIA (bis 1955) und das Pentagon tätig. Im Jahr 1967 machte sie ihren Doktor in Psychologie. Obwohl sie bereits 1946 ihre erste Story veröffentlicht hatte, machte sie die Schriftstellerei erst 1967 zu ihrem Hobby, und nach ihrer Pensionierung schrieb sie weiter bis zu ihrem Tod 1987. Sie beging Selbstmord, nachdem sie ihren todkranken Gatten erschossen hatte.
Obwohl sie einige Romane schrieb, wird man sich an sie immer wegen ihrer vielen außergewöhnlichen Erzählungen erinnern. Ihre besten frühen Stories sind im Heyne-Verlag unter dem Titel „10.000 Lichtjahre von Zuhaus“ (1973) und „Warme Welten und andere“ (1975) erschienen. Unvergesslich ist mir zum Beispiel die Story „Liebe ist der Plan, der Plan ist Tod“, die den Nebula Award 1973 errang. Weitere Geschichten sind in „Sternenlieder eines alten Primaten“, „Aus dem Überall“ und schließlich „Die Sternenkrone“ gesammelt. Ihr Roman „Die Feuerschneise“ (Up the walls of the world, 1978, dt. bei Heyne) erhielt ebenfalls hohes Lob.
Die Erzählungen
Hinweis: Die Erstellungsjahre weichen häufig von den Veröffentlichungsjahren ab, manchmal sogar beträchtlich.
1) Bitte keine Spiele mit der Zeitmaschine! (Please don’t play with the time machine, 1950er, VÖ 1968)
Captain Red Herring atmet erleichtert auf, als er mit der „Ocarina III“ wieder zurück in den Normalraum stürzt. Da entdeckt er zu seiner Bestürzung einen blinden Passagier in seiner Antigrav-Kabine, und zwar Knöchel für Knöchel. An einem der Knöchel befindet sich ein schickes Kettchen… Das Wesen weist seltsame Rundungen an den unerwartetsten Stellen auf und stellt dumme Fragen. Womit diese Kiste denn fliege – mit Kloreiniger? Was er denn da in Händen halte? Eigentlich wollte er das Wesen erschießen, aber was er da in den Händen hält, ist tatsächlich eine Schachtel Pralinen. Es kommt zu einem Handgemenge, dann geht das Licht aus. Das Wesen stellt sich als Fr… vor. Da stellt der Redakteur das Lesen ein, um einen standardmäßigen Ablehnungsbrief zu formulieren und das Manuskript in einem Abfallschacht einzuäschern. Dann flattert er davon.
Mein Eindruck
Diese nette kleine Satire nimmt die Gepflogenheiten männlich besetzter SF-Magazinredaktionen auf die Schippe. Der Redakteur ist ein Alien, soll aber menschliche Prosa bewerten. Diese Prosa hat es ebenfalls in sich: Der Name von Captain Red Herring bedeutet „falsche Fährte“, und was da in seinen Heldenraumschiff eingedrungen ist, scheint ein Fremdwesen vom Typ „Frau“ zu sein, also der Größte Anzunehmende Unfall (GAU) in einer Umgebung, die ausschließlich für männliche Akteure vorgesehen ist.
2) Haltet euch fern mir! Ich bin deren eine, die ermüden (Eine Parodie auf meinen Stil) (Go from me, I am one of those who pall, 1950er, VÖ 1996)
In der Form eines symbolistischen Theaterstücks tritt eine junge Frau auf, die nicht nur splitterfasernackt ist, sondern auch sehr exaltiert. Ihr Bett geht in Flammen auf, doch sie will erstens Milch (obwohl es Sonntag ist), zweitens die Tageszeitung. Sie wirft sich dem Milchmann an den Hals, doch der geht in Flammen auf. Hinter ihrem Haus – das in Flammen aufgeht – liegt das Grab des Zeitungsjungen, auf das die Frau ihr müdes Haupt bettet. Der geist von Ernest Dowson erscheint, und der Geist des Zeitungsjungen erhebt sich aus dem Grab, um zu fliehen.
Mein Eindruck
Ernest Dowson (1867-1900) war ein dekadenter, aber von Stefan George sehr verehrter englischer Dichter und Romancier des Symbolismus. Diesen Fingerzeig sollte der Leser zum Anlass zu nehmen, alle Ereignisse im Stück“ nicht wörtlich aufzufassen, sondern als symbolische Akte. Eine nackte Frau, die alles, was sie berührt, in Flammen setzt, dürfte sexuelles Verlangen versprühen.
Ihre Exaltiertheit war für eine Autorin, die 1915 geboren wurde, nichts Besonderes: Alle Theaterstücke und Stummfilme ihrer Zeit (vor den beiden Weltkriegen) zeigten Jungfrauen in (erotischer) Not, die mit ihrer Unberechenbarkeit einen mehr oder weniger turbulenten Plot in Bewegung versetzten. Ihre Sprechweise war ihrem exaltierten Gemütszustand angemessen, also völlig überkandidelt. Wenn die Autorin also hier ihren „eigenen Stil parodiert“, dann macht sie das mit viel Sinn für Humor. Klar, dass sie damit in den Magazinredaktionen der fünfziger Jahre auf taube Ohren stieß.
3) Geburt eines Handlungsreisenden (Birth of a Salesman, 1967, VÖ 1968)
T. Benedict leitet die Kontrollstelle für den Export in Xenokulturen, kurz KEX. Heute ist hier mal wieder der Teufel los, er selbst und seine „Bürohäschen“ müssen auf Hochtouren schuften. Das optische und das auditive Telefon stehen nicht mehr still. Das terranische Imperium ist eben groß, seine Handelsbeziehungen reichen bis zu Deneb, Altair und Fomalhaut. T. Benedicts Job ist es, Ausfuhrgenehmigungen auszustellen, allerdings nur für sichere Güter. Der Haken dabei: Auf jeder Welt, auf jeder Umladestation gelten andere Normen für das, was „sicher“ bedeutet.
Ein Tintenfisch etwa ist für andere Sinneswahrnehmungen empfänglich als ein Mensch (männlich/weiblich/diverse), ein Denebianer wiederum für andere als ein Tintenfisch usw. Von Qualität ganz zu schweigen. Die erste Kontrolle führt die KEX mit ihren eigenen (menschlichen und außerirdischen) Wissenschaftlern im Labor durch. Dort arbeiten Jim, Splinx und Freggleglegg. Letzterer hat an den Chargen, die Mr. Marmon vorgelegt hat, fünf verschiedene Gefühlsregungen festgestellt. Offenbar hat ein Telepath in der Herstellung von Mr. Marmon die Kisten als K-Objekte benutzt und sie mit entsprechenden Emotionen aufgeladen: Hoffnung, Glück, sexuelle Erregung, schwere Depression und schließlich Heimweh. Ein Wunder, dass der arme Freggleglegg diesen Gefühlssturm überhaupt überlebt hat.
Vor Anfechtungen erotischer Natur bleibt T. Benedict ebenfalls nicht verschont. Miss Krupp von der Joanna Lovebody AG sieht aus wie eine rothaarige Gazelle in einem Silberanzug. TB bricht der Schweiß aus. Miss Krupp oder Klapp oder Krepp – TB kann sich keinerlei Namen merken – möchte ihre weltberühmten Hautcremes zur Nachbarwelt verschiffen. Nach eingehender Analyse und der Zusage, dass die Döschen in die KEX-Standardverpackung umgeladen werden, erteilt TB die Ausfuhrgenehmigung. Allerdings erlebt er damit am Ende dieses langen Tages eine böse Überraschung. Als das Licht ausgemacht wird, beginnen die Döschen, erotische Liebeslieder zu singen…
Mein Eindruck
Dies ist die erste Erzählung, die Tiptree veröffentlichen konnte, und es ist eine ihrer verrücktesten, unbekümmertsten obendrein. Der Text liest sich zwar wie eine Soap Opera auf Speed und besteht fast nur aus Mono- und Dialogen, doch die zahlreichen Einfälle machen die Lektüre zu einem erfrischenden Vergnügen. Man denke beispielsweise an die Star-Trek-Episode „The Trouble with Tribbles“. Ungefähr so lustig geht es hier ab.
4) Schuld (Fault 1967, VÖ 1968)
Bei einem Frachtflug zum Planeten der Shodars rastet der Matrose Mitchell leider aus. Captain John, unser Chronist, hätte den impulsiven Mann nie mitnehmen sollen, aber nun ist es zu spät: Mitchell reißt einem der Shodars die Fühler ab! Es kommt zu einem Prozess, zu einer Verurteilung wegen Kastration und zu einer Strafe.
Zunächst spürt Mitchell nichts, und Captain John ist schon froh, aber dann erweist sich die Strafe als unvorstellbar grausam. Die Shodars haben nicht seine Haftung im Raum verändert, sondern seine Haftung in der Zeit. Folglich erfolgt seine Reaktion immer eine Sekunde zu spät. Zu anfangs jedenfalls. Zwei Jahre später sind aus den Sekunden 20 Stunden geworden. Maggie, Mitchells Frau, unternimmt heldenmütig – oder liebevoll – alles, um ihrem Mann in diese 20-Stunden-Vergangenheit (oder Zukunft?) zu folgen…
Mein Eindruck
Die Story enthält eine verblüffend geschickt ausgeformte Idee, auf die man erstmal kommen muss. Ein Rutschen in der Zeit, dessen Ausmaß allmählich anwächst. Bis die Liebe zwischen Mann und Frau tragische Ausmaße annimmt und sie an Orpheus und Eurydike erinnern, wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen: Sie folgt ihm in die Unterwelt des time-slips. Bewegend und mit einer netten Pointe versehen.
5) Treu dir, Terra, auf unsere Art (Faithful to thee, Terra, in our fashion, 1967, VÖ 1969)
Peter Christmas hat einen stressigen Job. Er ist der Geschäftsleiter des Hauptveranstalters von zahllosen Wettrennen auf Raceworld, dem Planeten für die wichtigsten Wettrennen der Galaxis. Und hier treten nicht irgendwelche Erdlinge gegeneinander an wie einst in Olympia, nein, hier treten alle möglichen Aliens an. Natürlich nur in der jeweils passenden Disziplin und Kategorie, also nicht die kleinen Nager bei den großen Sauriern oder so.
Aber wie das nun mal bei galaktischen (und anderen) Wettkämpfen so ist: geschummelt wird immer und von jedem. Mal ist es Schwerkraftdoping, mal etwas Einfallsreicheres. Und es gilt immer Zwischenfälle zu bewältigen. Als eine Amazone das Wettrennen der Saurier verliert, will sie sich in ihr Schwert stürzen. Peter Christmas kann dies in einer heldenhaften Intervention verhindern.
Kurz danach landet eine Rakete mitten auf der Rennstrecke, ist es zufassen! Die kleinen Nager bringen sich in Sicherheit, die Rakete wird von der Feuerwehr mit Löschschaum zugedeckt. Drei wildgewordene Schimpansen fliegen heraus und zielen mit Lasergewehren auf alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Peter Christmas ist sich nicht zu schade, genau dies zu tun und einen von den Affenartigen auszuschalten.
Seltsamerweise nennt der Abgesandte des Galaktischen Rates Peters Job einen „arkadischen Beruf“! Wo lebt dieses Wesen eigentlich?
Mein Eindruck
Ein wunderbar durchgeknalltes Garn und äußerst flott zu lesen! Streckenweise erinnerte es mich an das Pod-Wettrennen in „Star Wars Episode I“, als Klein-Anakin den anderen Aliens zeigt, was eine Harke ist. Auch „Ben Hur“ stand wohl Pate, denn tatsächlich tauchen hier auch Sicheln an Wagenrädern auf.
Der Titel jedoch weist auf einen ernsten Hintergrund hin: Wozu werden diese „Spiele“ eigentlich abgehalten und wie nahmen sie ihren Anfang? Dieses wohlverborgene Geheimnis Peters wird enthüllt, als zwei Abgesandte aus der Nachbargalaxie an der Redlichkeit der Wettkampfleitung zweifeln. Die Magellaner sind ganz in Schwarz gewandet und tragen Totenkopfschädel. Sie verständigen sich mit Peter durch ein automatisches Übersetzungsgerät, einem Voder, der nicht besonders genau ist.
Als tatsächlich eine Art Betrug auftaucht, äußern die Magellaner ernste Zweifel an den Erdenmenschen, wie Peter einer ist. Er muss erzählen, dass die Terraner ihre eigene Welt durch einen Bruderkrieg verloren und seitdem wie Waisen durch die Galaxis irrten – bis sie auf Raceworld eine neue Basis gründeten. Auf diese Weise hoffen sie, ihrer untergegangenen, verwüsteten Heimatwelt Treue und Ehre (siehe Titel) erweisen zu können, indem sie der Galaxis dienen. Und nun entdeckt Peter zu seinem Entsetzen, wer sie verraten hat… Wieder einmal verrät die Autorin bittere Ironie als Pointe der Story.
6) Dein haploides Herz (Your Haploid Heart, 1967, VÖ 1969)
Zwei Beamte, ausgesandt von der galaktischen Föderation, landen auf der Welt Esthaa. Der junge Pax Patton ist Mineraloge, geradezu ein Pfadfinder, und soll hier eigentlich bloß den Boden untersuchen. Der ältere ist Ian Suitlove, ein Ökologe, der aber auch Beglaubigungs-Beauftragter ist. Sein Auftrag besteht darin, den Esthaanern zu attestieren, dass sie von menschlicher Art sind und somit in die Föderation aufgenommen werden können.
Ian ist durch den Unfalltod seines Vorgängers Harkness gewarnt, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Tatsächlich wundert er sich bald, dass keinerlei esthaanische Frauen zu sehen sind. Und dass man ihm und Pax den Besuch der Flenni verwehrt, die offenbar eine zweite menschliche Art darstellen. Die Flenni sind unterernährt, unterdrückt und unterprivilegiert. Bei einem heimlichen Besuch, der dem Kontaktmann Owanka offensichtlich nicht recht ist, bekommt Ian einen schriftlichen Hilferuf zugesteckt. Seine Befehle verbieten ihm jedoch, sich einzumischen.
Ian wird eines Tages vor den Rat der Esthaaner geladen, und Owanka ist offensichtlich sehr zornig. Auf einer Exkursion in die Berge soll Pax Patton seinen esthaanischen Begleiter ermordet haben. Ian ist ungläubig und verlangt Beweise, die nicht erbracht werden. Fortan steht er praktisch unter Hausarrest, seine Forschungen werden unterbunden. Da er um sein Leben fürchtet, flüchtet er zu den Flenni, die sich vor den wütenden Esthaanern in die Berge zurückgezogen haben.
Dort begegnet er Pax wieder. Der junge Erdling hat sich dem Widerstandskampf der Flenni gegen die Esthaaner angeschlossen, denn er ist überzeugt davon, dass er einen Völkermord verhindern muss. Er hat sogar schon eine schöne Flenni-Gefährtin gefunden. Ian seufzt, denn in Wahrheit verhält sich die ganze Sache völlig anders. Es handle sich nicht um Völkermord, sondern um – doch da wird die Gruppe von einem esthaanischen Fluggerät angegriffen…
Mein Eindruck
Wieviel doch ein halber Chromosomensatz ausmachen kann! Wir Menschen verfügen wegen der zweigeschlechtlichen Fortpflanzung über den doppelten Chromosomensatz, was dazu führt, dass die Gene des einen Satzes Defekte des anderen Satzes ausgleichen können. Doch Flenni und Esthaaner haben jeweils nur einen Chromosomensatz. Sie sind voneinander abhängig, doch die Esthaaner hassen die Flenni, von denen sie abhängig sind, weil sie glauben, dass sie sie weniger menschlich machen – und so die Beglaubigung als Menschen verhindern. Sie schneiden sich ins eigene Fleisch.
Die Story liest sich wie der bekiffte Bericht von einer höchst merkwürdigen CIA-Operation. Die Autorin hat ja für die CIA gearbeitet. Ian Suitlove (Anzugliebe = Beamter) greift wider Willen doch noch in den „Völkermord“ ein, um die völlige Auslöschung der Flenni zu verhindern. Er tut dies auf zwei ziemlich verrückte Weisen. Einmal macht er infernalische Musik, um die akustische Kriegsführung der Esthaaner zu neutralisieren – eine groteske Szene. Zum anderen veranlasst er das schnellstmögliche Eingreifen von Privatleuten, denen er hier eine genetische Sensation verspricht – was ja in gewissem Sinne auch zutrifft. Wie so häufig bei Tiptree/Sheldon gibt es auch hier wieder eine Sexszene – allerdings mit Massensex.
7) Mama kommt nach Hause (Mama come home/The Mother Ship, 1967, VÖ 1968)
Die Aliens sind gelandet und – Schreck, lass nach! – sie sehen genauso aus wie wir. Äh, nicht ganz. Ihr Mutterschiff landet auf dem Mond und entsendet ein Beiboot, das in Mexico City landet. Die versammelten Herrscher und Honoratioren von der UNO staunen nicht schlecht, als dem Raumschiff drei junge Frauen entsteigen, die etwa zwei Meter fünfzig groß sind – inklusive Raumhelm. Nachdem sie ihr Raumschiff per Fernbedienung abgeschlossen haben, gehen sie auf Erkundungstour rund um die Welt.
Unter den Geheimdiensten der Welt hält man wenig von der Begeisterung über die „Mädels von Capella“, die überall auf der Welt ausgebrochen ist. Schließlich ist es der Job der Geheimdienstler, paranoid zu sein. In einer kleinen Außenstelle der CIA nahe Washington, D.C., sitzt unser Chronist Max und bemerkt zu seinem Erstaunen eine erstaunliche Ähnlichkeit der drei Capellanerinnen mit seiner Mitarbeiterin Tillie. Allerdings ist Tillie in jungen Jahren vergewaltigt worden und reagiert seitdem auf männliche Annäherungsversuche wie die von Max allergisch. Aber, sagt sich Max, das schließt nicht aus, dass Tillie als Dolmetscherin fungiert und zum Mond fliegt.
Gesagt, getan. Die Capellanerinnen sind sehr freundlich zu Tillie, die rasend schnell deren Sprache erlernt. Auch Männer sind an Bord, so etwa einer in der Funkzentrale, der aussieht wie Leif Erikson (roter Bart, stämmig, muskulös), aber etwas mut- und kraftlos wirkt. Merkwürdig, dass die Fremden ständig von einer „Mutter“ reden, die heimkommen soll. Und sie behaupten, vor 2000 Jahren schon einmal hier gewesen zu sein. Eigentlich wollten sie ja bloß eine entsprechend alte, aber umstrittene Angabe auf ihren Sternkarten überprüfen, als sie hier landeten.
Max wertet unterdessen die Meldungen aus aller Welt aus, die über die Capellanerinnen berichtet haben. Dabei fällt ihm etwas auf: Mehrmals wurden einheimische Männer zusammengeschlagen, und jedes Mal in einem Park. Max will diese Meldungen prüfen und stellt sich als Versuchskaninchen zur Verfügung. Nachts um zwei im Park: Die zwei „Offizierinnen“ der fremden Kommandantin vergewaltigen ihn auf rücksichtsloseste Weise, und er hat es nur Tillies Eingreifen zu verdanken, dass er noch lebt.
Preisfrage: Wenn die Capellanerin hergekommen sind, um – wie einst die weißen Afrika- und Südseefahrer – männliche Sklaven zu fangen, wie wird man sie dann wieder los? Die geniale Antwort kommt allerdings für die Hunderte von männlichen terranischen Wissenschaftlern, die bereits an Bord des fremden Mutterschiffs gegangen sind, ein wenig zu spät…
Mein Eindruck
Erstaunlich, dass diese wunderbare Geschichte nicht in Harlan Ellisons Anthologie „Dangerous Visions“ aufgenommen wurde, denn diese Story ist mit Sicherheit eines: eine „dangerous vision“. Die Behauptung, dass dominante, großwüchsige Frauen die Männer nicht nur überragen, sondern sie auch noch versklaven und verschleppen könnten, dürfte im Jahr 1968 zu einigen empörten Aufschreien seitens der Leserschaft geführt haben – den Chefredakteur hat’s bestimmt gefreut, denn so etwas steigert stets die Auflage.
Dabei bleibt es allerdings nicht. Ohne allzu viel über die Vertreibungsmethode zu verraten, kann ich doch andeuten, dass auch hier wieder ein sexualpsychologischer Mechanismus zum Tragen kommt. Dabei ist die Autorin in keinster Weise sexistisch. Die sexuelle Psychologie des Menschen ist ja eines der Hauptthemen der Autorin Alice Sheldon. Dass sie selbst einmal für das Pentagon und die CIA gearbeitet hat, ist ihr in der Schilderung der Arbeitsumgebung von Max und Tillie sehr zugute gekommen, denn sie wirkt sowohl glaubwürdig als auch ein wenig ironisch beleuchtet.
Die Story belässt es nicht beim paranoiden Schlagabtausch zwischen zwei Spezies. Auch auf der privaten Ebene wirkt sich die genannte Psychologie aus, aber diesmal positiv. Aus Max und Tillie wird endlich ein Paar, weil Tillie einsieht, was mit ihr los ist und was sie dagegen unternehmen kann.
8) Hilfe (Help/Pupa Knows Best, 1968)
Die direkte Fortsetzung von “Mama kommt nach Hause“.
Der Anfang der Invasion der Aliens ist unscheinbar. Zunächst landen blaue Echsenwesen, die sechs Meter groß sind, auf dem Mond, doch sie reagieren nicht auf Anrufe. Als sie mehrere Bomben in der Atmosphäre der Erde zünden, bekommen sie das Waffenarsenal der Erde zu spüren und ziehen Leine. Aber sie haben eine nicht gezündete Bombe zurückgelassen, deren Aufschrift sie ideal als „Stein von Rosette“ geeignet machen, um die Sprache der Wesen zu erforschen. Dieser Entschlüsselungsvorgang wird während der folgenden Ereignisse fortgesetzt und liefert am Schluss ein erstaunliches Ergebnis.
Dann taucht ein Raumschiff mit buttergelben Aliens auf, das nach Kanada dirigiert wird. Mensch, sind die süüüüüüüüüß! Nur ein Meter zwanzig große Kinder scheinen die Wesen von Cygnus 61 zu sein, und als sie dann auch noch so lieblich zu singen anfangen, schmelzen die Frauen- und Kinderherzen dahin. Selbstredend werden sie zu einer Weltumrundung eingeladen, und überall singen sie ihr Lied. Süß, nicht? Rätsel gibt lediglich die große ovale Kapsel vor ihrem Raumschiff auf, die sie als Großen Pupa bezeichnen – einen Märtyrer.
Das Verhalten eines jungen Außenseiters unter diesen „Siggies“ liefert den ersten verworrenen Hinweis darauf, dass die Aliens ihre Singerei ganz anders verstanden haben wollen. Doch als sie eines Tages in der Kathedrale von Sao Paulo den Altar in die Luft sprengen, ist ihre Botschaft ziemlich deutlich. Sie betrachten die Menschen als Heiden, die es zu bekehren gilt. Sogleich fangen sie mit ihrer Missionierung an. Begleitet von pausenlosen Botschaften sprengen sie eine heilige Stätte nach der anderen in die Luft. Leider kann man sie davon nicht abhalten, denn sie haben einen unsichtbaren Schutzschirm um sich und ihre Einrichtungen errichtet. „Mission durch Fission“, bringt es Mrs. Peabody von der CIA-Außenstelle zynisch auf den Punkt. (Fission = Kernspaltung)
Die Spezialisten bei der CIA sehen schon den Weltuntergang voraus, als ein zweites Schiff mit Siggies auftaucht. Weil sie orangefarben sind, nennt man sie bald die Roten Siggies. Diese Burschen vertreten offenbar eine andere Richtung in der Verehrung des Großen Pupa und greifen die Gelben Siggies an. Dennoch geht die Pulverisierung von Gotteshäusern auf der ganzen Welt weiter. Was tun?
Da entsinnt sich CIA-Agent Max der blauen Echsen und ihrer Botschaft, deren Dekodierung noch im Gange ist. Er berücksichtigt die Lehren der Geschichte zur Ausbreitung von Religionen sowie die Infos des Dekodierers auf dem Mond und was bekommt er? Einen Notfallplan. Daumen drücken!
Mein Eindruck
Nach dem Sex vom anderen Stern nun also die Religion der Aliens. Dabei überträgt die Autorin die Phänomene des 19. Jahrhundert, die mit der Missionierung der „Heiden“, „Wilden“ und „Barbaren“ zu tun haben, einfach auf die Alien-Invasion. Das Resultat ist eine bissige Satire auf eben diesen religiösen Dünkel.
Damit nicht genug. Was passiert, wenn zwei Mächte unterschiedlicher Mächte im „unzivilisierten“ Paradies auftauchen und dort je einen Militärstützpunkt errichten wollen? Max’ Mitarbeiter und seine Frau Tillie sind an Vietnam erinnert, wo alles ja auch mit der Kolonie der Franzosen begann, denen dann die Amis und die Nordvietnamesen folgten.
Es könnte aber auch noch einen Tick schlimmer kommen. Weiß noch jemand über den ursprünglichen Sinn des Wortes „Bikini“ Bescheid, fragt die Autorin am Schluss – eine tolle „punchline“, die direkt unter die Gürtellinie der Amis zielt. Denn das Bikini-Atoll war bekanntlich ein Testgelände für Atombomben. Und irgendwann muss es wohl auch in Besitz genommen worden sein. Wir warten also auf die nächsten Siggies und hoffen, dass sie die Erde nicht als Atomtestgelände verwenden wollen.
9) Doktor Ains letzter Flug (Dr. Ain‘s Last Flight, 1968, VÖ 1969)
Dies ist der Bericht von Dr. Ains Flug und den bemerkenswerten Umständen seines Todes. Schon als er von Omaha/Nebraska nach Chicago flog, will man eine Frau neben ihm gesehen haben. Jedenfalls sprach er mit einer. Und er redete ständig mit ihr, als habe er sie direkt vor sich. Doch niemand kann sich später an sie erinnern. Auf allen Zwischenstationen fütterte er die Vögel auf den Flughäfen aus einer Futtertüte.
Er flog von Chicago über New York und Glasgow nach Moskau auf eine Konferenz von Mikrobiologen. Dort hielt er erst eine miese Rede mit unwissenschaftlichen Klagen über den schlechten Zustand der Erde und brach dann auch noch alle Geheimhaltungsvereinbarungen, als er von seiner Arbeit erzählte. Er habe, so sagte er zum Erstaunen der Zuhörer, einen Leukämievirus mutieren lassen, so dass nur höhere Säugetiere davon betroffen würden. Deren Immunsystem würde ausgeschaltet.
Als er in Hongkong landete, nahmen ihn die Amis fest und brachten ihn wieder nach Omaha, ins Militärhospital. Da war es aber bereits zu spät, für ihn und für die Welt. Die Menschen überall auf seiner Reiseroute und zusätzlich auf den Wanderrouten der Zugvögel, die er gefüttert hatte, begannen zu sterben…
Mein Eindruck
„Dr. Ain“ ist eine der erstaunlichsten Geschichten der SF überhaupt. Sie enthält mehrere Rätsel. Was verfüttert er an die Vögel? Wer ist er überhaupt? Und wer ist die Frau, mit der er sich ständig unterhält? Die Antwort: Diese Frau ist die Erde: Gäa Gloriatrix, seine erotische Geliebte, die er retten will, indem er den Menschen ausrottet. Und der Flug dient der Aussaat dieses Mittels zur Ausrottung. Im Grunde ist Dr. Ains Flug also ein Horrortrip…
10) Diese Nacht und alle Nächte (Last night and every night, 1968, VÖ 1970)
Ein Zombie namens Chick, der nicht sterben darf, hat vom Teufel (das ist nicht ganz eindeutig; es könnte auch ein Engel sein) den Auftrag, neue Bewohner der Hölle zu besorgen. In dieser Nacht geht ihm ein junges Mädchen ins Netz, dem er den ahnungslosen Streuner vorspielt. Da es regnet, führt er es in einen schönes Haus, wo sich der Butler Honky und die Hausherrin Anna des Mädchens annehmen. Kaum ist Chick entlohnt worden und gegangen, beschwert sich Honky bei seinem Auftraggeber: Er möchte endlich aus diesem Teufels Pakt entlassen werden. Ist nicht drin, erhält er Bescheid.
Mein Eindruck
Diese diabolische Geschichte, die an das Vorgehen von Serienmördern erinnert, wirkt wie ein bitterer Anklang an die Rekrutierungsmethoden der Geheimdienste, nur eben auf einer metaphysischen Ebene. Ich hatte erwartet, dass sich das verführte Mädchen als eine emanzipierte Frau entpuppt, die den Spieß umdreht, aber dem ist nicht so.
11) Ein Tag wie jeder andere (A day like any other, 1968, VÖ 1974)
Ein weiteres metaphysisches Wesen schlüpft den ganzen Tag über in verschiedene Rollen, mal in die eines bürgerlichen Mannes, mal in die einer Ehefrau, mal in Kinder. Das verbindende Element ist die Zusammenhanglosigkeit dieser Existenzform.
Zwischen die Episoden sind unvollständige Gedichtzitate eingeflochten, die alle das Wort „Brabbeln“ enthalten, immerhin von Poeten wie W.B. Yeats oder Oliver Goldsmith. Wie der Anmerkung des Übersetzers zu entnehmen, entspricht „Brabbeln“ dem englischen Wort „garble“ des Originals, wobei „garble“ auch „verdrehen, unsinnig machen“ bedeuten kann.
Mein Eindruck
Es ist nicht einfach, diese zwei Seiten Textcollage zu deuten. Hier driftet ein mehr oder weniger metaphysisches Bewusstsein durch die Optionen, die das Dasein bereithält. Es findet wenig Befriedigung in diesem Driften.
Es ist eines jener Experimente, die zur Zeit der New Wave auch in der US-amerikanischen SF auftauchten. Die Briten waren darin etwas konsequenter, etwa J.G. Ballard und Brian W. Aldiss, aber es gab auch US-Autoren wie John Sladek, die der neuen Welle folgten. Dass Tiptree/Sheldon sich dem anschloss, ist mir neu.
12) Beam uns nach Hause (Beam us home, 1968, VÖ 1969)
Lange Zeit wissen die Menschen in Hobies Umgebung nicht, was es mit dem Jungen auf sich hat. Er ist zwar gut in Mathe, Anthropologie und Statistik, aber irgendwie scheint er doch nicht ganz bei der Sache zu sein. Da er Raketen gesammelt und eine Fernglaslinse poliert hat, überrascht es seine Eltern zwar, als er sich zur Luftwaffe meldet, doch sie können es sich wenigstens erklären: Er will Astronaut werden!
Leider wird das Raumfahrtprogramm der Vereinigten Staaten just zu dieser Zeit auf Eis gelegt, denn die Gelder werden für ein paar außenpolitische Krisen benötigt, die sich gerade ergeben. Als entscheidend erweist sich der Krieg gegen die Rebellen in Venezuela. Als die Luftwaffe auch Hobie dort stationiert, darf er wenigstens Fernaufklärung fliegen und muss sich nicht am Kampf beteiligen. So halten sich seine Kopfschmerzen in Grenzen, die er immer bekommt, sobald er zu nahe an die hässliche Wirklichkeit herankommt.
Doch auch ihn erwischt die GG, die Guairas-Grippe, die durch bakteriologische Kampfstoffe ausgelöst wurde. Als die Soldaten einen der Rebellen gefangen nehmen und dieser bei der Landung von Hobies Helikopter bei einem Fluchtversuch erschossen wird, erleidet Hobie einen Nervenzusammenbruch. Gegenüber dem behandelnden Arzt im Lazarett rückt er endlich mit der Sprache heraus. Er habe immer gedacht, er sei von Kirk, Spock und McCoy auf diesen Scheißplaneten abkommandiert worden, um zu kundschaften, aber nie um zu kämpfen. Doch dann hat sich herausgestellt, dass es das Raumschiff „Enterprise“ gar nicht gibt.
Halb im Delirium des Grippefiebers entführt Hobie einen der Bomber und fliegt damit zu den Sternen. „Beam uns nach Haus, Scotty!“ Doch dann verliert das Bewusstsein, gerade als ihm der Treibstoff ausgeht. Er erwacht an Bord eines Raumschiffes, aber es ist nicht die „Enterprise“…
Mein Eindruck
Streckenweise liest sich die Story wie ein Bericht über die Gräuel des Vietnamkrieges, der ja damals – im Jahr 1969 erschien die Erzählung gedruckt – in Südostasien tobte. Dabei fängt die Autorin ganz harmlos an, so als ob sie eine gewöhnliche Heldenbiografie erzählen wolle. Lange fragen wir uns, zusammen mit den anderen Leuten in Hobies Umgebung, was mit ihm wohl nicht stimmen mag. Dabei ist es lediglich nur ein Gefühl, hier auf der Erde nur als Beobachter stationiert zu sein.
Doch die Distanziertheit, die das TV-Programm und seine Erfindungen liefern, löst sich nach und nach auf. Erste Schockmomente werden durch die Zeugenschaft bei einem Mord – das ausländische Hausmädchen von Hobies Familie wird durch Selbstschutzgruppen niedergestochen – ausgelöst. Den Gipfel der „Schocktherapie“ namens Wirklichkeit erreicht Hobies Leben dann im Krieg.
Der Schluss ist sowohl ironisch als auch versöhnlich. Denn der Weltraum erweist sich tatsächlich als bewohnt. Nur eben nicht von Kirk, Spock & Co, sondern von Aliens mit gespaltenen Nasen. Und sie gehen weitaus barmherziger mit Menschen um als deren eigene Leidensgenossen.
13) Glück ist ein wärmend Raumschiff (Happiness is a warm Spaceship, 1968, VÖ 1969 in “Worlds of If”)
Lt. Quent ist der Sohn von Admiral Rathborne Whiting Quent und erwartet daher eine Sonderbehandlung, als er die Raumstation „FSS Adastra“ betritt, um ein neues Kommando als Erster Offizier anzutreten. Er sieht sich bald bitter enttäuscht: Nicht nur muss er die Standardimpfungen nochmal über sich ergehen lassen („feline Mutationen“?!), sondern er bekommt auch ein hundsgewöhnliches Patrouillenboot zugewiesen. Es hört auf den Namen „PB Ethel P. Rosenkrantz“. Obendrein wird er vorgewarnt, dass seine Kameraden gemäß dem neuen Pangalaktischen Abkommen zur Gleichheit ausgewählt worden seien.
Als er an Bord geht, begrüßt ihn ein Bär, der sprechen kann. Er stellt sich nicht als Captain Imray, sondern das tut Svensk, ein glupschäugiger Saurier. Ein weiterer Offizier, der aussieht wie ein Otter, hat offenbar ein Faible für französische Chansons: „Gestatten: Sylvestre Sylla, zu Diensten.“ Der Funker mit dem Ziegenbart stellt sich als Lester Pomeroy vor, eindeutig menschlich. Als ein Mädchen aus der Kombüse durch den Schacht verkündet, das Essen sei fertig, ist Quent leicht erschüttert: eine Frau an Bord?! Er fragt Pomeroy, der sie vorstellt: Mellicent Appleby. Ebenfalls gleichberechtigt.
Frühstart
Quents Check für den Start wird vorzeitig abgebrochen, denn die PB Rosenkrantz muss einem anderen PB Platz machen, das schwer lädiert ist. Und los geht’s! Der Sektor ist eine Art Tortenstück, das vom Base Camp der „Adastra“ bis an den Rand des erforschten Föderationsgebiets reicht. Fähnrich Pomeroy kennt die Gegend wie seine Westentasche, auch die schlimmen Regionen. Doch manche Sektoren des eigenen Schiffs, so stellt Quent bei einem Rundgang fest, sind für ihn off-limits: Dazu gehört Miss Applebys Wohnquartier sowie der Maschinenraum, den ein Wesen namens Morgan beherrscht. Die Grenze in dessen Territorium zu überschreiten, erweist sich als keine gute Idee.
Der Ärger beginn erst auf der letzten Grenzwelt Sopwith. Angeblich sollen Piraten von jenseits der Sektorgrenze Dörfern niedergebrannt, Einwohner entführt und sie schließlich verspeist haben. „Ammenmärchen!“, faucht Quent wütend, als er von der ersten Erkundung zurückkehrt. Er wittert eine Verschwörung gegen ihn und seinen Vater, den Admiral. Captain Imray ist krank und hat ihm das Kommando übergeben, steckt er also mit Svensk und Sylla unter einer Decke? Die Verschwörung gibt es zwar tatsächlich, doch sie dient einem ganz anderen Zweck…
Mein Eindruck (SPOILER!!)
Die Generalthemen Gleichheit, Rassismus, Integration, Diversität und Neokolonialismus bewegen den Großteil der Menschheit bis heute. In Tiptrees Novelle finden die Figuren jedoch einen wunderbaren Mittelweg, der allen Beteiligten gerecht wird. Quent hat einen prophetischen Alptraum, in dem ihn die Medien von „Gal News“ als Galionsfigur für die Verteidigung gegen Nichtmenschen (NMs) hinstellen werden, obwohl sein Vater ja Rassist ist und das Pangalaktische Abkommen zur Gleichheit vehement ablehnt. Wenn er seinen Vater brüskiert, kann Quent seine Karriere vergessen. Was ist zu tun?
Die NMs haben bereits einen Plan, und dieser beruht auf Quents Bemerkung, er würde sich „am liebsten in Luft auflösen“. Quent und die Crew müssten nur unbemerkt das Schiff austauschen… Die NMs verfolgen schon lange einen Plan, wonach nicht die Menschen die NMs integrieren, indem sie sie unterjochen, sondern wonach umgekehrt die NMs die vordringenden Menschen zunehmend integrieren und assimilieren, um so für Frieden und Überleben zu sorgen. Nur für Sonderlinge wie Morgan, den Maschinisten, gelten solche Pläne nicht, denn sie wollen lieber strikt für sich bleiben. Und wenn man Morgan seinen Willen lässt und ihm etwas gut zuredet, dann bekommt man auch, was man sich wünscht. Man muss nur den nötigen Respekt vor dem jeweils anderen aufbringen.
Tja, Quent segelt nun unter falscher Flagge – ein Vorgang, mit dem sich eine CIA-Mitarbeiterin wie Tiptree bestens auskannte. Und da er sich nun „in Luft aufgelöst“ hat, ist es besser, wenn er den angrenzenden Sektor erforscht. In Sektor 13Z gibt es noch jede Menge „wilde Zonen“ zu sichern…
Dies ist eine der witzigsten und intelligentesten Geschichten über Rassismus, Gleichheit für alle (besonders Frauen) und Freiheit. Und dies bereits anno 1968. Deshalb sollte es nicht verwundern, dass es mittlerweile ein Spiele-Universum gibt, das sich nach dem Originaltitel ebenfalls „Happiness is a warm spaceship“ nennt. Diese Phrase hat große Ähnlichkeit mit John Lennons Songtitel „Happiness is a warm gun“ auf dem Weißen Album aus dem Jahr 1968. Die Autorin konnte ihn durchaus gekannt haben.
14) Ich bin zu groß, aber ich spiele gern (I’m too big but I love to play, 1968, VÖ 1970)
Ein Präsident wendet sich an Jack (gemeint ist Jaqueline) mit der Beschwerde, er fühle sich zu groß und blicke auf die Menschen wie auf winzige Spielfiguren hinab. Bestimmt liege es an einem Gehirntumor, oder?
Ein riesiges Wesen ist aus den äußeren Regionen des Weltraums ins Sonnensystem eingedrungen und versucht hier auf der Erde, die Entropie, von der es wahrlich genug erfahren hat, auf spielerische Weise zu bekämpfen. Viele Wesen auf dieser Welt – sie nennen sich Menschen – legen eine bemerkenswert anti-entropische Energie an den Tag.
Die ersten Simulationen sind noch nicht so gut gelungen, denn so ein Menschen ist unglaublich stark verdichtete Materie, aber nach und nach, mit ein wenig Übung, gelingt es dem Wesen, sogar einen Wissenschaftler zu imitieren und zu verkörpern. Leider kann Colin Mitchell seinen Appell gegen die entropische Militärforschung und für anti-entropischere Forschung über die zwei-Wege-Kommunikation nicht zu Ende führen. Man hat seinen Originalkörper tot an der Küste gefunden. Die anschließende explosionsartige Ausbreitung der komprimierten Materie seines Körpers vernichtet die Stadt San Bernardino sowie die militärischen Forschungseinrichtungen dortselbst.
Der Präsident mit dem Gehirntumor wendet sich erneut an „Jack“. Sie soll Dartmouth absagen und sich auf den Besuch in Dallas konzentrieren…
Mein Eindruck
Es ist ein Schock, am Schluss zu erfahren, dass mit dem Mann, der über einen Gehirntumor klagt, John F. Kennedy, der Präsident der Vereinigten Staaten, gemeint ist, und zwar kurz vor seiner Ermordung im November 1963. Alle Verkörperungen, die ihm vorausgingen, waren nur Fingerübungen. Er ist also zwar eine Marionette eines Aliens, jedoch eine mit positiven Eigenschaften: ein Mann, der gegen die Entropie kämpfte, gegen den Krieg.
Durch die Assoziation mit Colin Mitchell und dessen Eintreten gegen die (Entropie fördernde) Militärforschung ist Kennedy allerdings auch von vornherein zum Scheitern verurteilt, und zwar durch seine Gegner, woher auch immer sie kommen mögen. Leider hat jedoch Kennedys Ableben nicht Dallas eingeebnet, so dass der nahegelegten Theorie, er könnte die Verkörperung eines hochverdichteten Aliens sein, nicht allzu viel Glaubwürdigkeit zukommt.
Wie so häufig bei Tiptree kommen auch hier zwei witzig gestaltete, erotische Szenen vor: eine hübsche Bikinischönheit am Strand des Balchaschsees und eine Sexszene in einer Villa auf Mallorca. Besonders die männliche Reaktion auf die (entkleidete) Bikinischönheit ist derartig verklausuliert geschildert, dass man schon genau danach suchen, um sie sich als ziemlich drastisch vorstellen zu können.
15) Und auf verlorenen Wegen fand ich diesen Ort (And I have come upon this place by lost ways, 1968, VÖ 1972)
Die Forscher sind auf dem Planeten Delphis Gamma Fünf gelandet, haben aber nur primitive Eingeborene gefunden. Nur Evan Dilwyn, der junge Kulturforscher, ist überzeugt, dass der Berg der Eingeborenen, den sie „Der Berg-des-Weggehens“ und Der Clivorn nennen, ein Geheimnis birgt. Er bricht alle Regeln und Beziehungen ab, um Den Clivorn zu ersteigen. Selbst die Eingeborenen hindern ihn vergeblich daran, den Berg, wo sie ihre Toten bestatten, zu besteigen, denn sie glauben, er wolle dort sterben und ihnen seine Kleider vorenthalten. Weil sie ihn verletzen, verliert er an Kraft.
Er findet, was er vom Schiff gesehen zu haben glaubt: eine horizontale Linie, die eine Energiebarriere verbirgt. Doch darüber gibt es eine zweite Energiebarriere, und erst dahinter offenbart sich ihm das Geheimnis Des Clivorn. Leider zu spät…
Mein Eindruck
Diese schöne Erzählung ist in bester Le-Guin-Tradition geschrieben, und sogar die Namen Clivorn und Ardhvenne erinnern an Le Guins frühe Hainish-Romane wie etwa „Rocannons Welt“. Das Thema ist der Widerspruch zwischen moderner, computerbasierter Wissenschaft, die nur auf technische Daten vertraut, und der alten Feldforschung, die auf Erfahrungen aus erster Hand basiert.
Das Brechen der neuen Regeln hat natürlich seinen Preis: Offenbarung und Tod. Aber wir lernen daraus, dass nichts die unmittelbare Erfahrung aus erster Hand ersetzen kann. Man sollte bedenken, dass diesen Text eine Wissenschaftlerin geschrieben hat, und sie nimmt darin eine sehr kritische Haltung ein.
16) Der Schnee ist geschmolzen, der Schnee ist fort (The snows are melted, the snows are gone, 1969)
Ein Mädchen ohne Arme macht sich zusammen mit einem intelligenten Wolf an die Arbeit, einen Menschen zu fangen. In einem idyllischen Bergtal finden sie einen kleinen Stamm von Fischern. Dem Mädchen gelingt es, den stärksten der Männer mit einer Entblößung zu ködern und in eine Falle zu locken. Sie betäubt und fesselt ihn, dann holt sie Verstärkung.
Es ist ihr Bruder Bonz, doch auch er ist missgebildet: Er hat keine Beine. Dennoch ist er in der Lage, einen Traktor zu fahren und den schweren Mann mit der Hilfe des Mädchens abzutransportieren. Endlich haben sie ein Exemplar erwischt, dessen Gene noch intakt sind. Alle anderen Menschen in Äthiopien haben defekte Gene – selbst jetzt noch, lange nach dem Atomkrieg.
Mein Eindruck
Die Punchline, also die Pointe, kommt, wie es sich gehört, erst in der letzten Zeile. Und der Tiefschlag ist gehörig. Was zuvor wie eine ländlich-romantische Idylle wirkte, stellt sich nun als der genetische Überlebenskampf der letzten Menschen heraus. Der gefangene Mann ist kein Held, sondern lediglich Beute, die gebraucht wird, um gesundes Genmaterial zu liefern. Vielleicht kann er ja auf diese Weise ein Held werden.
In Sujet und Ausführung ist die Story konventionell, doch die Kombination von Idylle und Atomkrieg macht sie zu etwas Besonderem. Nur die Überschrift gibt mir noch Rätsel auf. Wahrscheinlich beruht sie ebenfalls auf einem Gedicht. Der Schnee könnte sich auf den Nuklearen Winter beziehen, der offensichtlich vorüber ist.
17) Sie in einem trüben Spiegel (Through a lass darkly, 1969, VÖ 1972)
Maltbie Trot ist ein Mitarbeiter ist einem Zeitungsverlag, der Leserbriefe an die „Liebe Candy“ beantwortet, sollte sich also mit Beziehungsfragen auskennen. Aber mit dem Mädchen, das aus dem Nichts bei ihm erscheint, ist er mit seinem Latein am Ende. Sie stammt aus dem 22-69, sagt sie, stammt aus Shago (= Chicago?) und hat schon einige Beziehungsformen ausprobiert. Aber weder Kommune à la Gangbang noch Harem noch Multikulti-Ehe sind etwas für sie. Da verschwindet sie unhöflich wieder, aber wenigstens sah sie gut aus. Und Maltbies Stuhl hat sie auch noch mitgenommen. Sauerei.
Mein Eindruck
Die superkurze Story von gerade mal sechs Seiten nimmt satirisch die Leserberatungsseiten der Zeitungen und Frauenzeitschriften auf die Schippe. Nicht nur, indem ein männlicher Schreiberling sich als „Candy“ ausgibt – das kann man schon vermuten, wenn man Dr. Sommers Ratschläge in der Jugendzeitschrift „Bravo“ liest. Nein, auch die komplizierten Beziehungsformen im 23. Jahrhundert sind eine Nummer zu schwierig für unseren 08/15-Ratgeber. Das Mädel redet in einem schnoddrigen (Berliner?) Gossenjargon, der mir sehr sympathisch ist. Und eigentlich willse ja gar nich zu Candy, sondern bloß aufn Lokus…
Nachwort von Julie Phillips (2013)
Wie in einem Krimi erzählt die Biographin Julie Phillips, wie das Pseudonym „James Tiptree jr.“ auf die Zeitgenossen wirkte und 1977 schließlich – freiwillig – enttarnt wurde. Robert Silverberg hielt sie dezidiert für einen männlichen Autor (siehe Band 2: „Liebe ist der Plan“). Der Zweck dieser Heimlichtuerei bestand laut Phillips darin, der Autorin viele Freiheiten zu verschaffen, die sie als weibliche Autorin nicht gehabt hätte. Sie durfte nun auf einmal über Gewalt, Politik und sogar über Körper schreiben – alles Dinge, die bei Frauen verpönt waren. Sie kostete diese Freiheit aus und erregte dementsprechend viel Aufmerksamkeit, selbst als vermeintlicher Mann. Deshalb konnte sie eine Story in Harlan Ellisons Anthologie „Dangerous Visions“ unterbringen.
Dem biografischen Abriss folgen abschließende Betrachtungen über Sheldons Bedeutung für den Feminismus. Sie selbst war laut Phillips sicherlich keine Feministin, aber sie öffnete dem männlichen Publikum die Augen für einen völlig anderen Blickwinkel und Standpunkt, nämlich den der Frau. Eine Geschichte wie „Glück ist ein wärmend Raumschiff“ weisen den weiblichen Figuren zwei, drei Rollen zu: Köchin („Logistikmanagerin“ genannt) und Ehefrau sowie Mutter in spe. Das Frauen auch Undercover-Agentinnen auf geheimer Mission sein können, belegt die Novelle „Frauen, die man übersieht“ von 1972/72. Am besten liest man die komplette Sheldon-Biographie, die Phillips bei Septime veröffentlichte.
Die Übersetzung
S. 284: Folgender französische Satz wird nicht übersetzt und wohl als bekannt vorausgesetzt: „Il pleut dans mon coeur comme il pleut dans la ville.“ Einer der Offiziere an Bord des Patrouillenboots „Ethel P. Rosenkrantz“ singt den Vers, den Paul Verlaine 1874 in einem Gedicht veröffentlichte ((https://www.poetica.fr/poeme-64/paul-verlaine-il-pleure-dans-mon-coeur/)). Dass die Autorin französisch beherrschte, darf aufgrund ihres Aufenthalts in Paris vorausgesetzt werden.
S. 348: „Und wen sollen Sie verkörpern? Mr. Spock?“ Ein Verweis auf die TV-Serie „Star Trek“, die, 1966 gestartet, anno 1968 noch ziemlich frisch und Aufsehen erregend war. Manche Zuschauerinnen hielten Mr. Spock wegen seiner spitzen Ohren und schrägen Augenbrauen für den Teufel persönlich. Der Flug der „Ethel P. Rosenkrantz“ folgt dem STAR-TREK-Muster eines Erkundungs- oder Patrouillenflugs.
Unterm Strich
Auffällig an Tiptrees hier gesammelten Erzählungen sind das zyklische Geschichtsbild und das Aufbegehren gegen die überkommenen Rollenbilder für die beiden Geschlechter. Für ihren Pessimismus hinsichtlich eines „Fortschritts“ in der Geschichte der Menschheit sprechen die Erzählungen, in denen die Geschehnisse sich wiederholen, etwa in „Ihr Rauch stieg ewig auf“ und in „Und so weiter und so weiter“ (in Band 2). Die ultimative Kritik kommt in der titelgebenden Story „Dr. Ains letzter Flug“ zum Ausdruck: Es ist eine Kriminalstory, in der der Leser nicht nur der Ermittler ist, sondern auch das OPFER. Die Rettung der Welt – manchmal ist eine Radikalkur nötig. Dieses Thema greift die Autorin immer wieder auf.
Ihre permanente Kritik an Chauvinismus, Rassismus und Neokolonialismus wird beispielsweise in „Glück ist ein wärmend Raumschiff“ unterstützt, indem sie eine überraschende Wendung einbringt und den Blickwinkel des Lesers – und der Hauptfigur Quent – um 180 Grad dreht, um eine gangbare und positive Alternative zu präsentieren. Das macht wirklich Spaß, denn es ist sowohl unerwartet als auch positiv.
Das rückwärtsgewandte Hard-Science-Denken aus den 1930er und 1940er Jahren von Heinlein, Asimov, Niven und Co. wird nun von Tiptrees „Soft-Science“-basierter Kritik als bloßer Wunschtraum entlarvt. Zwischen den Sternen und in ferner Zukunft warten keine Geburtstagstorten, sondern so fremde Erscheinungen wie geklonte Frauen, telepathische Aliens und vor allem psychosexuelle Alpträume – zumindest für die männlichen Erkunder. Tiptree hat offenbar von der inhaltlichen Revolution profitiert, die die v.a. britische New Wave in den 1960ern ermöglichte. Leider schlug sich dies nicht auch in ihren stilistischen Formen nieder – außer in den ersten beiden Vignetten aus den fünfziger Jahren, die die Lesererwartungen unterwandern.
Die biografische Würdigung, die das Nachwort präsentiert, ist dem Startband der Septime-Ausgaben angemessen und hilft dem Leser, einen Zugang zur Autorin und ihrem Werk zu finden. „Die amerikanische Journalistin Julie Phillips erzählt die spannende Biografie einer faszinierenden Persönlichkeit. Es wird die komplexe und tragische Geschichte einer Frau geschildert, die ein halbes Jahrhundert zu früh geboren wurde: immerfort im Schatten der erfolgreichen Mutter, frühe dysfunktionale Ehe, ein tiefgründiges Unbehagen über die eigene, vor allem sexuelle Identität und das damit einhergehende Gefühl der Isolation; langfristige Amphetaminabhängigkeit und Depressionen. Nach einem vorab geschlossenen Selbstmordpakt erschießt Sheldon im Alter von 71 Jahren erst ihren Mann und dann sich selbst.“ (Verlagsinfo)
Gebunden: 470 Seiten
Aus dem Englischen übertragen von Frank Böhmert, Elvira Bittner, Laura Scheifinger, Andrea Stumpf, Samuel N.D. Wohl, Bastian Schneider und Margo Jane Warnken.
ISBN-13: 9783902711236
Septime-Verlag
Der Autor vergibt: 




