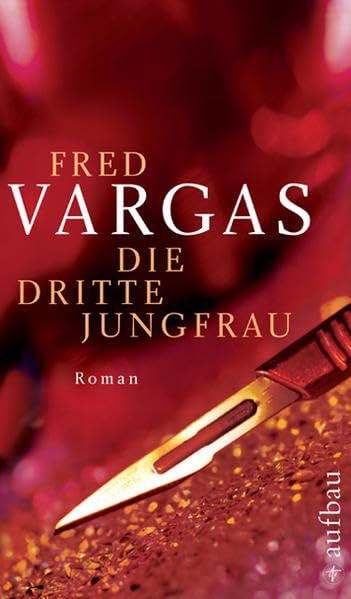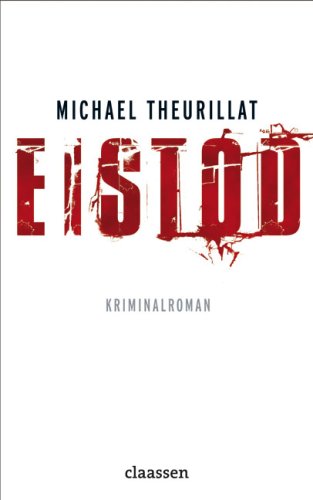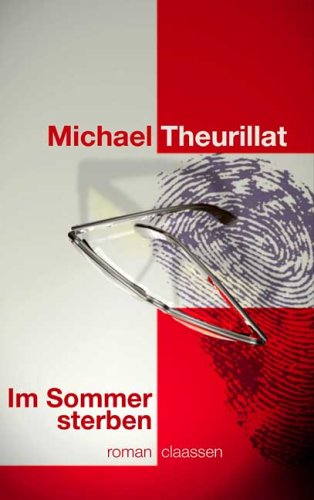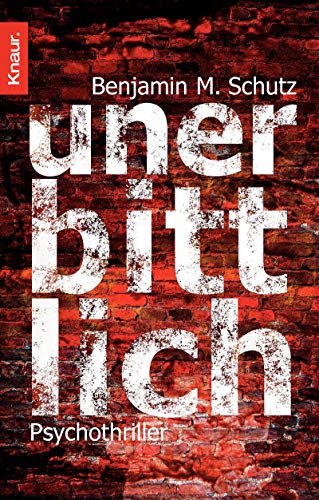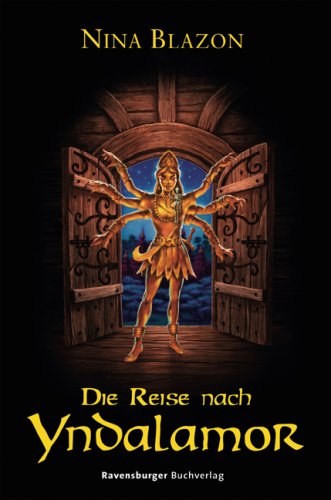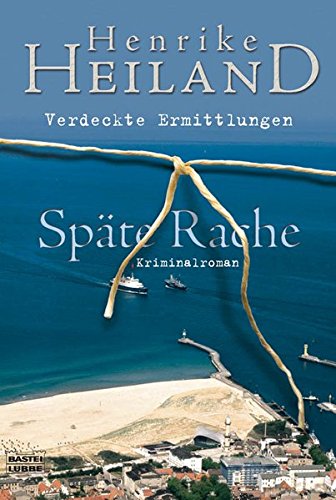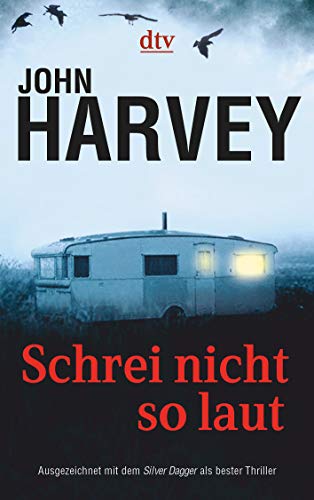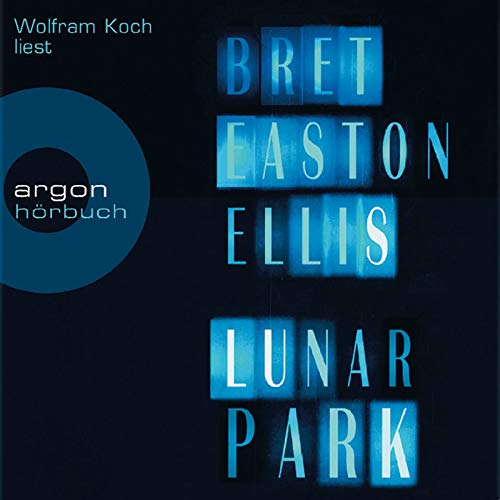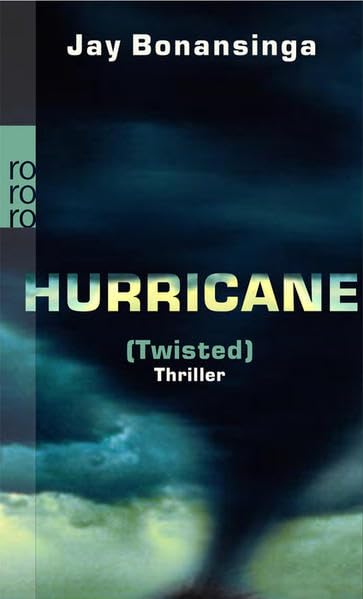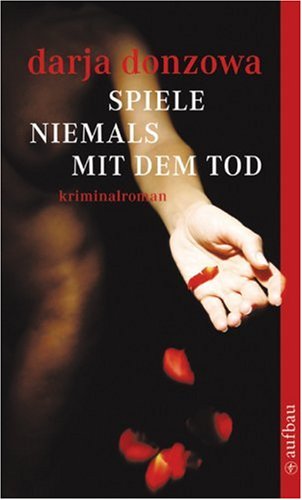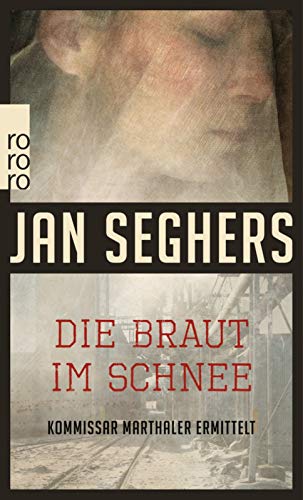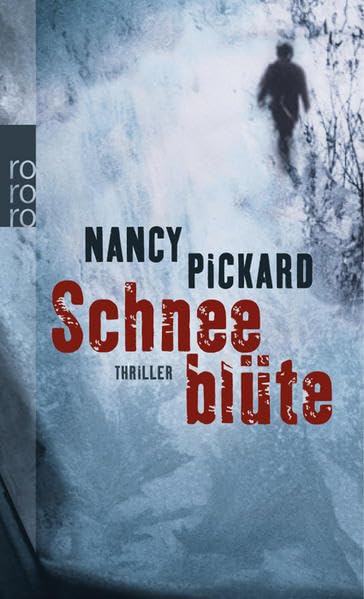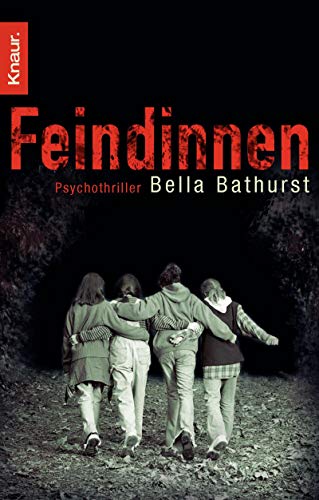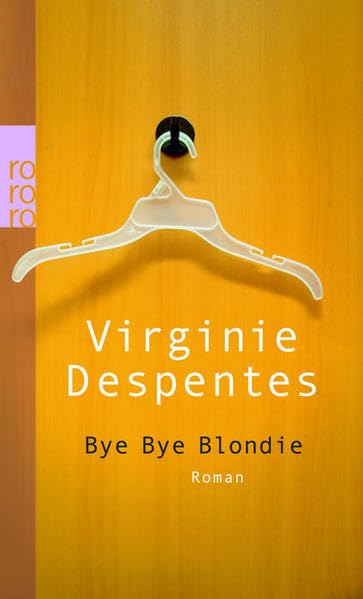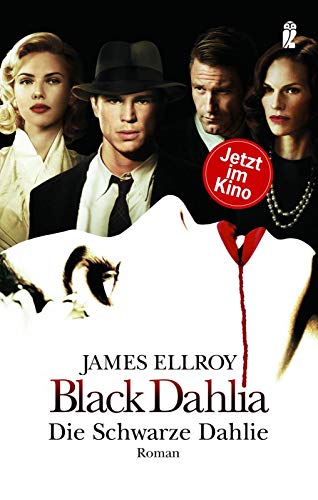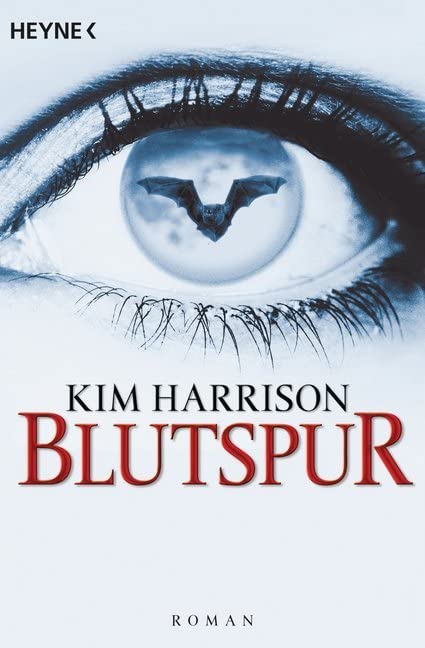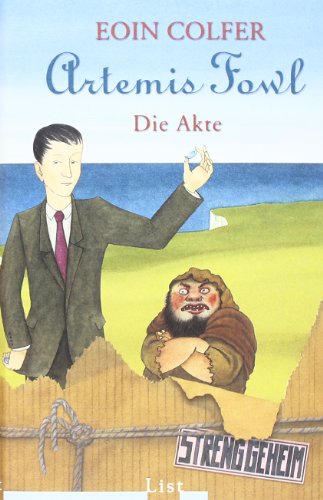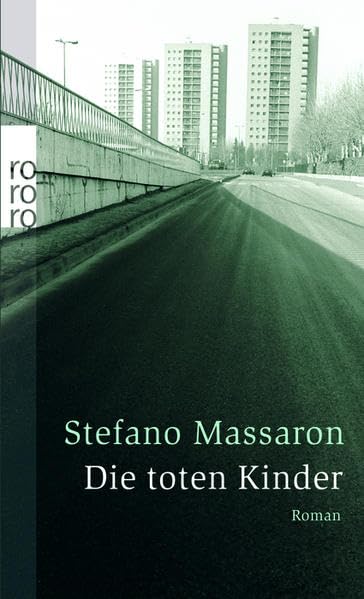Die Grande Dame des französischen Kriminalromans ist zurück. Nicht, dass sie jemals weg gewesen wäre, aber ein neuer Roman von Fred Vargas ist immer ein Grund für Lobhudelei.
In „Die dritte Jungfrau“ vertraut der verschrobene Kommissar Adamsberg mal wieder mehr auf seine Intuition als auf Tatsachen. Zwei tote Männer werden an der Porte de la Chapelle gefunden, und alles deutet darauf hin, dass sie in den Bereich der Drogendelikte fallen. Aber Adamsbergs Intuition sagt, dass die beiden vorsätzlich ermordet worden. Der Grund: Sie haben Erde unter den Fingernägeln, und so ein winziges Detail reicht dem Kommissar, um von seiner Theorie überzeugt zu sein und seine Kollegen auf verschlungene Ermittlungswege zu schicken, die nur er selbst versteht.
Es stellt sich heraus, dass Adamsberg Recht hatte. Die beiden Männer starben tatsächlich nicht wegen Drogen, sondern weil sie einer unbekannten Person dabei geholfen haben, den Sarg einer jungen Frau auszugraben. Das alleine ist natürlich noch kein Grund für einen Mord. Was steckt also hinter diesen seltsamen Vorkommnissen?
In einem Dorf in der Normandie findet Adamsberg neben einer weiteren ausgegrabenen Leiche mehrere tote Hirsche (was vor allem die Stammkundschaft in der kleinen Dorfkneipe beunruhigt), einen Reliquienraub und einen mysteriösen grauen Schatten auf dem Friedhof. Und ein Reliquienbuch aus dem 17. Jahrhundert, über das einige seiner Kollegen auffällig gut Bescheid wissen. Darin ist von einem Elixier für ewiges Leben die Rede, und die Zutaten darin verlangen neben dem Knochen, der im Hirschherz enthalten ist, nach etwas „Lebendigem von Jungfrauen“. Genauer gesagt von drei Jungfrauen und zwei wurden bereits behelligt. Für Adamsberg und seine Kollegen beginnt die Jagd nach einem Wahnsinnigen …
Kommissar Adamsberg ist wirklich ein Thema für sich. Man möchte gerne sagen, dass er nur ein wenig schrullig ist, aber eigentlich ist er einfach sehr still und sehr philosophisch und seine Ermittlerarbeit besteht aus unkonventionellen Gedankengängen. Hinzu kommen sein trockener Humor und dass er den Kopf ständig in den Wolken hat. Adamsberg ist ein echtes Original und Fred Vargas weiß ganz genau, wie sie damit umzugehen hat. Sie stellt ihm Personen an die Seite, die prima zu ihm passen und durch ihre Details den Ton des Buches treffen.
Zum Beispiel der Neue in der Mannschaft, Veyrenc, der aus der gleichen Pyrenäengegend wie Adamsberg kommt, weshalb sich zwischen diesen beiden ein kleiner Konflikt entwickelt. Veyrenc zeichnet sich durch seinen besonderen Haarschopf aus (braun mit roten Strähnen, die natürlich sind) und dadurch, dass er mit Adamsbergs Ex und Mutter seines Sohnes etwas anfängt. Der Konflikt der beiden, den Adamsberg seinem kleinen Sohn in einer Fabel mit Steinböcken und Kamelen darlegt, schwelt im ganzen Buch und weiß immer wieder zu unterhalten. Dadurch gerät die Geschichte sehr vielschichtig, da es nicht nur um den mysteriösen Fall geht.
Diese und andere kleine Nebengeschichten sorgen dafür, dass „Die dritte Jungfrau“ nie an Spannung verliert. Die Geschichte ist, genau wie ihr Protagonist Adamsberg, nicht sonderlich stringent, aber in diesem einen Ausnahmefall ist dies das Beste, was dem Buch passieren konnte. Auf Fred Vargas muss man sich einlassen. Man kann nicht erwarten, dass in einem ihrer Bücher etwas so abläuft wie in normalen Krimis.
Deshalb sind wir der Französin auch nicht böse, dass Adamsberg manchmal Zusammenhänge herstellt, wo gar keine sind, und dass seine Gedanken teilweise sehr skurrile Abwege gehen. Hinterher wird doch alles so erklärt, dass es passt, und bis dahin weiß Vargas mit ihrem charmanten Erzählstil, dem Humor und dem Auge für die kleinen, versteckten Details zu erfreuen.
Gerade dadurch, dass Vargas mit so viel Herzenswärme und Spaß erzählt, ist das Buch sehr spannend, denn man fragt sich ständig, was nun als Nächstes passiert und vor allem, auf welche Weise.
Na gut; vielleicht sind wir Vargas doch ein wenig böse, dass sie bei all der erzählerischen Dichte und kurzweiligen Spannung, die sie zwischen zwei Buchdeckel quetscht, am Ende ein wenig über das Ziel hinausschießt. Dort verstrickt sich die Handlung ein wenig in sich selbst, und das Knäuel, das dabei entsteht, wirkt etwas an den Haaren herbeigezogen.
Andererseits macht die Lektüre so viel Spaß, dass man die paar Seiten schnell vergessen hat. Adamsberg trockener, unbeabsichtigter Humor durchzieht nämlich den ganzen Roman. Vargas erzählt nicht nur einfach trocken, sie spielt mit der Handlung und den Charakteren Pingpong und verwendet dabei die Wörter als Spielbälle. Hier passt jeder Satz wie die Faust aufs Auge. Wenn die Präsidiumskatze fett ist und von einigen Kollegen „Die Kugel“ genannt wird, nun, warum sollte man sie nicht das ganze Buch über so nennen? Und was spricht dagegen, ihr ein Alkoholproblem anzudichten?
Vargas schreibt amüsant, ohne dass der Ernst der Sache dabei völlig verloren ginge. Im Gegenteil hat man das Gefühl, dass sie sich einfach sehr wohl fühlt in ihrer Erzählwelt und das dementsprechend auslebt. Sie benutzt Metaphern, kleine Aufhänger aus der Geschichte, Spitznamen, Eigenschaften der Personen, um sie so bunt und lebendig wie möglich zu gestalten. Die Dialoge sprühen nur so vor Leben und Humor und halten sich weder an alltägliche noch an literarische Maßregeln. Und genau dadurch wirken sie so authentisch.
Eine skurrile Geschichte, skurrile Charaktere und ein unglaublich lebendiger, sprühender Schreibstil – das zeichnet Fred Vargas seit vierzehn Büchern aus. Und das Schönste dabei ist, dass sie einfach nicht nachlässt. „Die dritte Jungfrau“ ist in bester Tradition proppevoll mit Humor, einer dichten Handlung und jeder Menge Alltag. Und dem Gegenteil von Langeweile.
http://www.aufbau-verlag.de