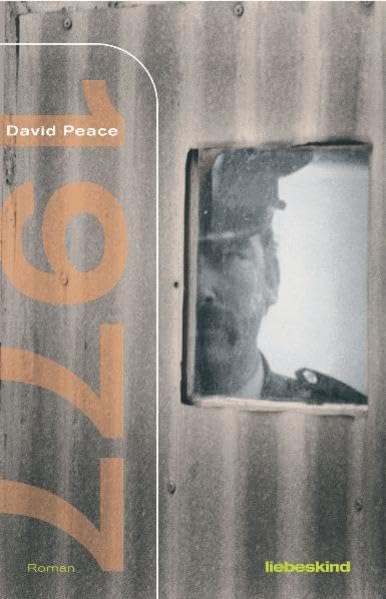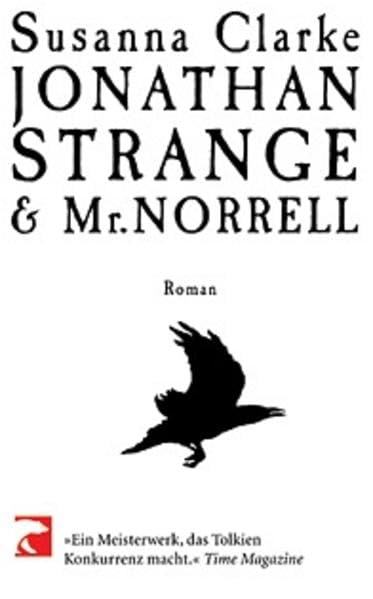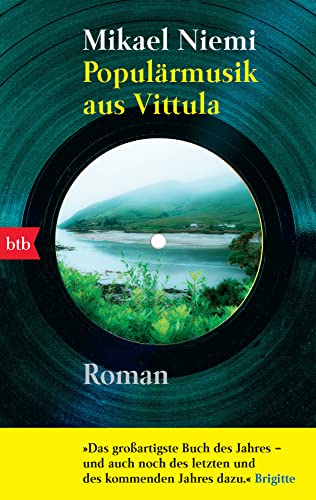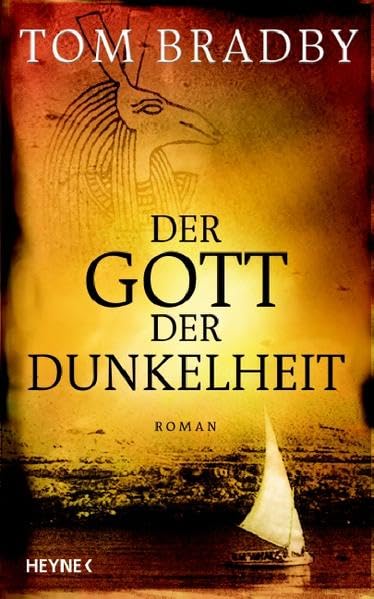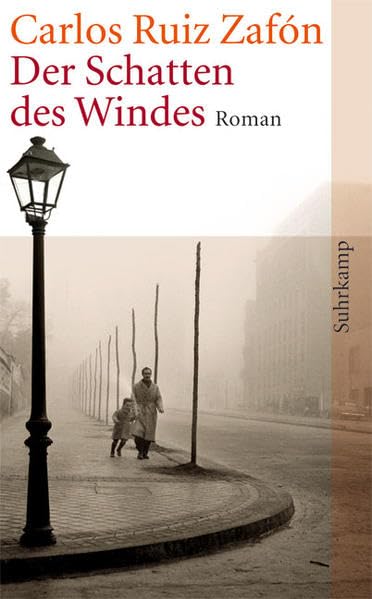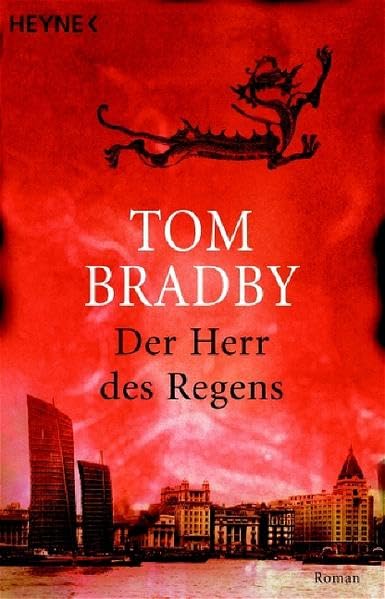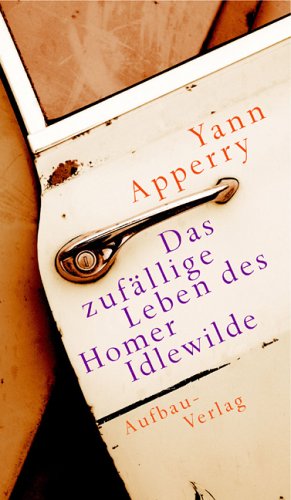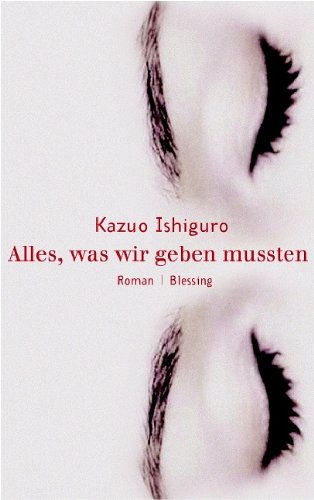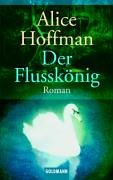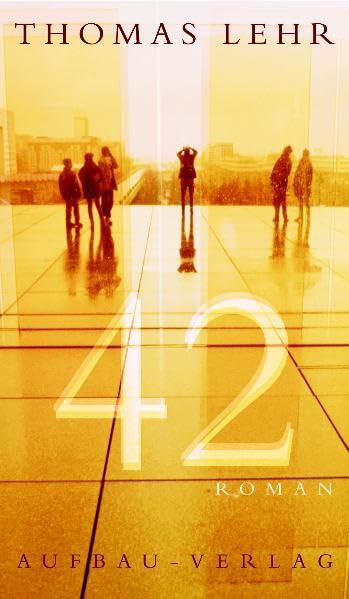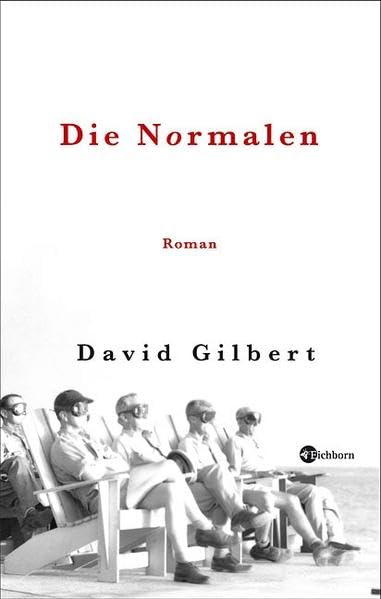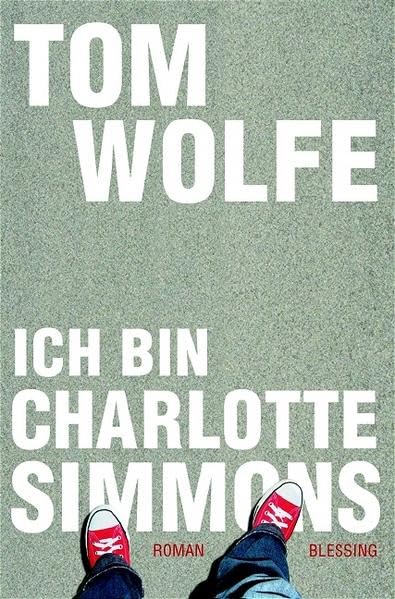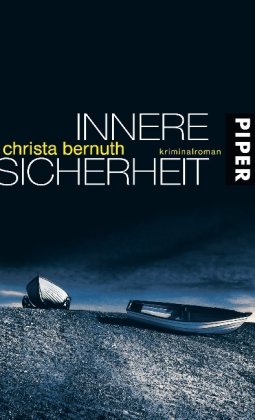
Alle Beiträge von Meike Schulte-Meyer
Joseph Delaney – Spook – Der Schüler des Geisterjägers

Joseph Delaney – Spook – Der Schüler des Geisterjägers weiterlesen
Peace, David – 1977
Mit [„1974“ 1483 hat der Engländer David Peace nicht nur ein außerordentlich vielversprechendes Debüt hingelegt, sondern wurde obendrein kürzlich noch mit dem |Deutschen Krimi Preis 2006| ausgezeichnet. Düster und beklemmend liest sich „1974“. Ein Thriller, der sich durch seine atmosphärische Dichte und das rasante Erzähltempo auszeichnet. Das Buch stellt den Auftakt zu einer Tetralogie dar, die nun in „1977“ ihre Fortsetzung findet. Ein Buch, an das der Leser von „1974“ mit allerhand großen Erwartungen herangehen dürfte.
Wir schreiben also das Jahr 1977, wie auch der Romantitel schon vermuten lässt. Robert Fraser, Polizeisergeant aus Leeds wird einer Sondereinheit zugeteilt, deren Aufgabe die Aufklärung des grausamen Mordes an einer Prostituierten ist. Schon bald zeichnen sich Parallelen zu früheren Morden ab. Die Polizei arbeitet auf Hochtouren und kann schon bald die ersten Verdächtigen festnehmen.
Doch das Morden findet kein Ende. Angst und Schrecken machen sich in der Bevölkerung Yorkshires breit und in der Presse schlagen die Morde hohe Wellen. Einer derjenigen, die über die Mordfälle berichten, ist Jack Whitehead, Journalist der „Yorkshire Post“. Er ist es, der dem Mörder einen Namen gibt: „Yorkshire Ripper“. Auf eigene Faust schaltet Whitehead sich in die Ermittlungen ein und ehe er sich versieht, steckt er genau wie Sergeant Fraser auch schon mittendrin in einem schmutzigen Geflecht aus Intrigen und Korruption …
„1977“ bezieht sich eindeutig auf die realen Hintergründe des Yorkshire Rippers, der Ende der 70er Jahre vierzehn Frauen in Yorkshire ermordete. Auch David Peace ist in Yorkshire aufgewachsen und die fünf Jahre, in denen die dortige Bevölkerung durch den Ripper in Angst und Schrecken versetzt wurde, überschneiden sich genau mit seiner Kindheit. Für Peace ist der Yorkshire Ripper eine Art Kindheitstrauma, das er sich mit seiner Tetralogie „Red Riding Quartet“ von der Seele schreibt.
Insofern dürfte „1977“ den ersten Höhepunkt seiner Selbsttherapie darstellen. Der Ripper tritt in Aktion und ist das alles dominierende Thema des Romans. Diesem Kernthema nähert Peace sich dank wechselnder Ich-Erzähler (mal Jack Whitehead, mal Robert Fraser) aus unterschiedlichen Perspektiven. Mal begleitet der Leser den Journalisten, mal den Polizisten – ein Wechsel, der durchaus seinen Reiz hat und der immer wieder für Spannung sorgt.
Das Markanteste an David Peaces Romanen dürfte sein Stil sein. Er schreibt sehr eigenwillig – temporeich, leidenschaftlich und mit einer Portion Wut im Bauch, wie es scheint. Schon in „1974“ hat er einen atemberaubenden Stakkato-Rhythmus vorgelegt und in „1977“ schlägt sein Metronom noch eine etwas schnellere Taktfrequenz an. Wie Peitschenhiebe knallt Peace dem Leser so manchen Satz um die Ohren. Knappster Satzbau, minimalistische Dialoge und Einwortsätze markieren seine sprachlichen Mittel. Das ist ganz sicher nicht jedermanns Sache. Man muss sich schon auf den Rhythmus einlassen können, um in diesem rasanten Tempo nicht vom Autor abgehängt zu werden.
„1977“ ist ein Roman, der dem Leser einiges abverlangt. Es ist keine leichte Kost und sowohl inhaltlich wie auch der äußeren Form nach ein schwer verdaulicher Brocken. Ohne vorherige Lektüre von „1974“ braucht man gar nicht einsteigen zu wollen. Ohne Vorkenntnisse in den Roman hineinfinden zu können, ist völlig ausgeschlossen. Es begegnen einem viele Bekannte wieder. Peace konfrontiert den Leser mit einem ganzen Sammelsurium an Figuren, die erst einmal gedanklich sortiert werden wollen. Wie schon in „1974“ setzt Peace auch in der Fortsetzung wieder auf ein außerordentlich komplexes Romangebilde.
Und wo sein Roman ohnehin schon recht komplex ausfällt, da wird er diesem Anspruch auch in seiner Figurenzeichnung voll und ganz gerecht. Peace lässt die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen und macht es dem Leser damit schwer, seine Sympathien zu verteilen. Er fordert den Leser, indem er es ihm nicht ermöglicht, einfach dem strahlenden Helden der Handlung zu folgen. Strahlende Helden gibt es bei Peace nicht.
Peace skizziert eine sehr düstere Atmosphäre. Man beneidet seine Protagonisten nicht, will sich nicht mit ihnen identifizieren müssen und ist so manches Mal froh über die Distanz zu ihnen. Peaces Welt sieht brutal aus und kann kaum mit schönen Momenten locken. So spannend die Geschichte auch sein mag, am Ende ist man doch irgendwie froh, diese Welt hinter sich lassen zu können, nachdem man das Buch zugeschlagen hat – zu illusionslos, kalt und hart ist die Welt von „1977“.
So sehr man besonders an „1974“ Peaces Stakkato-Rhythmus loben mag, so muss man ihn im zweiten Teil leider auch in Ansätzen kritisieren. Auf mich persönlich wirkte der Stil manches Mal ein wenig zu abgehackt. Hier und da hat man als Leser ein wenig Schwierigkeiten, bei diesem Rhythmus der Handlung zu folgen. Peace scheint sich sprachlich in seinen Rhythmus hineinzusteigern, was nicht immer zum Vorteil ist.
Man muss viel zwischen den Zeilen lesen und oft in blauen Dunst hinein spekulieren, ohne von Peace eine Bestätigung zu bekommen. Ein wenig mag dieser Eindruck auch darin begründet liegen, dass „1977“ ein ziemlich offenes Ende hat. Das mag sich mit Kenntnis des nächsten Bandes des „Red Riding Quartet“ ein wenig relativieren, für den Augenblick bleibt man als Leser aber leider etwas unbefriedigt zurück und kommt nicht umhin sich zu fragen, ob man in Anbetracht des hohen Tempos und der abgehackten Erzählweise irgendwo ein paar wichtige Details nicht mitbekommen hat. Das schmälert ein wenig das Lesevergnügen, das Peace noch mit „1974“ zu bereiten wusste. Bleibt zu hoffen, dass er sich stilistisch ein wenig fängt und der nächste Teil der Reihe wieder etwas lesefreundlicher ausfällt.
Bleibt als Fazit festzuhalten, dass „1977“ teils recht zwiespältige Gefühle hervorruft. Zum einen überzeugt David Peace mit seiner Figurenskizzierung und seiner atmosphärischen, düsteren und beklemmenden Inszenierung, zum anderen wirkt seine Erzählweise aber teils etwas zu abgehackt und undurchdringlich. Er verlangt dem Leser viel ab, erzeugt dafür zwar auch ordentlich Spannung, dürfte aber mit seinem Stakkato-Stil sicherlich nicht den Geschmack eines jeden Lesers treffen.
Kem Nunn – Giganten – Wo Legenden sterben

Praxenthaler, Matthias – Horst der Held
Horst Gurk ist nicht gerade ein Name von heldenhafter Ausstrahlung. Jemand, der 1970 noch auf den Namen Horst getauft wird, dessen Eltern können nur der Gipfel deutschen Mittelschicht-Spießertums sein. Das Gefühl hat auch Horst Gurk, Protagonist und titelstiftender „Held“ von Matthias Praxenthalers Roman „Horst der Held“.
„Horst der Held“ ist kein neuer Roman. Praxenthaler veröffentlichte ihn erstmals 1998 im Selbstverlag, um ihn anschließend in den Straßen Münchens eigenhändig zu verkaufen. Laut eigenem Bekunden verkaufte er rund 1500 Exemplare und benutzt die übrigen ca. 5842 Exemplare seither als Bett, worauf es sich angeblich vorzüglich schläft.
Wie man sich bettet, so liest man (oder hieß das anders?) und so soll im nun Folgenden der Frage nachgegangen werden, ob sich „Horst der Held“ als Lektüre gleichermaßen eignet wie zum Bettenbau.
Horst Gurk wird direkt in die wilden 70er hineingeboren – wobei selbige zugegebenermaßen in seinem Elternhaus alles andere als wild ausfallen. Horsts Vater ist Beamter im Postministerium, seine wehrte Gattin noch eine waschechte Hausfrau und das Häuschen im rheinischen Troisdorf eine Ausgeburt provinziellen Spießbürgertums und kleinbürgerlicher Mittelmäßigkeit.
Horst hat keine leichte Kindheit. Dank Segelohren, Zahnspange und Brille gibt er von der ersten Klasse an das perfekte Opfer diverser Schülerspäße ab. Horst wird zum Einzelgänger, was sich auch später auf dem Gymnasium nicht mehr ändern soll. Keine Freunde, keine Partys, kein erster Sex und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, nerven ihn seine Eltern mit ihrer Spießigkeit.
Erst mit 22 scheint sich das Blatt zu wenden. Horst, mittlerweile Maschinenbaustudent (aber selbstverständlich immer noch zu Hause wohnend), beschließt, seiner Jungfräulichkeit mit einem Puffbesuch ein feierliches Ende zu setzen. Und wie das Glück es so will, ist Horst der Zehntausendste Besucher des Troisdorfer Puffs und gewinnt zur Belohnung eine Reise nach Vietnam. Dieser Trip entpuppt sich als ungeahntes Abenteuer und verwandelt Horst schon bald darauf in einen wahrhaftigen Helden …
Schon die ersten Seiten offenbaren, dass „Horst der Held“ absolut erheiternde Lektüre ist. Praxenthaler skizziert Horsts Kindheits- und Jugendjahre und bestraft den armen Horst mit jeder Facette deutschen Spießbürgertums. Die Eltern sind langweilig, religiös und ein harter Brocken für jemanden, der zu Zeiten aufwächst, in denen Coolness ein stetig bedeutender werdender Faktor ist. Horsts Eltern sind all das, was man sich an gebündelter Spießigkeit überhaupt vorstellen kann.
Man bekommt als Leser viel zu Lachen. Praxenthaler formuliert gewitzt und kurzweilig und weiß schon mit so mancher Formulierungsart zu erheitern. Sein Humor ist ein sehr direkter und so konfrontiert er den Leser geradeheraus mit der Lachhaftigkeit seiner Figuren und dem Humor, welcher der langweiligen Alltäglichkeit ihres Daseins innewohnt.
Freunde des feinsinnigeren Humors werden Praxenthalers Roman aber vermutlich nicht über die ganze Länge als besonders erheiternd empfinden. Es ist schon recht derbe, was der Autor teilweise an Humor auspackt, und als dann schon nach wenigen Seiten der Troisdorfer Schlachter seiner Frau in einem alkoholgeschwängerten Wutanfall eine Brust mit dem Schlachtermesser abschneidet, bekommt man einen Vorgeschmack darauf, wie derbe Praxenthaler wirklich werden kann.
Praxenthaler wandelt mit seinem Humor eng an der Grenze des guten Geschmacks, und so versammelt sein Roman zum Schreien komische Momente neben überzogenen und derben Witzen, über die wohl so mancher streiten mag, ob das alles noch wirklich lustig ist. Wandelt er anfangs noch leichtfüßig durch die Kapitel, so wird der Humor mit zunehmender Derbheit auch schwerfälliger. Die unelegante Art, mit der Praxenthaler sich Horsts Eltern vom Hals schafft, wirkt genauso wenig komisch wie das völlig überzeichnete Finale.
Was so herzerfrischend lustig und locker anfängt, wird mit zunehmender Seitenzahl brachialer und unlustiger. Mangelnden Realismus sollte man einem Roman dieser Art sicherlich nicht ankreiden, um sich nicht gänzlich mit humorlosen Moralisten in eine Reihe zu stellen, dennoch kommt man nicht umhin, zu kritisieren, dass Praxenthalers Humor anfangs, als er es noch schafft, die Spießbürgerlichkeit der deutschen Provinz zu karikieren, wesentlich lustiger und bodenständiger ist. Je abgedrehter sich aber die Handlung entwickelt, desto weniger vermag der Humor zu belustigen.
Ansonsten ist „Horst der Held“ ein Roman, der außer knapp 200 Seiten humoristischer Abhandlung nicht viel zu bieten hat. Entweder man kann über Praxenthalers Humor lachen und amüsiert sich köstlich oder man liest ungeduldig weiter bis zum Ende, um herauszufinden wie tief das Humorniveau wohl noch sinken mag. Immerhin ist man nicht so leicht geneigt, die Lektüre abzubrechen, denn Praxenthaler schreibt so locker drauflos, dass man als Leser absolut keine Mühe hat zu folgen. Und so bleibt „Horst der Held“ letztendlich unterhaltsame Lektüre, aber eben auch nicht immer unbedingt lustig.
Bleibt als Fazit festzuhalten, dass Praxenthaler in „Horst der Held“ einige absolut irrsinnig komische Momente zu Papier gebracht hat. Streckenweise macht der Roman wirklich Vergnügen, aber je mehr Praxenthaler in die Schiene des derben, geschmacklosen Humors abrutscht, desto unlustiger wird er leider auch. „Horst der Held“ ruft also gemischte Gefühle wach und bleibt als durchaus locker-flockige Lektüre im Gedächtnis, die aber ihr humoristisches Potenzial der ersten Kapitel im weiteren Verlauf leider verspielt.
Website des Autors:
[www.praxvalley.de]http://www.praxvalley.de/
Clarke, Susanna – Jonathan Strange & Mr. Norrell
Sie schürt Hoffnungen und Befürchtungen zugleich, die Pressestimme des |Time Magazine|, die vorne auf dem Buchdeckel von Susanna Clarkes Debütroman „Jonathan Strange & Mr. Norrell“ prangt: |“Ein Meisterwerk, das Tolkien Konkurrenz macht.“| Da mag der geneigte Fantasy-Leser einerseits auf ein höchst unterhaltsames Lesevergnügen hoffen, aber andererseits schwingen bei einem Tolkien-Vergleich immer auch starke Zweifel mit. Welcher Autor konnte einem solchen Vergleich bislang überhaupt standhalten? War so ein Vergleich schon mal irgendwann in der jüngeren Literaturgeschichte wirklich angemessen?
Auch im Fall von „Jonathan Strange & Mr. Norrell“ ist dieser Vergleich äußerst problematisch, schürt er doch leicht eine überzogene Erwartungshaltung, die am Ende eigentlich nur enttäuscht werden kann. Susanna Clarke ist nicht J.R.R. Tolkien, und mit Mittelerde, Hobbits und unsichtbar machenden Ringen hat ihr Roman schon mal gar nichts zu tun. Der Vergleich mit Tolkien kann sich also nur auf anderer Ebene abspielen und meint wohl auch eher den Einfallsreichtum der Autorin und den Umfang und Phantasiegehalt des Werkes – und nicht zuletzt eine entscheidende Grundsubstanz des Romans, die quasi das Salz in der Suppe ist: Magie.
Bücher über Zauberer sind zurzeit der letzte Schrei, und wer denkt da nicht gleich an einen gewissen bebrillten Teenager, der seit Jahren sämtliche Bestsellerlisten unsicher macht. Doch auch damit hat „Jonathan Strange & Mr. Norrell“ nur wenig gemeinsam. Susanna Clarke bewegt sich mit ihrem Debüt in einem recht eigentümlichen Umfeld – sozusagen dem historischen Fantasy-Roman. „Jonathan Strange & Mr. Norrell“ wirkt über weite Strecken wie ein historischer Roman, ergänzt um eine saftige Prise Magie und Zauberei.
Angesiedelt ist die Geschichte am Beginn des 19. Jahrhunderts in einem alternativen England. Der Leser erfährt zunächst einmal, wie es um die englische Zauberei (die offenbar auf Dekaden voller Ruhm und Glanz zurückblicken kann) bestellt ist. Zauberei wird nur noch theoretisch praktiziert (was der aufmerksame Leser sicherlich gleich als Widerspruch reklamieren möchte). Zauberei betreibt man nicht durch Zauberei, sondern nur, indem man wie ein wahrer Gentleman darüber diskutiert und sie studiert. Zu dieser Zeit betritt ein einscheinbarer älterer Herr die Bühne der Zauberei und stiftet einige Unruhe, indem er tatsächlich zaubert: Mr. Norrell.
Mr. Norrell ist sehr bemüht, der englischen Zauberei wieder zu Glanz und Ehre zu verhelfen, aber ebenso fest entschlossen, alle anderen Zauberer zu Stümpern und Scharlatanen zu degradieren, denn schließlich kann sich kein Zauberer mit ihm selbst messen. Mr. Norrell sieht sich selbst mehr oder weniger als den einzigen wirklichen Zauberer im ganzen Königreich an. Und so versteht es sich fast von selbst, dass er sich darum bemüht, seine Künste in den Dienst seiner Majestät zu stellen, um im Kampf gegen Napoleon von Nutzen zu sein.
Gleichzeitig nimmt Norrell, ganz gegen seine eigennützige und eigenbrötlerische Art, einen äußerst talentierten Schüler auf: Jonathan Strange – ein Mann, der das Talent dazu hätte, seinen Meister irgendwann zu überflügeln. Gemeinsam arbeiten Strange und Norrell im Auftrag der englischen Regierung daran, die englischen Truppen im Krieg gegen Napoleon zu unterstützen. Strange lernt schnell und wird schon recht bald alleine nach Spanien geschickt, um Lord Wellington und seine Truppen vor Ort tatkräftig zu unterstützen. Strange und Norrell verhelfen so der englischen Zauberei zu neuem Ruhm.
Doch je weiter Strange seine Kenntnisse vertieft, desto weiter entfernt er sich auch von seinem Lehrer Mr. Norrell. Zwischen den beiden bahnen sich erste Schwierigkeiten an, und als Strange seine von Norrell differierenden Ansichten zur Zauberei öffentlich kundzutun beginnt, entsteht ernsthafte Rivalität …
Was Susanna Clarke mit ihrem Debüt erschaffen hat, ist ein wahrhaftiger Schmöker. 1024 eng bedruckte Seiten – ein Buch wie geschaffen für ausgiebige Schmökerabende vor dem prasselnden Kaminfeuer. Susanna Clarke schafft es, dass man das Buch trotz des immensen Umfangs recht zügig durchliest. Leichtfüßig schickt sie den Leser durch die 69 Kapitel – erheitert und unterhält, fesselt und fasziniert.
Clarke gibt dem Ganzen den Anstrich eines historischen Dokuments. Gewitzt fügt sie immer wieder Fußnoten als Belege des Erzählten an, die auf historische (selbstverständlich fiktive) Zauberliteratur verweisen und erzählt im Kleingedruckten am Seitenende so manche lustige und unterhaltsame Anekdote. Das sprengt manchmal ein wenig den Rahmen einer verträglichen Fußnotengestaltung und kann sich, wie in einem Fall, auch schon mal über fünfeinhalb Seiten ziehen. Manchen Leser mag das irritieren, und auch für meinen Geschmack hätten es ruhig etwas weniger Fußnoten sein können, zugunsten von mehr in den Text eingebetteten Erklärungen, aber bei diesem Roman gehört dies offenbar zur besonderen Note, und bei einem Buch dieses Umfangs hat man sich auch daran irgendwann gewöhnt und stört sich kaum noch an dieser Eigenart.
Insgesamt neigt Susanna Clarke zu einem recht ausschweifenden, intensiv beschreibenden Erzählstil. Auf den ersten Seiten mag man noch so manches Mal denken, sie könne sich ruhig etwas kürzer fassen, aber schon nach wenigen Kapiteln ist man dann so sehr in die Atmosphäre eingetaucht, dass es einem gar nicht mehr auffällt. Insofern geht Clarkes stilistische Rezeptur auf. Sie beschreibt ausführlich, plastisch und mit einer Fülle an Adjektiven und kreiert so im Laufe der Kapitel eine dichte und intensive Atmosphäre.
Diese intensive Atmosphäre braucht der Leser auch besonders. Es ist nicht immer unbedingt die Handlung, welche die Lektüre vorantreibt. Clarke lässt sich Zeit, Entwicklungen aufzuzeigen, Bezüge herzustellen und den Leser in aller Ruhe die Protagonisten und die Geschehnisse beobachten zu lassen. So gesehen braucht der Spannungsbogen ausgesprochen lange, um die Intensität zu entwickeln, die den Leser dann zum Ende hin wirklich fesselt. Es sind vor allem die Atmosphäre und Clarkes gewitzte und ironische Art zu erzählen, die man anfangs mögen muss, um sich voll auf das Buch einlassen zu können. Wen Clarke damit aber anspricht, den dürfte sie dann auch direkt begeistern können.
„Jonathan Strange & Mr. Norrell“ ist ein Roman, der vor allem durch den alles durchziehenden Witz und die stets durchschimmernde Ironie wunderbar zu lesen ist. Vieles erzählt Susanna Clarke mit einem Augenzwinkern, und gerade bei den Beschreibungen der diversen Figuren kommt die Ironie nicht zu kurz. Jede Figur hat so ihre skurrilen Eigenheiten und die Autorin versteht sich einfach darauf, solcherlei Dinge wunderbar plastisch zu beschreiben.
Inhaltlich ist „Jonathan Strange & Mr. Norrell“ ein recht vielschichtiger Roman. Zum einen beschreibt er die damalige Zeit sehr gut. Die politischen Umstände vor dem Hintergrund der Zeit Napoleons werden dank der Tätigkeit der beiden Zauberer in den Diensten seiner Majestät ausführlich beleuchtet. Auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen kommen nicht zu kurz. Norrell verkehrt in der feinen Londoner Gesellschaft, und dieser Bezug ist es auch, der schon so manchen Leser und Kritiker an Jane Austen hat denken lassen.
Die besondere Würze aber ist natürlich die Zauberei. Auch wenn sie manchmal etwas überzogen wirken mag, wenn Strange zum Beispiel während des Krieges gegen Napoleon eine ganze Stadt auf einen anderen Kontinent verlegt, so wirkt sie ansonsten eben doch so, wie man es sich am ehesten als realistisch vorstellen kann. Es bleibt alles sehr geheimnisvoll, hat aber auch einen etwas elitären Charakter und vor allem viel mit dem Wälzen alter Bücher zu tun. Geradezu wissenschaftlich betreiben Strange und Norrell ihre Zauberei – sehr zum Missfallen der feinen englischen Gesellschaft, die sich die Zauberei irgendwie spektakulärer und als passende Erheiterung für so manche langweilige Dinnerparty vorgestellt hatte.
Auch die düsteren Elemente fehlen in Clarkes Roman nicht. Je weiter Strange seine Zauberei voranbringt, desto mehr dunkle und unbekannte Wege tun sich auf. Immer wieder wird auf den Rabenkönig angespielt, der im Mittelalter den Norden Englands regiert haben soll und der gleichzeitig der König des Elfenreiches war. Wahnsinn, wieder auferweckte Tote, Besuch von geheimnisvollen Elfen, Menschen, die in das Elfenreich entführt werden – der Roman steckt voller Phantasie und origineller Einfälle, die teils düster, teils aber auch einfach skurril sind.
Bleibt unterm Strich festzuhalten, dass „Jonathan Strange & Mr. Norrell“ ein ausgezeichneter Schmöker für alle diejenigen ist, die atmosphärische und phantasievolle Romane lieben. Manch einer mag Längen in der Handlung beanstanden, ich für meinen Teil finde es aber viel mehr erstaunlich, wie locker und flott man dieses mehr als tausendseitige Werk verschlingen kann. Man braucht schon einen Sinn für Clarkes feinsinnige Ironie und ihre augenzwinkernden Beschreibungen, aber wer über einen solchen verfügt, der wird reichlich belohnt.
„Jonathan Strange & Mr. Norrell“ ist schon ausgesprochen phantasievolle Lektüre, die sich vermutlich am ehesten als historischer Fantasy-Roman einordnen lässt. Gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass es sich um einen Debütroman handelt, handelt es sich um ein wirklich lesenswertes Buch, dem man die meisten seiner kleinen Schwächen gerne verzeiht.
http://www.jonathanstrange.de/
Niemi, Mikael – Populärmusik aus Vittula
|Tjus lätmi isamatö råckönråll mjosik!| – So in etwa klingt es, bzw. sieht es in schriftlicher Form aus, wenn ein Junge aus einem der abgelegensten Winkel Schwedens, genaugenommen irgendwo aus dem Nichts zwischen Schweden und Finnland, einen Beatles-Song nachsingt, ohne Englisch zu können. Charmant, nicht wahr? Nicht minder charmant ist das Buch, in dem man die Kindheits- und Jungendgeschichte eben dieses Jungen nachlesen kann: „Populärmusik aus Vittula“. Eine Chronik der ersten musikalischen Gehversuche, der ersten ernüchternden Alkoholerlebnisse und des ersten Sex.
Pajala ist ein nichts sagendes Kaff in einer nichts sagenden Gegend Schwedens, dem Tornedal. Hier liegt der sprichwörtliche Hund begraben. Die Einheimischen reden Schwedisch oder Finnisch bzw. ein Kauderwelsch, das unter dem Namen Tornedalfinnisch läuft. In Pajala arbeiten die Menschen hart und auch die im Tornedal verbreitete religiöse Bewegung des Laestadianismus macht mit ihrer übertriebenen Strenge und Lustfeindlichkeit das Leben nicht unbedingt angenehmer. Wenn da nicht der Alkohol wäre, die ständige Versuchung, die auch in Pajala, das sich dem über Finnland nach Russland verlaufenden „Wodka-Gürtel“ zugehörig fühlt, locken würde.
In diesem Umfeld wachsen Matti und sein nicht sonderlich redseliger Freund Niila auf. Und das mitten in den wilden 60ern, von denen man im äußersten Norden Schwedens logischerweise wenig mitbekommt – bis zu dem Tag, an dem Niilas Großmutter beerdigt wird und seine beiden Cousins aus Amerika mit einer Beatles-Single als Gastgeschenk für Niila anreisen. Die beiden Jungs sind völlig aus dem Häuschen und gründen kurzerhand selbst eine Band. Im Keller von Mattis Eltern zimmern sie sich aus Sperrholz so etwas ähnliches wie eine Gitarre zusammen und träumen fortan ihren Traum vom Leben: Rock ’n‘ Roll Music bzw. Roskn Roll Musis …
Niemi erzählt einzelne Episoden aus Mattis Kinder- und Jugendzeit in Pajala, bzw. dem im Volksmund Vittulajänkka (zu deutsch in etwa: „Fotzenmoor“) genannten Ortsteil von Pajala. Er pickt sich einzelne Begebenheiten heraus, die besonders erzählenswert erscheinen, so dass die Kapitel theoretisch vielleicht auch als Kurzgeschichten für sich stehen könnten. Dennoch gibt es Überleitungen, Niemi stellt Zusammenhänge her und baut die Kapitel aufeinander auf, so dass daraus am Ende ein zusammenhängender Roman entsteht.
Und das hat er offenbar so gut gemacht, dass er von seinem Werk in Schweden 700.000 Exemplare verkauft und den bedeutendsten Literaturpreis des Landes eingeheimst hat. Und auch die |Brigitte| hat sich von so viel Euphorie anstecken lassen und beurteilt „Populärmusik aus Vittula“ als |“Das großartigste Buch des Jahres – und auch des letzten und des kommenden Jahres dazu.“| Auch wenn ich mich nicht dem Urteil der Brigitte anschließen will (mit Superlativen sollte man schließlich sorgsam umgehen), kann ich nicht leugnen, dass mir das Buch sehr gut gefallen hat. Niemis Roman hat so eine skurrile, charmante, warmherzige und kauzige Art, dass man sich dem Charme der Geschichte kaum entziehen kann.
Begeistern kann Niemi dabei schon gleich im Prolog mit seinem etwas schrägen Humor, der auch im weiteren Verlauf des Buches immer wieder durchschimmert. Er setzt gekonnte Pointen, die so witzig sind und teilweise vor Einfallsreichtum strotzen, dass den Leser immer wieder das Lachen oder Schmunzeln überkommt. „Populärmusik aus Vittula“ ist dabei gar kein durch und durch komischer Roman, sondern eher tragikkomisch. Niemi kann trotz seiner amüsanten Erzählweise auch sehr ernst sein, wenn er das Leben der Menschen in Pajala schildert, so dass einem manchmal das Schmunzeln zu gefrieren droht.
Die Geschichten, die Niemi aus Mattis Kindheit erzählt, drehen sich dabei einerseits um Land und Leute, andererseits um Musik und die Zeit der Pubertät. Der Leser beobachtet, wie Matti und Niila langsam halbwegs erwachsen werden. Beide erscheinen dabei eher als Antihelden. Ihre spielerischen ersten Versuche, eine Band zu gründen, ihr erster Auftritt vor der versammelten Klasse, der noch als Playback abläuft, all das wirkt eher peinlich als mutig. Grundsätzlich scheint ihr musikalisches Interesse ohnehin in einem unvereinbaren Widerspruch zum Lebenswandel der Tornedalbewohner zu stehen. Hier kommt es vor allem darauf an, als Mann körperliche Arbeit zu leisten, wen interessiert da schon dieses mädchenhafte Rumgeklimper?
Matti und Niila stammen beide aus eher schwierigen familiären Verhältnissen, so dass die Musik für sie die Möglichkeit zum Ausbruch ist. Sie ist ihre Art der Rebellion, auch wenn die beiden sich das wohl nicht ausgemalt hatten, als sie zum ersten Mal im Keller von Mattis Vater mit der Sperrholzgitarre Elvis-Posen imitiert haben.
Was die beiden in den folgenden Jahren erleben, ist durchaus schon einen Roman wert, der einerseits locker-flockig skurrile Geschichten mit viel Witz erzählt, andererseits aber auch einige düstere und tragische Momente enthält. Niemi bewegt sich oft auf einem sehr schmalen Grat zwischen Tragik und Komik. Sein Humor bekommt dadurch eine schwarzhumorige Note, und tragische Momente verlieren trotz der leichtfüßigen Erzählart nichts von ihrer Dramatik.
Vereinzelt hat Niemi dabei sogar schon einen Hang zum Surrealen. Einzelne Kapitel spielen mehr in der Phantasie als in der Realität und mögen im ersten Moment nicht so recht in das Buch passen. Schlägt man es dann am Ende zu, kann man aber dennoch sehr zufrieden sein. Es ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild, in das auch Niemis scheinbar verrückte Phantastereien wieder ganz gut hineinpassen.
Wenn Übersetzung und Lektorierung etwas sorgfältiger gemacht worden wären, wäre das Buch nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich rundum ein Genuss. So bleibt leider ein etwas fader Beigeschmack zurück. Nicht nur, dass die deutsche Ausgabe teilweise haarsträubende Rechtschreib- und Grammatikfehler aufweist und sich hier und da etwas holprig liest, auch die Übersetzung an sich bietet Anlass zur Kritik. Niemi verwendet viele schwedische und tornedalfinnische Ausdrücke, die teilweise einfach so unübersetzt und unerklärt stehen gelassen werden. Welcher durchschnittlich sprachbegabte Deutsche kann schon etwas mit Begriffen wie „ummikko“, „meän kieli“ oder „ulosveisu“ anfangen? Wenn man solche Ausdrücke schon nicht übersetzt, weil sie evtl. im Deutschen nicht entsprechend existieren, wäre es dann unmenschlich zu erwarten, dass sie in einem Glossar erklärt werden? Wohl kaum.
Bleibt abschließend festzuhalten, dass Niemi einfach den richtigen Ton trifft. Er zaubert dem Leser ein Lächeln aufs Gesicht und rührt ihn, er stimmt ihn nachdenklich und lässt ihn lauthals loslachen. Er kreiert ein wunderbares Wechselbad der Gefühle, das auch nach der Lektüre im Gedächtnis haften bleibt. Wer schöne Geschichten mit komischen Käuzen an merkwürdigen Orten mag, der wird an diesem Buch seine Freude haben. Wer obendrein Mattis und Niilas Musikbegeisterung teilt, muss dieses Buch eigentlich lieben.
Bradby, Tom – Gott der Dunkelheit, Der
Wer bei seiner Lektüre gerne auf Spannung, Exotik und Historie setzt, der findet bei einem Autor ganz bestimmt den passenden Schmöker: Tom Bradby. Hat der Engländer bereits mit seinem 2004 in Deutschland erschienenen Werk „Der Herr des Regens“ bewiesen, dass er sich auf historischem Terrain an exotischer Stätte pudelwohl fühlt, so setzt er dies auch in seinem aktuellen Roman (mittlerweile sein insgesamt fünfter) „Der Gott der Dunkelheit“ fort.
[„Der Herr des Regens“ 2117 spielt 1926 in der pulsierenden Metropole Shanghai. „Der Gott der Dunkelheit“ ist in Kairo im Jahr 1942 angesiedelt. So wie Bradby sich für seinen Shanghai-Roman eine Zeit politischer Brisanz ausgesucht hat (Aufkommen des Kommunismus, blutige Niederschlagung der Studentenproteste), hat er das auch für sein aktuelles Werk wieder getan.
Rommel steht mit seinen Truppen vor den Toren Kairos. Alexandria wird bereits evakuiert, während man in Kairo noch beunruhigt auf jede Neuigkeit und jedes neue Gerücht von der Front wartet. Stets sucht Bradby sich Zeiten, in denen die Zeichen auf Veränderungen stehen, und so weiß auch in Kairo niemand, was der nächste Tag, die nächste Woche, der nächste Monat für Veränderungen bringen wird.
Es ist zu dieser unruhigen Zeit, als die Leiche eines ermordeten britischen Offiziers gefunden wird. Ein Offizier, der noch dazu an militärisch empfindlicher Stelle gesessen hat. Er hatte stets den Überblick über sämtliche Truppenbewegungen, Nachschubwege und die Gesamtlage der Armee. Über seinen Schreibtisch gingen jeden Tag Dutzende sensibler Daten. Und so verwundert es nicht, dass die Briten in dem Mord ein politisches Attentat vermuten – Stichwort Spionage.
Doch Joe Quinn, ein in Kairo gestrandeter ehemaliger New Yorker Polizist, ermittelt auch noch in eine andere Richtung. Da wäre beispielsweise Amy White, die hübsche Nachbarin des britischen Offiziers, die irgendetwas zu verbergen scheint. Hatten die beiden eine Affäre und Amys eifersüchtiger Ehemann hat den Nebenbuhler ausgeschaltet?
Doch dann geschehen zwei weitere Morde nach gleichem Muster. Allen drei Opfern wurde eine Abbildung von Seth, dem Gott der Dunkelheit, in die Brust geritzt. Quinn sucht weiter nach einer Spur des Täters und muss schon bald erkennen, dass es bei diesem Fall um mehr geht als um Liebe und mörderischen Hass. Was Quinn mit seinen Ermittlungen heraufbeschwört, ahnt er erst, als es für ihn selbst fast zu spät ist. Er gerät mitten in eine Verschwörung, und irgendjemand scheint es darauf anzulegen, Quinn von weiteren Ermittlungen abzuhalten – notfalls mit allen Mitteln …
Tom Bradby setzt mit „Der Gott der Dunkelheit“ das fort, was er in „Der Herr des Regens“ schon so wunderbar lesenswert angefangen hat. Er hat wieder einmal einen vielschichtigen und interessanten Thriller abgeliefert, der in fast noch höherem Maße als das Vorgängerwerk vor Spannung nur so strotzt. Temporeich und mit einer Prise Exotik spinnt er seinen Plot und lässt Zeit und Ort lebhaft vor dem Auge des Leser auferstehen.
Bradby schafft es auf besonders spannende Weise, die Historie aufzuarbeiten und in einen interessanten Plot zu packen. Besonders interessant ist dabei auch, dass er sich bevorzugt Orte heraussucht, die literarisch noch nicht ganz so abgegrast sind, und so wird der Pulsschlag der exotischen Metropolen in seinen Romanen zum Salz in der Suppe.
Es gibt dabei unverkennbare Parallelen zwischen „Der Gott der Dunkelheit“ und „Der Herr des Regens“. In beiden Romanen fällt Bradbys Figurenzeichnung recht vielschichtig aus. Es scheint, als habe es zur damaligen Zeit vor allem Polizisten in die Kolonien verschlagen, die irgendeinen dunklen Punkt ihrer Vergangenheit hinter sich zu lassen versuchen. Und so flieht auch Quinn vor seiner Vergangenheit in New York und sucht in Kairo einen neuen Anfang. Doch auch dort schlägt er sich mit neuen Problemen rum. Ein Jahr zuvor wurde sein Sohn überfahren und Quinn sucht verzweifelt den Schuldigen. Das belastet sowohl seine berufliche Arbeit als auch das Verhältnis zu seiner Frau Mae. Bradby verknüpft seine Thrillerhandlung auf irgendeine Weise auch stets mit persönlichen Schicksalen. Er verwebt das Personengeflecht eng mit der Handlung und erzeugt dadurch ein hohes Maß an Spannung.
In „Der Gott der Dunkelheit“ trifft der mit Bradby vertraute Leser dann auch ein paar alte Bekannte aus Shanghai wieder. Wer zuvor „Der Herr des Regens“ gelesen hat, der weiß die Loyalitäten dieser beiden Personen gleich richtig einzuschätzen, hat aber gegenüber dem unbedarften Leser dennoch kaum einen Vorteil. Bradby lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass er mit MacLeod und Lewis zwei Personen aus Shanghai importiert hat, die schon früher eine recht zwielichtige Rolle eingenommen haben. Und auch im aktuellen Romanen tauchen sie wieder in mächtigen Positionen auf und hegen teils recht zweifelhafte Motive. Die weit verstreuten britischen Kolonien bieten halt immer irgendwo einen Schlupfwinkel für einen Neuanfang.
So wie bereits in „Der Herr des Regens“, lebt auch bei „Der Gott der Dunkelheit“ ein Teil der Spannung davon, dass man ahnt, dass der ermittelnde Held drauf und dran ist, in ein Wespennest zu stechen. Eine unterschwellige Bedrohung ist allgegenwärtig und man wartet als Leser förmlich darauf, dass der Gute sich schließlich im Räderwerk der Bösen verfängt.
Düster und beklemmend wirkt der Plot dadurch immer wieder. Mit Quinn setzt Bradby auf eine Hauptfigur, die sich nicht nur den kriminellen Elementen der Stadt stellen muss, sondern auch immer ihren eigenen Dämonen ins Auge blickt. Der Plot nimmt dadurch mitunter schon mal recht düstere und dramatische Züge an, die auch vor allem durch die kontrastierende Exotik Kairos unterstrichen werden.
Wie schon „Der Herr des Regens“, ist auch „Der Gott der Dunkelheit“ wahres Kopfkino. Bradby schreibt atmosphärisch dicht und zieht kontinuierlich die Spannungsschraube an. Wie schon den Vorgängerroman, mag man auch „Der Gott der Dunkelheit“ kaum zur Seite legen, wobei ich bei diesem Roman den Eindruck hatte, dass er noch spannender und dichter erzählt ist. Bradby schafft mit seinen historischen Thrillern Spannungslektüre allererster Güte.
Lediglich zum Ende hin schwächelt er ein bisschen. Besonders auf den letzten 50 bis 60 Seiten überschlagen sich die Ereignisse förmlich und die Auflösung, die Bradby am Ende parat hält, ist zwar größtenteils durchaus überzeugend, die Täterschaft an den Morden gerät darüber aber ein wenig ins Hintertreffen.
Dennoch bleibt der Roman als ausgesprochen hohes Lesevergnügen im Gedächtnis. Bradbys historische Thriller sind temporeich und vielschichtig erzählt, skizzieren eine interessante Epoche vor exotischer Kulisse und sind überaus spannend und mitreißend geschrieben. Wer historische Thrillerkost mag und mal zu etwas anderem als Ken Follett greifen will, dem sei Tom Bradby ausdrücklich ans Herz gelegt. Wer’s spannend mag, macht mit „Der Gott der Dunkelheit“ absolut nichts verkehrt.
http://www.heyne.de
Neuwald, Frédéric – Götterschwert
Thrillerspannung gepaart mit mysteriösen Dingen ist eine gut verkäufliche Rezeptur. Spätestens seit Dan Brown verkaufen sich solche Romane wie geschnitten Brot, weil eine hungrige Dan-Brown-Leserschaft auf der verzweifelten Suche nach passendem Nachschub ist. Und so verwundert es nicht, dass die Verlage immer wieder auf dieses Pferd setzen. Dass dabei nicht immer Gutes herauskommt, beweist der Franzose Frédéric Neuwald mit seinem Debütroman „Götterschwert“.
„Götterschwert“ erzählt die Geschichte eines sagenumwobenen Schwertes. Als der junge, aufstrebende Archäologe Morgan Lafet im Nachlass eines bekannten Wissenschaftlers ein sonderbares Schwert findet, ahnt er noch nicht, welche Kette von Ereignissen er damit lostritt. Wie sich herausstellt, starb der Wissenschaftler keines natürlichen Todes. Jemand hat ein wenig nachgeholfen. Vermutlich die gleichen Personen, die jetzt hinter dem sonderbaren Schwert her sind, das Morgan unter den Bodendielen des Hauses des Wissenschaftlers zusammen mit einem in verschlüsselter Sprache verfassten Tagebuch gefunden hat.
Morgan macht sich daran, das Schwert zu untersuchen, und wie sich herausstellt, scheint es sich um das Schwert von Alexander dem Großen zu handeln. Doch sonderbarerweise besteht das Schwert aus Titan, und dieses war zur damaligen Zeit natürlich noch vollkommen unbekannt. Morgan macht sich zusammen mit seinem jungen Assistenten Hans daran, das Tagebuch zu entschlüsseln. Er beschafft sich dank eines Sponsors Mittel für eine kostspielige Expedition, die das Geheimnis des Schwerts lüften soll. Doch Morgan ist nicht der Einzige, der hinter der Wahrheit herjagt. Es beginnt eine nervenaufreibende und lebensgefährliche Verfolgungsjagd kreuz und quer durch Europa …
Liest man den Handlungsabriss, so klingt das alles eigentlich noch recht vielversprechend. „Götterschwert“ scheint genau die Zutaten vorweisen zu können, die es für einen spannenden und mitreißenden Roman braucht: ein mysteriöses Geheimnis, ein Wissenschaftler auf der Suche nach der Wahrheit, zwielichtige Gestalten, die skrupellos ihre eigenen Ziele verfolgen, und eine temporeiche Verfolgungsjagd mit stetig wechselnden Handlungsorten. So weit, so gut.
Das, was Frédéric Neuwald allerdings aus diesen Zutaten macht, ist nicht gerade das, was man ein schmackhaftes literarisches Menü nennen kann – eher schwer im Magen liegendes „Junk Food“. Der Klappentext verspricht |“Spannung pur“| und stellt Frédéric Neuwald in eine Reihe mit Andreas Eschbach, der mit [„Das Jesus-Video“ 267 seinerzeit eine spannende und mitreißende archäologische Schnitzeljagd zu Papier gebracht hat. Herrn Neuwald allerdings in die Schuhe von Herrn Eschbach zu stecken, halte ich für absolut falsch, denn die sind ihm mehr als nur eine Nummer zu groß und er muss zwangsläufig schon nach wenigen Schritten ins Stolpern geraten.
Schwachstellen offenbart „Götterschwert“ in vielerlei Hinsicht. Allem voran ist es die Romankonstruktion, die auf etwas wackeligen Füßen steht. Nicht jede Handlungswendung erscheint sonderlich logisch, und so gibt es im Romanaufbau mehrfach Stellen, an denen man als Leser die Stirn runzelt und mit einem Kopfschütteln nicht ganz nachvollziehbar erscheinende Entwicklungen der Handlung in Kauf nehmen muss.
Oft ist es das Verhalten der Protagonisten, das einem nicht logisch erscheint. Wieso zum Beispiel Morgan seinen absolut unfähigen Praktikanten Hans in die Geschichte des Schwerts überhaupt einweiht, obwohl er ihn am liebsten auf der Stelle loswerden will, ist nicht ganz klar. Auch, wieso die Bösewichte sich die Mühe machen, einen ganzen Häuserblock in die Luft zu sprengen, nur um einen einzigen, ohnehin an den Rollstuhl gefesselten und hinreichend eingeschüchterten Widersacher zu beseitigen, mag nicht so recht einleuchten.
Unzulänglichkeiten dieser Art hat der Leser mehrfach hinzunehmen. Damit ließe sich ja leben, wenn zumindest die Lektüre an sich so spannend und rasant daher kommen würde, dass man während des Lesens kaum Gelegenheit hätte, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Doch dem ist leider nicht so. Neuwald unternimmt immer wieder den Versuch, seinem Plot zu mehr Spannung zu verhelfen, aber leider vergeblich.
Die Entdeckung des Grabs von Alexander dem Großen kommt einem Spaziergang gleich und der eigentliche Handlungsverlauf ist mehr ein hitziges „Länder-Hopping“ als eine wirklich spannende Schnitzeljagd. Auf gerade einmal 360 Seiten verschlägt es unsere Helden in sage und schreibe sechs verschiedene Mittelmeerländer. Kaum sind sie an dem einen Ort angekommen, geht es auch schon weiter zum nächsten und meist geht es nur darum, in einem Besuch oder einem Gespräch die Fährte wieder aufzunehmen. So verläuft die Handlung zwar immerhin rasant, aber eben auch eher holprig als spannend.
Neuwald arbeitet von Haus aus beim Film, und das merkt man dem Roman sehr deutlich an. Hat er das Gefühl, der Roman tritt auf der Stelle, greift er zu Actioneinlagen, die vermutlich dem Zweck dienen sollen, die Spannung zu erhöhen. Das tun sie aber leider nicht unbedingt. Sie ziehen zwar kurzzeitig das Tempo an, da sie aber für den Handlungsverlauf eher überdimensioniert wirken, passen sie nicht so ganz zum Plot. So wie sich die geheimnisvollen Bösewichte den Weg teilweise freibomben und -brandschatzen, passt das nicht so ganz zu ihrer übrigen Vorgehensweise. Die Action wirkt also eher so, als wäre sie Mittel zum Zweck und sollte dem Roman die Spannung geben, die er ansonsten vermissen lässt.
Auch in der Figurenzeichnung bekleckert Neuwald sich nicht gerade mit Ruhm. Die meisten Figuren der Handlung wirken, als wären sie einem Katalog für Klischeeprotagonisten entnommen. Morgan ist der junge, aufstrebende Archäologe, gut aussehend, muskulös, mutig und von hohen moralischen Werten. Hans, sein Praktikant, tritt als der trottelige Assistent auf. Außer, dass er mittels seiner Computerkenntnisse das verschlüsselte Tagebuch entziffert, ist er eigentlich überflüssig für die Handlung. Und auch Amina, die hübsche ägyptische Archäologin, wirkt oft mehr wie schmückendes Beiwerk, für die kleine Affäre zwischendurch mit Morgan.
Mit Blick auf die Handlung bleiben recht viele Fragen im Raum stehen, denn die Antworten, die Neuwald liefert, sind teilweise ausgesprochen unbefriedigend. Das Rätsel des Schwerts wird kaum richtig gelöst. Den wirklich interessanten Fragen wird nicht mit dem Eifer nachgegangen, den man sich wünschen würde. Insgesamt bleibt die Auflösung mysteriös und das ist dann eigentlich auch der einzige Aspekt, auf den sich die Bezeichnung „Mysterythriller“ auf dem Buchdeckel beziehen ließe. Neuwald ist mit seinem „Mystery-Faktor“ am Ende aus dem Schneider, braucht nichts mehr großartig zu erklären und kann sich in allen ungelösten Fragen darauf berufen. Für den Leser aber ist das eher unbefriedigend.
Wie man sich im Hause |Knaur| dazu hinreißen lassen konnte, diese im Großen und Ganzen eher weniger zufriedenstellende Lektüre auch noch mit dem Etikett „Thriller des Monats“ zu versehen, bleibt übrigens mindestens genauso rätselhaft …
Bleibt als Fazit festzuhalten, dass „Götterschwert“ ein Roman ist, den man nicht zwangsläufig weiterempfehlen muss. Es gibt am Markt genügend Thriller, die bei weitem besser sind. „Götterschwert“ krankt dagegen an vielen Schwächen: wenig Spannung, keine sonderlich mitreißende Handlung, Figuren, die den Leser weitestgehend kalt lassen, und ein Plot, der in vielen Punkten einfach zu sehr mit der Brechstange bzw. dem Titanschwert zurechtgebogen erscheint.
Ruiz Zafón, Carlos – Schatten des Windes, Der
Joschka Fischer ist nicht unbedingt derjenige, den man fragen würde, welches Buch man lesen sollte. Der ehemalige Außenminister mag für vieles bekannt sein, aber sicherlich nicht unbedingt wegen seiner Literaturtipps. Dennoch ist es schon ein wenig ermutigend und ansteckend, wenn man im Klappentext zu „Der Schatten des Windes“ von Carlos Ruiz Zafón seine Empfehlung liest: |“Sie werden alles liegen lassen und die Nacht durch lesen!“| Das entpuppte sich zumindest in meinem Fall als Empfehlung prophetischen Charakters, denn gerade im letzten Drittel des Buches war ich doch sehr geneigt, der Müdigkeit mittels erhöhter Espressoration den Garaus zu machen, um das Buch so schnell wie möglich zu Ende zu bringen. Da hat es sich doch mal gelohnt, Herrn Fischer zu glauben …
„Der Schatten des Windes“ ist auf den ersten Blick ein recht unspektakuläres Buch. Die Handlung klingt nach gehobener Belletristik für die intellektuelle Oberschicht und weniger nach einem Roman zum Verschlingen. Die Geschichte spielt zur Zeit Francos in Barcelona. Der junge Daniel Sempere besucht zusammen mit seinem Vater, dem Buchhändler, den geheimnisvollen „Friedhof der Vergessenen Bücher“. Noch ahnt Daniel nicht, wie sehr dieser Besuch sein weiteres Leben verändern wird. Von all den Büchern, die dort in den Regalen ihr trostloses, staubiges Dasein fristen, darf Daniel sich eins aussuchen. Er entscheidet sich für „Der Schatten des Windes“ von einem Autor namens Julián Carax.
Daniel ist fasziniert von dem Roman und liest ihn wieder und wieder. Weil er gerne mehr von Julián Carax lesen würde, macht Daniel sich mit Hilfe seines Vater auf die Suche nach Carax‘ literarischen Spuren. Doch keiner weiß so recht, wo Carax lebt und ob er nicht schon längst tot ist. Daniel gerät in den Bann dieser sonderbaren Figur und trägt hier und da immer neue Bruchstücke einer faszinierenden Biographie zusammen.
Daniels Suche nach der mysteriösen Gestalt Julián Carax entwickelt sich immer mehr zu einem Spiel, dessen Regeln der Junge nicht zu durchschauen vermag. Merkwürdige Personen tauchen auf, legen falsche Fährten, versuchen zu vertuschen und stoßen gar Drohungen aus. Daniels Leben entwickelt sich dabei zunehmend analog zu „Der Schatten des Windes“, und ehe er sich versieht, steckt er schon mittendrin in der Handlung seines Lieblingsromans – im Kern einer Geschichte, die einem Strudel gleich ihre Protagonisten einem düsteren, furchtbaren Schicksal entgegentreibt …
Es stimmt schon, die Handlung mutet etwas sonderbar an, wenn man zum ersten Mal mit dem Klappentext konfrontiert wird. Ein Roman über einen Roman. Dass es dabei spannend zugeht und das Buch den Leser zum Ende hin so sehr in Beschlag nimmt, dass er sich kaum von den Seiten zu lösen vermag, möchte man auf den ersten Blick kaum glauben. Aber genau so ist es. Ruiz Zafón versteht es, den Leser auf eine Reise mitzunehmen, ihn aus seinem Alltag zu entführen und mitten in einen Plot zu ziehen, von dem der Leser absolut nicht ahnt, in welche Richtung er sich entwickeln mag.
Mit „Der Schatten des Windes“ ergeht es dem Leser genau so, wie es Daniel bei der Lektüre von Carax‘ Roman ergeht: |“Je weiter ich in der Lektüre kam, desto mehr erinnerte mich die Erzählweise an eine dieser russischen Puppen, die immer weitere und kleinere Abbilder ihrer selbst in sich bergen. […] Unter dem gelben Licht der Tischlampe tauchte ich in eine Welt von Bildern und Gefühlen, wie ich sie nie zuvor kennen gelernt hatte. […] Seite um Seite ließ ich mich vom Zauber der Geschichte und ihrer Welt einhüllen …“| (S. 12/13)
Auch Ruiz Zafóns Erzählweise erinnert an eine russische Puppe. Schicht um Schicht offenbart er dem Leser weitere Facetten seiner Geschichte, die sich mit jedem Kapitel weiter verschachtelt und den Leser gefangen nimmt. Seine Geschichte spielt sich dabei auf zwei Ebenen ab. Zum einen wird Daniels Suche nach Julián Carax beschrieben, zum anderen erhält der Leser immer wieder neue Einblicke, wie Carax‘ Leben seinerzeit verlaufen ist. Beide Erzählebenen laufen nebeneinander her und werden mit der Zeit immer mehr zu einem Ganzen verknüpft.
Ruiz Zafóns Verknüpfung der beiden Erzählebenen gelingt dabei ausgesprochen gut. Er schafft es, zwischen beiden Ebenen eine tiefe Bindung herzustellen, klärt die Zusammenhänge schlüssig auf und lässt es dabei nicht an dramatischen Überschneidungen mangeln.
„Der Schatten des Windes“ ist ein Roman, der sich diverser Zutaten bedient und gerade auch durch seine ausgewogene Mischung zu glänzen weiß. Ein bisschen Hommage an die Literatur, eine ordentliche Prise Liebesgeschichte, ein wenig politische Brisanz, die der zeitliche Kontext der Herrschaft Francos in sich birgt, ein guter Schuss Kriminalgeschichte, abgeschmeckt mit einem Hauch klassischem Schauerroman. Das mag nach einem heillosen Mischmasch klingen, ist in der Ausführung aber dann doch angenehm ausbalanciert. Gerade auch aufgrund dieser vielfältigen Zutaten dürfte Ruiz Zafón eine recht breite Leserschaft ansprechen. Irgendwo findet hier jeder genau die Komponente, die er besonders schätzt.
Zu einem besonderen Genuss wird „Der Schatten des Windes“ auch aufgrund Ruiz Zafóns sprachlichen Geschicks. Der Mann versteht es, mit Worten umzugehen, bedient sich einer sehr lebhaften und bilderreichen Sprache und sorgt so dafür, dass sich der Leser in den Roman und die Figuren richtiggehend hineinfühlen kann. „Der Schatten des Windes“ ist wahres Kopfkino und ein Hochgenuss für jeden, der die Gabe besitzt, in einem Roman sprichwörtlich zu versinken.
Ruiz Zafón versteht sich nicht nur auf plastische Bilder, sondern auch auf eine ausgefeilte Figurenzeichnung. Seine Figuren sind vielgestaltig und wirken, obwohl sie tendenziell eher plakativ schwarzweiß gezeichnet sind, nicht eindimensional. Man bekommt einen sehr plastischen Eindruck der Handelnden, wobei mir besonders eine Figur ans Herz gewachsen ist: der vom mittellosen Bettler zum „bibliophilen Berater“ von Sempere Senior aufgestiegene Fermín. Eine Figur mit großem Herzen, überragender Intelligenz und einem losen Mundwerk, das ihm so manchen Ärger einhandelt, aber den Leser immer wieder zum Schmunzeln bringt. Ruiz Zafón schafft Figuren, die man schnell in sein Herz schließt und an die man gerne zurückdenkt.
Ruiz Zafón fein geschliffene Ausdrucksweise thront über all dem und rundet die Raffiniertheit des Romans gelungen ab. Ein wenig poetisch wirkt sein Satzbau manchmal, geradezu melodisch und melancholisch. Das Barcelona, das Ruiz Zafón vor dem Auge des Leser skizziert, hat feine Nuancen, wird aber von vielen düsteren Tönen bestimmt. Die Zeit Francos hinterlässt einen bedrückenden Eindruck, dem der Autor mit dem Charme und Witz einer Figur wie Fermín einen schönen Gegenpol entgegenstellt.
So ziemlich alle Emotionen spiegeln sich in den Zeilen wider, und wenn Ruiz Zafón dann zum großen Finale ansetzt, darf auch schon mal die eine oder andere Träne weggeblinzelt werden. „Der Schatten des Windes“ ist ein Roman, der auf wunderbare Art und Weise nicht nur Gefühle beschreibt, sondern auch weckt. Dem einen mag das ein wenig kitschig erscheinen, den anderen reißt es dafür richtig mit. Wer sich noch vorbehaltlos auf eine Geschichte einlassen kann, wer einer Geschichte voller Phantasie, Melancholie, Witz und Dramatik offen gegenübersteht, der wird seine Freude an diesem Buch haben und für den könnte die Lektüre ein wahrer Hochgenuss sein.
Und, um zum Ende hin noch einmal Daniel Sempere höchstselbst zu Wort kommen zu lassen: |“Einmal hörte ich einen Stammkunden in der Buchhandlung meines Vaters sagen, wenige Dinge prägen einen Leser so sehr wie das erste Buch, das sich wirklich einen Weg zu seinem Herzen bahne. Diese ersten Seiten, das Echo dieser Worte, die wir zurückgelassen glauben, begleiten uns ein Leben lang und meißeln in unserer Erinnerung einen Palast, zu dem wir früher oder später zurückkehren werden, egal, wie viele Bücher wir lesen, wie viele Welten wir entdecken, wie viel wir lernen oder vergessen.“| In meinem Fall ist dieser Platz zwar schon belegt, aber „Der Schatten des Windes“ kommt immerhin schon recht nah daran …
Lindquist, Mark – Carnival Desires
Mark Lindquist ist hierzulande noch ein recht unbeschriebenes Blatt. In Amerika dagegen ist er weitaus bekannter. Bret Easton Ellis bekennt, dass Lindquist sein Lieblingsautor ist, und so wie Ellis auch, wurde Lindquist Ende der 80er und zu Beginn der 90er zum so genannten |“literarischen Brat Pack“| gezählt. Zum |“Brat Pack“| zusammengefasst wurden seinerzeit Autoren, die mit ihrem postmodernen Prosastil die Literaturkritik in wahre Verzückung versetzten. Neben Ellis und Lindquist zählte auch noch Jay McInerney dazu.
Lindquist tauchte als Romanautor zuerst 1987 mit „Sad Movies“ auf der Bildfläche auf. 1990 folgte der 2005 nun endlich auch auf Deutsch bei German Publishing veröffentlichte Titel „Carnival Desires“. Nach zehnjähriger kreativer Pause folgte 2000 dann „Never Mind Nirvana“. Der vierte Roman scheint in Arbeit zu sein.
Lindquists Biographie ist recht ungewöhnlich und dient ihm immer wieder als Inspirationsquelle für seine eindeutig autobiographisch gefärbten Romanfiguren. Bis Anfang der 90er schrieb Lindquist Drehbücher für große Hollywood-Studios. 1991 folgte dann ein radikaler Schnitt. Lindquist zog sich völlig zurück, studierte Jura und arbeitet heute als stellvertretender Staatsanwalt in Seattle.
Lindquist ist jemand, der hinter die Kulissen Hollywoods geschaut hat, und diese Erfahrungen und Eindrücke sind Teil seiner Romane. Seine Hauptfiguren arbeiten bei Filmgesellschaften, sind Schauspieler, Regisseure und Drehbuchautoren, wie Lindquist selbst. Nur bei „Never Mind Nirvana“ kommt die Hauptfigur aus einer anderen Ecke und ist – welch eine Überraschung – Staatsanwalt in Seattle.
Ausgangspunkt von „Carnival Desires“ ist Tim, der im Roman selbst aber keine allzu lebendige Rolle mehr einnimmt. Kein Wunder, denn Tim, der als Schauspieler tätig war, hat sich an Heiligabend erschossen – aus Langeweile. An Silvester kommen Tims Freunde zusammen, denken zurück an ihre gemeinsamen Jahre und grübeln über die Zukunft. Tims Freunde sind allesamt Endzwanziger und Teil von Hollywoods Film- und Partyszene. Tims Tod lässt sie einen Moment inne halten und über ihr Leben, ihre Träume und Ziele nachgrübeln.
Und so kommt es, wie es an Silvester zwangsläufig kommen muss: Es werden gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst. Der Drehbuchautor Bick will sich zur Ruhe setzen, in den Norden ziehen und ein religiöseres Leben führen, der Regisseur Oscar will eine Freundin finden, Mona will endlich einen Job ergattern, Schauspielerin Libby will eine Sprechrolle an Land ziehen und das Schauspielerpaar Merri und Willie will endlich erwachsen werden, was für Willie bedeutet, Merri zuliebe den Drogen entsagen zu müssen. Joys Vorsatz ist es, einen Vorsatz zu finden.
Ein paar Monate später wollen die Freunde sich wieder treffen und über Erfolg und Misserfolg ihrer Vorsätze urteilen. Die einen vergessen ihre Vorsätze so schnell, wie sie sie gefasst haben, andere arbeiten darauf zu, sie zu erfüllen und wiederum andere enden in einer absoluten Katastrophe …
„Carnival Desires“ ist ein Roman, der auf den ersten Blick einfach nur locker-flockige Lektüre zu sein scheint. Knappe Dialoge, gepfefferte Wortwechsel mit Witz und Ironie und eine Handlung, die mehr oder weniger daraus besteht, in Momentaufnahmen die unterschiedlichen Figuren der Geschichte zu beleuchten und zu Wort kommen zu lassen. Leichtgängige Unterhaltung über das schräge Leben in Hollywood.
Doch das würde dem Roman nicht ganz gerecht werden. Lindquists Roman hat zweifelsohne seine witzigen Momente, die vor allem im Partygeplänkel der Hauptfiguren und den flotten Wortwechseln durchschimmern, aber das ist eben noch längst nicht alles, was diesen Roman ausmacht.
Lindquist weiß, wovon er spricht. Die Hauptfigur Bick könnte er selbst sein. Die biographischen Parallelen sind offensichtlich. Lindquist hat durch diese Nähe zu seiner eigenen Biographie Charaktere erschaffen, die (gemessen an ihrer Umgebung) überraschend menschlich und real wirken. Man kann sich erstaunlich gut in sie hineinversetzen.
Lindquist versetzt seine Hauptfiguren in alltägliche Situationen und lässt seine Figuren ganz natürlich darin agieren. Bei einem Roman, der in einer realitäts-vakuumverpackten Welt wie Hollywood spielt, mag das ein wenig verwundern, aber es verleiht dem Roman eine besondere Note. Natürlich gibt es auch abgedrehte Figuren, wie den Schauspieler Willie, der alles, was er macht, gleich bis zum Exzess durchlebt, aber auch hinter seiner überdrehten, zugedröhnten Fassade schlummert ein überraschend menschlicher Kern. Bei Lindquist bietet fast jede Figur ihre eigenen Identifikationspunkte.
Jeder ist auf der Suche nach seinem persönlichen Glück. Jeder versucht auf seine individuelle Art, sich selbst zu verwirklichen, insofern ist Lindquists Blick hinter die Hollywood-Gesichter ein durch und durch menschlicher. Jeder hat irgendeinen wunden Punkt, jeder einen schwarzen Fleck auf der Seele und muss mit seinen eigenen Problemen fertig werden; und wie es scheint, ist es kaum irgendwo schwieriger glücklich zu werden als in Hollywood. Der Wert echter Freundschaft ist dabei unermesslich und genau das müssen auch die Figuren in Lindquists Roman erkennen.
Gewürzt wird „Carnival Desires“ durch Lindquists gewitzte und intelligente Art. Er schreibt in einem recht schlichten Stil, verschachtelt sich nicht im Satzbau, sondern bringt seine Aussagen zielsicher auf den Punkt. Ein großer Teil des Romans besteht aus Dialogen und so ist Lindquists Art, seine Ideen und Gedanken zu vermitteln, eine sehr direkte. Seitenhiebe auf Hollywood gibt es da natürlich in Hülle und Fülle, aber auch kritische Töne über die Funktionsweise und Machtstrukturen der Traumfabrik.
Alles in allem ist „Carnival Desires“ in all seiner Einfachheit überraschend vielschichtig. Lindquist treibt die Geschichte mit viel Schwung voran, erzählt direkt und gewitzt, mal nachdenklich, mal humorvoll und stets sehr menschlich. Wer mal einen halbwegs realistischen Blick hinter die Kulissen Hollywoods werfen will, der ist mit diesem Roman gut bedient und bekommt gleichzeitig noch ein unterhaltsames Werk zeitgenössischer Literatur in die Finger.
Lindquist hat eine ganz eigentümliche Mischung aus Witz und Melancholie, die durchaus Lust darauf macht, auch mal zu seinen beiden anderen Romanen „Sad Movies“ und „Never Mind Nirvana“ zu greifen. Freunden von Douglas Coupland und Konsorten sehr ans Herz zu legen.
Bradby, Tom – Herr des Regens, Der
Tom Bradby scheint ein Autor mit einer Vorliebe für exotische Handlungsorte zu sein. Spielt sein aktueller Roman „Der Gott der Dunkelheit“ in Ägypten, so zieht es die Hauptfigur seines Debütromans „Der Herr des Regens“ nach Shanghai. Und noch eine Vorliebe Tom Bradbys lässt sich mit einem Blick ausmachen: der historische Kontext. Beide Romane verbinden exotische Schauplätze, Krimiplot und ein historisches Setting zu einer fesselnden und vielschichtigen Lektüre.
„Der Herr des Regens“ spielt im Shanghai der 20er Jahre. Über Zeit und Ort erfährt man im Geschichtsunterricht nicht unbedingt viel, so dass es sich empfiehlt, parallel zur Lektüre einmal die historischen Hintergründe von Shanghai nachzuschlagen. Bradby hat seinen Roman in einer äußerst bewegten Epoche der Geschichte der Stadt angesiedelt.
Viele Nationen mischen in der Stadtgeschichte mit. Vor allem die Briten beherrschen das Bild. Shanghai erlangt im Laufe der 20er Jahre Ruhm als Weltmetropole und bedeutender Handelsstandort. Chinesen, Briten, Franzosen und Russen leben in den unterschiedlichen Stadtteilen Tür an Tür. Mit dem Aufkommen des Kommunismus werden die Zeiten unruhiger und „Der Herr des Regens“ spielt genau ein Jahr, nachdem die britischen Truppen Studentenproteste blutig niedergeschlagen haben.
1926 kommt der Protagonist Richard Field in die pulsierende fernöstliche Metropole Shanghai. Er ist jung und unerfahren und flieht vor der beengenden Familie in England und der eigenen Vergangenheit ins ferne China. Hier tritt er seinen Posten im Sonderdezernat der Polizei von Shanghai an, in der Hoffnung, sich in den nächsten Jahren der ehrenvollen Aufgabe polizeilicher Ermittlungsarbeit widmen zu dürfen.
Doch schon bald muss Field einsehen, dass die Realität nicht ganz dem entspricht, was er sich erhofft hat. Shanghai entpuppt sich als Hort der Sünden, Gewalt und Korruption. Sein erster Fall erweist sich gleich als heikel. Eine junge Russin wurde brutal ermordet. Bei den ersten Nachforschungen stößt Field schon bald auf einen Namen, dem er in der nächsten Zeit immer wieder begegnen wird: Lu Huang. Lu Huang ist ein sagenumwobener chinesischer Gangster, der in Shanghai viele Fäden in der Hand hält. Field ahnt noch nicht, worauf er sich einlässt, als er mit den Ermittlungen beginnt, doch schon bald blickt er in die dunklen Abgründe der Stadt und muss erkennen, dass es äußerst gefährlich ist, unbequem zu werden, wenn man nicht weiß, wem man trauen kann …
Tom Bradby ist mit „Der Herr des Regens“ ein interessanter und spannender Roman geglückt. Er skizziert ein lebendiges Bild der 20er Jahre in der Stadt und vermittelt dem Leser dadurch ganz nebenbei den Anreiz, sein geschichtliches Wissen der Zeit zu vertiefen. Die Epoche bietet für sich genommen schon ein spannendes Szenario für einen Kriminalroman. Shanghai eignet sich hierfür im Besonderen. Die Stadt galt als Sinnbild des Abenteurertums der Zeit, als Ort, an dem man reich werden konnte. In Shanghai schien alles zum Greifen nah. Jeder Wunsch konnte erfüllt, jedes Bedürfnis gestillt werden.
Auf den Punkt bringen kann man die Stimmung von Zeit und Ort in einem Satz, den Aldous Huxley im gleichen Jahr ausgesprochen hat, in dem auch der Roman spielt. Huxley hat nach eigener Aussage |“in keiner Stadt je einen solchen Eindruck von einem dichten Morast üppig verflochtenen Lebens“| wie in Shanghai bekommen. Genau diese Stimmung beschwört Tom Bradby in seinem Roman herauf.
In diese Szenerie versetzt er den jungen, idealistischen Polizisten Richard Field, der schon bald erkennen muss, dass polizeiliche Ermittlungsarbeit nicht immer die Suche nach der Wahrheit zum Ziel hat. Field bewegt sich in einem Umfeld, das permanentes Misstrauen verdient, weil man nie weiß, wer mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung steht und wer nicht, und in dem jeder ausgesprochene Satz schon einer zu viel sein könnte. Besonders verzwickt ist Fields Lage auch dadurch, dass er durch seinen Onkel Beziehungen zu den Reichen und Mächtigen der Stadt pflegt. Für einen naiven Frischling wie Field kommt das einem Bad in einem Haifischbecken gleich.
Man spürt als Leser die allgegenwärtige unterschwellige Bedrohung, eine Atmosphäre, die bei aller Exotik immer wieder düster und beklemmend wirkt. In mancher Hinsicht erinnert „Der Herr des Regens“ an opulente und verworrene Krimi-Noir-Geschichten wie [„L.A. Confidential“ 1187 von James Ellroy. Desillusioniert und bedrückend, atmosphärisch dicht und irgendwie undurchdringlich. Wer Kriminalromane von diesem Schlag mag, für den ist auch „Der Herr des Regens“ vortreffliche Lektüre.
„Der Herr des Regens“ ist ein Roman, den man sich bildlich ausgesprochen gut vorstellen kann. Bradby lässt sich zum Einstieg Zeit, Atmosphäre aufzubauen, gibt seinem Protagonisten Field Gelegenheit, in seine neue Rolle hineinzuwachsen und baut die Spannung gemächlich auf, um den Leser dann zum Ende hin nägelkauend weiterlesen zu lassen. Besonders das letzte Viertel ist derart spannungsgeladen, dass man das Buch kaum zur Seite legen mag.
Wahres Kopfkino inszeniert Bradby und so kann man sich problemlos vorstellen, dass auch Hollywood an der Entwicklung der Figur Richard Fields und seinen heldenhaften Anwandlungen zum Ende hin Gefallen haben könnte. Andererseits fällt das Ende der Geschichte in Anbetracht der ansonsten so düsteren und dichten Stimmung des Romans auch ein wenig zu glatt und gefällig aus. Ein bisschen weniger Happyend hätte nicht geschadet und der Geschichte zusätzliche Glaubwürdigkeit verliehen.
Was die Verteilung der Rollen zwischen Gut und Böse angeht, so hätte Bradby sich meiner Meinung nach ruhig noch etwas mehr Mühe geben können, die Fährten ein wenig mehr zu verwischen. Die Andeutungen und Hinweise, die er ausstreut, sind manchmal einfach zu offensichtlich, so dass man als Leser mit etwas Krimierfahrung sicherlich nicht sonderlich überrascht ist, wenn enthüllt wird, wer richtig und wer falsch spielt, wer wirklich verdächtig ist und wer nicht. Und so erscheint zum Ende hin dann auch so mancher „Sinneswandel“ nicht unbedingt bis ins Mark glaubwürdig.
Ähnlich blass bleibt die Enthüllung des Mörders. Die Motive werden kaum deutlich und bleiben einfach zu schwammig und fragwürdig, um den Täter wirklich überzeugend erscheinen zu lassen, und so ist die Auflösung des Krimiplots sicherlich nicht zu den Highlights des Romans zu zählen. Atmosphäre und Spannungsbogen können aber durchaus dagegenhalten, um zumindest teilweise über diese Mängel hinwegzutrösten.
Bradby fährt eine lesenswerte und spannungsgeladene Mischung auf, die einerseits geschichtliche Hintergründe eines interessanten und exotischen Schauplatzes einbezieht und andererseits einen spannenden Plot mit interessanten Figuren entwickelt, der nebenbei gar noch eine verzwickte Liebesgeschichte auffährt. Die Mischung geht in jedem Fall auf, und so ist das Resultat ein unterhaltsamer und spannender Krimi, dem man die eine oder andere kleinere Schwäche aufgrund der dichten Atmosphäre und der Exotik des Schauplatzes gerne mal verzeiht.
Christoph Marzi – Lilith (Die Uralte Metropole 02)

Vier Jahre sind seit den Geschehnissen in „Lycidas“ vergangen. Emily hat sich daran gewöhnt, dass sie als Trickster eine besondere Gabe hat, die sie von den anderen Kindern an der Whitehall-Privatschule in London ausgrenzt und das Mädchen mit dem Mondsteinauge zu einer Außenseiterin macht. Doch Aurora Fitzrovia, die schon seit den Tagen im Waisenhaus von Rotherhithe ihre beste Freundin ist, hält auch weiter zu ihr.
Christoph Marzi – Lilith (Die Uralte Metropole 02) weiterlesen
Annegret Held – Die letzten Dinge. Roman
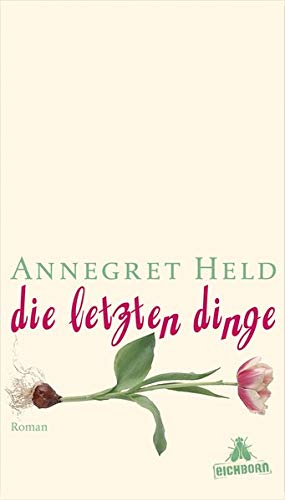
Annegret Held – Die letzten Dinge. Roman weiterlesen
Apperry, Yann – zufällige Leben des Homer Idlewilde, Das
Kuriose, liebenswerte, naive Verlierertypen mit Heldenmut müssen sich stets mit einem messen: Forrest Gump. Auch Homer Idlewilde wird sich wohl bei manchem Leser damit vergleichen lassen müssen. Parallelen gibt es sicherlich, dennoch ist Homer Idlewilde kein zweiter Forrest Gump. Auch er ist ein reichlich naiver Typ, der sich zum Helden mausert, dennoch trennt ihn einiges von Forrest Gump. Er macht zwar auch einen eher kindlichen Eindruck, entzieht sich dem Erwachsenwerden aber nicht durch sein geistiges Niveau, sondern eher durch seinen Hang zu Streichen und kleineren Sabotageakten. Homer ist eine kauzige, aber ebenso liebenswürdige Vagabundenfigur, deren Schicksal vielleicht nicht so rührend ist wie das von Forrest Gump, dessen Geschichte aber dennoch zu unterhalten weiß und zu Herzen geht. Wer will auch schon einen zweiten Forrest Gump …
Homer Idlewilde, Findelkind und Waisenjunge, wächst in Farrago, im Norden Kaliforniens auf. Schon in jungen Jahren zieht er vagabundierend übers Land, um sich dem Zwang der Schulpflicht zu entziehen. Nachdem er seinem schulpflichtigen Alter entronnen ist, zieht es ihn zurück in seine Heimat Farrago. Es ist Anfang der Siebzigerjahre, ob es das Jahr 1971 oder vielleicht 1973 ist, weiß Homer genauso wenig, wie den Tag, an dem er geboren wurde. Homer vertreibt sich die Zeit mit Träumereien und Gelegenheitsjobs. Er vertändelt seine Zeit auf dem Schrottplatz bei seinem Freund Duke, bei dem Taugenichts Elijah, der schon seit 15 Jahren eine Schmiede eröffnen will, oder im Lebensmittelladen seines Freundes Fausto.
Eines Nachts, als Fausto ihm erzählt, wie es ihn nach Farrago verschlagen hat, und Homer staunend feststellt, dass Fausto das hat, was er selbst nicht hat, nämlich eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, tut sich auch für Homer eine neue Perspektive auf. Eine Sternschnuppe fällt vom Himmel und Homer wünscht sich ein Schicksal, eine eigene Geschichte, die ihn aus der Bedeutungslosigkeit seines Daseins heraushebt. Und noch bevor Homer begreift, was überhaupt vor sich geht, nehmen die Dinge ihren Lauf. Homers Schicksal entwickelt sich …
Mit „Das zufällige Leben des Homer Idlewilde“ hat der Franzose Yann Apperry einen sympathischen Roman abgeliefert. Es ist sein zweiter Roman, nachdem er, erschreckt durch den Medienrummel um seinen Debütroman, aus Frankreich in die USA geflohen und dort zwei Jahre vagabundierend durch die Lande gezogen ist. Ein bisschen Homer scheint also auch in Yann Apperry zu schlummern.
Mit viel Herz erzählt er die Geschichte seiner Hauptfiguren, die allesamt ein wenig schräge Vögel sind. Homer und Duke, zwei Vagabunden, die zusammen auf dem Schrottplatz über das Leben philosophieren; Elijah, der von seiner Schmiede träumt, aber geistig nicht ganz auf der Höhe ist; Fausto, der ein trauriges Dasein im Lebensmittelladen von Farrago fristet, obwohl er eigentlich mehr aus seinem Leben machen könnte. Und dann wäre da noch Ophelia, die im Puff von Farrago arbeitet und Homers heimliche Geliebte ist und ihn vor die größte Herausforderung seines Lebens stellt.
Homer ist sympathisch und schlitzohrig zugleich. Vom Sheriff wird er ständig wegen irgendwelcher kleineren Delikte gesucht, gleichzeitig aber auch wegen seiner Ortskenntnisse in den Wäldern um Farrago geschätzt. Im Grunde ist Homer ein außerordentlich naiver Kerl, mit einer ausgeprägten kindlichen Ader, die ihn immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Ein Träumer, der sich durchs Leben treiben lässt – zumindest bis zu jenem denkwürdigen Sternschnuppenwunsch. Von diesem Moment an nimmt Homers Leben eine Wendung. Für ihn beginnt eine Odyssee, in deren Kern die Suche nach dem Sinn des Lebens steht. Homer erlebt gleichsam Komisches wie Tragisches, und das Schicksal nimmt schneller seinen Lauf, als Homer es begreifen kann, doch am Ende scheint er begriffen zu haben, worum es im Leben geht und wie er seinem eigenen Leben einen Sinn geben kann.
Rund um die Figur des Homer erzählt Yann Apperry allerhand kuriose, komische und tragische Geschichten über das Leben in Farrago. Er erzählt frei von der Leber weg einfach drauflos, in einem schlichten, aber auch durchaus zu Herzen gehenden Stil. Genau das ist es, was diesen Roman lesenswert macht. Es ist Lektüre, die Spaß macht, sich durch einen sehr feinsinnigen Humor auszeichnet und den Leser einzunehmen versteht.
Man mag dem Autor vorhalten, dass seine Figuren allesamt zu schräg sind, um wirklich realistisch zu erscheinen und wirklich rühren zu können, doch Apperry verpackt seine Geschichte sprachlich so schön, dass man gerne darüber hinwegsehen mag. „Das zufällige Leben des Homer Idlewilde“ hat seine rührenden Momente, die der Leser nicht vergessen wird, auch wenn der Plot mit Blick auf Homers heldenhafte Taten ein wenig zurechtgebogen erscheinen mag.
Ein wenig steht die Geschichte eben auch im Zeichen jener Magie, die mit dem ausgesprochenen Wunsch beim Anblick der fallenden Sternschnuppe verbunden ist. Da kann man eine etwas fantastisch anmutenden Entwicklung des Plots durchaus verzeihen, da sie sicherlich auch genau so beabsichtigt ist. Damit mag sich mancher Leser mehr anfreunden können und mancher eben weniger.
Ganz zufällig stolpert Homer in Situationen, die ihn als Held erscheinen lassen, ohne dass er viel dazu beitragen muss. Er mäandert ein wenig orientierungslos durch sein Schicksal, aber er lernt, das Beste daraus zu machen, und schafft es obendrein, sich der Verantwortung zu stellen, mit der er konfrontiert wird. So zufällig wie Homer in die verschiedensten Situationen stolpert, so stetig reift er heran und entwickelt sich. Es ist kein plötzliches Erwachsenwerden, sondern ein zunächst zaghaftes Sichausliefern gegenüber dem Leben mit allen Schikanen. Und dabei muss eben auch ein Homer Idlewilde erkennen, was es ist, das das Lebens lebenswert macht.
Bleibt abschließend festzuhalten, dass Yann Apperry sich wirklich aufs Geschichtenerzählen versteht. Recht unspektakulär mag sein zweiter Roman „Das zufällige Leben des Homer Idlewilde“ erscheinen, unaufregend und ein wenig zu fantastisch. Aber dahinter verbirgt sich ein wahres Kleinod, das manchmal rührend, manchmal tragisch und manchmal gar komisch ist.
Apperry hat einen feinsinnigen Humor, mit dem er seine Erzählung zu würzen versteht. Wer offen für eine leise, etwas fantastisch anmutende Geschichte mit liebevoll skizzierten, aber gleichermaßen schrägen Figuren ist, der wird an „Das zufällige Leben des Homer Idlewilde“ sicherlich seine Freude haben.
Ishiguro, Kazuo – Alles, was wir geben mussten
Kazuo Ishiguro hat mit „Was vom Tage übrigblieb“ einen Weltbestseller abgeliefert, der nicht nur mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle verfilmt sondern obendrein mit dem |Booker Prize| ausgezeichnet wurde. Erneut auf die Long List für den |Booker Prize| 2005 hat Ishiguro, der in Nagasaki geboren wurde und seit 1960 in London lebt, es mit seinem neuesten Roman geschafft. „Alles, was wir geben mussten“ heißt das Werk und wird nicht umsonst von Kritikern und Presse gleichermaßen vollmundig gelobt.
„Alles, was wir geben mussten“ ist auf den ersten Blick eine ganz gewöhnliche Internatsgeschichte. Doch der Schein trügt. Die Kinder sind keine gewöhnlichen Kinder, auch wenn man ihnen das nicht ansieht. Sie spielen Fußball, gehen jeden Tag zum Unterricht und erleben genau wie andere Kinder die Tücken der Pubertät. Und doch ist das Internat Hailsham etwas ganz anderes, als man auf den ersten Blick denken mag. Die Lehrer werden hier Aufseher genannt und den Kindern, die allesamt keine Eltern haben, wird schon von früh auf bewusst gemacht, dass sie etwas Besonderes sind. Sie sollen später „spenden“ und „betreuen“. Darauf soll Hailsham sie vorbereiten, doch was die Kinder sich darunter vorzustellen haben, sagt ihnen keiner so recht.
In Hailsham wachsen auch Kathy, die die Geschichte aus ihrer Sicht erzählt, und ihre besten Freunde Ruth und Tommy auf. Sie wachsen gut behütet auf, bleiben aber nicht nur in Hailsham, sondern auch später von der Außenwelt größtenteils abgeschnitten. Kathy hat eine ebenso ungewöhnliche wie auch erschütternde Lebensgeschichte zu erzählen, als sie mit einunddreißig auf ihre Jugendjahre zurückblickt …
„Alles, was wir geben mussten“ ist ein Roman, der es in sich hat. Auf den ersten Blick noch ein harmloses Stück Jugend- und Internatsgeschichte, entpuppt sich der Roman mit fortschreitender Seitenzahl zunehmend als moralischer Abgrund. Ishiguro greift einen Themenkomplex auf, der gerade in ethischer Hinsicht viele Fragen aufwirft. Man ahnt es schon beim Lesen der Inhaltsbeschreibung. Die Kinder in Hailsham sind keine normalen Waisenkinder. Und schon nach wenigen Kapiteln erlangt man zunehmende Gewissheit. Sie sind Klone, erschaffen, um als lebende Ersatzteillager für die Medizin zu dienen. Die Kinder wissen um ihr Schicksal und wissen es gleichzeitig nicht.
Ihre ganze Jugend dient dazu, sie auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Das lernen die Kinder schon früh. Ob sie sich aber der Tragweite des Ganzen bewusst sind und ob sie wirklich begreifen, wer und was sie sind, das darf natürlich bezweifelt werden. Sie ahnen es vielleicht, aber damit umzugehen, sich der Konsequenzen bewusst zu werden, das zeigt ihnen niemand. Ihr Leben ist streng vorgezeichnet. Weil sie wertvoll und wichtig sind, werden sie entsprechend sorgsam behütet.
Entsprechend seines Themas ist „Alles, was wir geben mussten“ ein Roman, der den Leser intensiv beschäftigt. Lebhaft skizziert Ishiguro seine Figuren, und gerade weil der Leser anfangs noch genauso ahnungslos ist wie die Kinder, gerade weil die grausame Realität erst dann komplett entblättert wird, wenn man die Protagonisten schon längst in sein Herz geschlossen hat, trifft einen ihr Schicksal besonders hart. Man lernt sie als Kinder kennen, ist nicht in der Lage, sie nicht als vollwertige Menschen zu sehen und ist dann zutiefst getroffen von dem, was ihnen bevorsteht, wenn sie erwachsen sind. Gerade die Ahnungslosigkeit, mit der die Kinder ihrem Schicksal entgegentreiben, lässt die bittere Realität umso härter erscheinen.
„Alles, was wir geben mussten“ ist ein Lehrstück in Sachen Fremdbestimmtheit. Durch die stetige Einflussnahme von Beginn an treten die Kinder schicksalsergeben ihrer Zukunft entgegen. Aufbegehren gibt es nur im Kleinen, im Großen fügen sie sich alle in das ihnen aufgezwungene Schema. Und so wirft der Roman auf sehr vielschichtige Weise moralische Fragen auf. Die ethische Frage nach einer Rechtfertigung des Klonens ist dabei nur ein Aspekt, wenngleich sicherlich der wichtigste. Ishiguro vermag sich dieser Frage aber durch seinen feinfühligen Umgang mit den Figuren von verschiedenen Seiten zu nähern. Vor allem die persönliche Ebene ist dabei wichtig. Er betrachtet die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder vor dem Hintergrund dieser Problematik und zeigt, wie sie um die Unbeschwertheit ihrer Kindertage betrogen werden, um einem höheren Zweck zu dienen.
Die wissenschaftliche und technologische Komponente tritt dabei in den Hintergrund. Ishiguro konzentriert sich voll und ganz auf die Figuren und als Gegenpol dazu auf die Gesellschaft. Was dabei besonders beeindruckt, ist, wie realistisch Ishiguro das Thema angeht. So, wie er es schildert, von der gesellschaftlichen Komponente und von moralischer Seite her, wäre es durchaus vorstellbar. Nichts wirkt überzeichnet. Alles erscheint so, wie man es sich in der Realität tatsächlich vorstellen könnte.
Und so zeichnet sich „Alle, was wir geben mussten“ eben auch dadurch aus, dass das Buch vom moralischen und ethischen Standpunkt aus gerade deswegen so viel Stoff zum Nachdenken liefert, weil Ishiguro es in einen so leicht vorstellbaren gesellschaftlichen Rahmen steckt. Im Kleinen wie im Großen, in den Figuren wie auch in den äußeren Rahmenbedingungen wirkt alles bis ins Mark im Rahmen des theoretisch Möglichen und das macht die Angelegenheit dann auch ein bisschen unheimlich.
So fiebert der Leser mit den Figuren, ohne dass Ishiguro sich irgendwelcher Effekthascherei bedienen müsste. Das Gefühlsleben der Protagonisten, ihre Sicht der Welt und ihr langsames Begreifen dessen, was da vor sich geht, sind für sich genommen fesselnd und aufwühlend genug. „Alles, was wir geben mussten“ ist Lektüre, die zu Herzen geht, zum Nachdenken anregt und ganz hervorragend als Diskussionsgrundlage dient.
Sprachlich ist Ishiguros Werk faszinierend schlicht gestrickt. Er bedient sich einer recht einfachen Sprache und erzählt aus Sicht der Kathy, als würde sie in ihrer Erinnerung kramen, die sie nach und nach vor dem Leser ausbreitet. Den Kern seiner Thematik fasst Ishiguro geradezu mit Samthandschuhen an. Einschlägige Fachbegriffe tauchen kaum auf. Nur selten ist vom Klonen direkt die Rede. Die Sprache, die die Kinder in Hailsham lernen, verschleiert die Dinge und steht damit im harten Kontrast zur Wirklichkeit. Der Leser als derjenige, der die Hintergründe erahnt, weiß auch so genug Bescheid, und der Moment, an dem auch für die Protagonisten die Fassade bröckelt, wirkt dadurch besonders hart.
Zusammenfassend kann man „Alles, was wir geben mussten“ wirklich nur jedem ans Herz legen. Ein Roman ohne unnötige Effekthascherei, der sich ganz auf seine Protagonisten konzentriert und dabei so schwerwiegende moralische und ethische Fragen aufwirft, dass man noch eine ganze Weile daran zu knabbern hat. Ein wenig verstörend, aber auch schön erzählt Ishiguro eine ungewöhnliche Jugendgeschichte. Erschreckend, nachdenklich stimmend und zutiefst berührend. Ein leiser, aber gleichzeitig immens kraftvoller Roman, der im Gedächtnis haften bleibt.
Hoffman, Alice – Flusskönig, Der
Es gibt Bücher, die passen in keine Schublade. Sie lassen sich nicht einem bestimmten Genre zuordnen, sie passen nicht so recht in bekannte Strickmuster und entziehen sich so der unkomplizierten Kategorisierung. Solche Bücher haben es oft schwer. Viele wissen nicht so recht etwas mit ihnen anzufangen und werten das Fehlen genretypischer, schubladengerechter Merkmale als Ziellosigkeit des Autors. Ein Urteil, das sicherlich manch einer auch auf die Schnelle über den „Flusskönig“ von Alice Hoffman fällen mag – und damit vermutlich genauso recht hat wie jener, der das Gegenteil behauptet.
Die Mischung, die Alice Hoffman in „Der Flusskönig“ auffährt, hat es dementsprechend in sich. Ein bisschen Kriminalgeschichte, ein bisschen Liebesgeschichte, alles im Rahmen einer dörflich-biederen Naturidylle in Neuengland, eine Prise Übersinnliches, abgeschmeckt mit einem Hauch Kitsch und garniert mit einer blumigen, bildhaften Sprache. Das ist – etwas vereinfacht – die Rezeptur, aus der Alice Hoffman ihr ganz eigenes Süppchen kocht, und so eigenwillig, wie die Rezeptur anmutet, so unterschiedliche Reaktionen ruft sie sicherlich auch an den Geschmacksnerven der Leser hervor. So ganz eindeutig mag mein Urteil da auch nicht ausfallen, denn irgendetwas stimmt hier und da mit den Zutaten nicht so ganz. Ein leicht fahler Nachgeschmack bleibt auf jeden Fall zurück.
Dabei fängt die Geschichte so klassisch und zeitlos an, dass man zunächst gar nicht weiß, in welchem Jahrhundert sie spielt. Erst durch die Erwähnung von Mountainbikes, E-Mails, etc. merkt man, dass die Geschichte tatsächlich heute spielt – was allerdings nicht ganz glaubwürdig erscheinen mag. Ort des Geschehens ist die Haddan School, ein renommiertes, altehrwürdiges Internat in Neuengland, auf das seit jeher die verwöhnten Kinder gut betuchter Familien geschickt werden. Das erscheint vor dem Hintergrund, dass die Haddan School eine teilweise abrissreife Bruchbude voller Ungeziefer ist, als ein etwas merkwürdiger Widerspruch (gerade in der heutigen Zeit), aber machen wir uns darum einfach keine weiteren Gedanken. Der Widerspruch bleibt ohnehin ungeklärt im Raum stehen und wird nicht die einzige Fragwürdigkeit des Romans bleiben.
Die Haddan School liegt etwas außerhalb des Ortes Haddan, am Ufer des gleichnamigen Flusses. Die Dorfbewohner sind nie mit der Schule und ihrem elitären Drang nach Abgrenzung warm geworden und halten sich daher misstrauisch von ihr fern. Man ignoriert sich größtenteils gegenseitig, und da, wo zwangsläufige Berührungspunkte entstehen, hält man sich bedeckt.
Es ist Spätsommer in Haddan, das neue Schuljahr steht vor der Tür und so reisen die Schüler aus ihrer teils fernen Heimat nach Neuengland. Zu ihnen zählen auch Carlin Leander, die bildhübsche, talentierte Schwimmerin, und der gleichaltrige Eigenbrödler August Pierce. Beide zählen zu den Neuankömmlingen und haben ein hartes Schuljahr vor sich, in dem sie sich ihren Platz in der Schülergemeinschaft und den Respekt der Mitschüler erkämpfen müssen. Carlin findet über das Schwimmteam recht leicht Anschluss, während August ein Außenseiter bleibt und nicht bereit zu sein scheint, sich den geltenden Spielregeln unterzuordnen. Seine einzige Bezugsperson ist Carlin, und trotz vieler widriger Umstände entsteht zwischen den beiden eine Art Freundschaft.
Doch es gibt Probleme. August kommt an der neuen Schule offenbar noch schlechter klar als an der alten, und als eines Morgens Augusts Leiche aus dem Fluss gezogen wird, ist man an der Schule nur allzu gerne dazu bereit, den Tod als Selbstmord abzutun. Auch Abel Grey, der ortsansässige Polizist, kommt mit seinen Ermittlung nicht so recht voran. Offenbar haben sowohl seine Kollegen als auch die Schulleitung keine Interesse daran, die Umstände des Todes näher zu beleuchten. So macht Abel sich auf eigene Faust an die Ermittlungen und stößt dabei auf allerhand Unerklärliches und Seltsames – und auf eine Frau, die seine große Liebe werden soll.
Auf den ersten Blick mag die Handlung nach Krimi riechen, aber bei näherer Betrachtung entpuppt sich das als die falsche Schublade. Es gibt zwar eine Leiche und es werden Ermittlungen angestellt, aber dass dabei die Spannung eines wirklichen Krimis aufkommt, kann man kaum behaupten. Der Todesfall des Schülers ist eher ein Aufhänger für die Geschichte und insofern erinnert „Der Flusskönig“ ein wenig an „Schnee, der auf Zedern fällt“ von David Guterson. Für die Kriminalgeschichte, als die man sie gemeinhin ansieht, sind beide Romane zu vielschichtig. Alice Hoffman konzentriert sich weniger auf die Ermittlungen oder die Umstände des Todes (die werden ganz lapidar am Rande aufgeklärt – leider ohne groß in die Handlung eingebunden zu werden), sondern erzählt die Geschehnisse drumherum.
Und so wäre die treffendste Bezeichnung, die mir für diese Art Roman einfällt, ein „Erzählroman“, auch wenn dies etwas sonderbar klingen mag. Diese Bezeichnung deutet aber immerhin bereits an, was den Kern des Buches ausmacht, nämlich das Erzählen an sich. Und das muss man Alice Hoffman dann doch lassen: Erzählen kann sie. Daher rührt vermutlich auch die Auszeichnung von „Entertainment Weekly“, die sie als eine der „100 kreativsten Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche“ ehrt – zurückzuführen vermutlich auf ihre gefeierte Romanvorlage zum Film „Zauberhafte Schwestern“ mit Nicole Kidman, Sandra Bullock und Diane Weeks.
Hoffman bedient sich einer etwas blumigen Sprache. Sie erzählt ihre Geschichte auf sehr plastische Weise und versteht es, ihr durch ihre Schilderungen so viel Leben einzuhauchen, dass das Buch im wahrsten Sinne des Wortes Kopfkino ist. Man muss ihr schon lassen, dass sie sich darauf versteht, Stimmungen zu erzeugen. Die Art, wie sie Landschaften und Menschen beschreibt, erinnert mich auch hier wieder ein wenig an David Guterson – mit dem Unterschied, dass ich Guterson noch für einen Tick besser halte. Guterson wirkt nicht so selbstverliebt in die eigene Formulierungskunst, wie es bei Hoffman hier und da durchschimmert. Auch wenn ihr Sprachstil im Großen und Ganzen wirklich schön und geradezu poetisch ist, gelegentlich drängt sich der Eindruck auf, es wäre etwas viel des Guten – vor allem dann, wenn hinter der blumigen Erzählweise auch die Handlung etwas kitschige Züge entwickelt. Da werden dann zartbesaitete Schülerinnen auch schon mal von obskuren Rosendüften ohnmächtig.
Insgesamt zeigt sich auf dieser Ebene ein leichter Hang zum Übernatürlichen. Hoffman verlangt dem Leser sehr viel Toleranz ab – das gilt nicht nur für das Ignorieren sämtlicher Genreschubladen, sondern trifft auch auf die Entwicklung der Geschichte zu. Es tauchen eine Reihe unerklärlicher Phänomene auf, die im Zusammenhang mit Augusts Tod stehen, die dem Roman eine leicht mystische Stimmung verleihen – von wirklicher Mystery à la „Akte X“ kann aber bei weitem nicht die Rede sein – und so wirken manche dieser Elemente eben auch eher kitschig als unheimlich. Ob man diesen Aspekt für die Handlung unbedingt so strapazieren musste – vielleicht hätte man es einfach bei dezenten Andeutungen belassen sollen. Was an Authentizität mit Blick auf die Figuren zu loben wäre, macht Hoffman damit zumindest ein wenig wieder zunichte.
Die Beschreibung der Figuren bekommt recht viel Raum. Sie blickt zurück in deren Vergangenheit und lässt sie in der Gegenwart in aller Ruhe agieren, fast so, als ergebe sich die Handlung dann von selbst. Ein weiterer Aspekt, an dem sich sicherlich die Geister scheiden. Der eine wird wohl denken, dass die Handlung überhaupt nicht voran kommt, der andere wird sich über den tiefen Einblick in das Seelenleben der Hauptfiguren freuen. Ich zähle mich eher zu Letzteren.
Doch obwohl man den Figuren recht nahe steht und obwohl man einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt bekommt, blieben mir manche Verhaltensweisen ein wenig unverständlich. Insbesondere trifft dies auf die Lehrerin Betsy zu, deren Bekanntschaft Abel Grey bei seinen Ermittlungen macht. Gerade was die Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Figuren angeht, kann man nicht immer die Verhaltensweisen sonderlich gut nachvollziehen – was man nicht nur der mangelnden Rationalität „großer“ Gefühle in die Schuhe schieben kann, sondern letztendlich eher der Autorin vorhalten muss.
Und so kann dann trotz sprachlicher Ausgefeiltheit der Handlungsverlauf nicht immer restlos überzeugen. Man hängt am Ende irgendwie in der Schwebe. Nicht alle Handlungsstränge werden zufrieden stellend aufgelöst, hier und da liegt einem am Ende immer noch ein „Ja, aber …“ auf der Zunge. Fast so, als hätte Frau Hoffman in ihrer sprachlichen Selbstverliebtheit vergessen, sich einen wirklich runden Handlungsverlauf zu überlegen. Es gibt zwar einige Aspekte, die sie sehr gut löst (beispielsweise den Verlauf der Ermittlungen, die Abel anstellt), dafür aber auch andere, die etwas überstürzt und wenig überzeugend aufgelöst erscheinen (beispielsweise die Liebesgeschichte zwischen Abel und Betsy).
Sprachlich und von der Charakterzeichnung her ist der Roman am Ende trotz allem dann doch noch so gut, dass man der Autorin manchen Schnitzer in der Handlung verzeihen möchte. Nicht gänzlich, aber ein ganz kleines bisschen eben, denn schön zu lesen ist „Der Flusskönig“ in jedem Fall, auch wenn es kein Buch ist, das unbedingt bleibenden Eindruck hinterlässt.
Lehr, Thomas – 42
Die 42 ist eine Zahl, mit der man gerne Gutes verbindet. Man denkt unweigerlich gleich an Douglas Adams, bei dem 42 die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest ist, wenngleich diese sonderbare Antwort natürlich ganz neue Fragen aufwirft. Ironischerweise wohnt auch Agent Mulder aus der Mystery-TV-Serie „Akte X“ in Appartement Nr. 42. Sinnbildlich kann man die 42 also auch für die Suche nach dem Unbekannten, nach den unbeantworteten Fragen der Menschheit sehen. Und nun hat der deutsche Autor Thomas Lehr sein eigenes Stück zum Mythos der 42 beigetragen – einen Roman mit eben diesem Titel, in dem es ebenfalls um ein unerklärliches Phänomen geht.
Das Szenario, das Lehr in „42“ entwickelt, ist faszinierend: An einem wunderschönen Sommertag besichtigt eine Gruppe von Wissenschaftlern, Journalisten und Politikern das Schweizer Forschungszentrum CERN, vor den Toren von Genf. Doch es ist kein gewöhnlicher Sommertag. Als die Besuchergruppe um genau 12:47:42 Uhr aus dem Fahrstuhl des DELPHI-Schachtes tritt, ereignet sich ein erschreckend verstörender Störfall: Die Zeit bleibt stehen.
Die Welt rund um die Besuchergruppe wird zur Ewigkeit, alles wirkt wie eingefroren. Nur unsere Besuchergruppe bleibt von den Auswirkungen verschont und kann sich weiter bewegen. Auf die Verwirrung erfolgt schon bald die Ernüchterung. Der Stillstand der Welt ist kein vorrübergehender. Auch am nächsten Tag, in der nächsten Woche, im nächsten Monat hält dieser Zustand an. Fünf Jahre verbringt die Gruppe der „Chronofizierten“ in der Mittagshitze des ewigen 14. August 2000, bevor die Welt sich für magische drei Sekunden weiterdreht, um dann wieder wie erstarrt anzuhalten.
Die Jahre vergehen, die Wissenschaftler des CERN suchen nach einem Grund für den temporalen Kollaps, versuchen zu verstehen und rückgängig zu machen, was die Welt ins Stocken brachte. Derweil richten sich die übrigen Mitglieder der Gruppe ein, lernen mit Stille und Einsamkeit umzugehen. Menschen sterben, Kinder werden geboren. Die „Chronofizierten“ lernen mit der Macht und Ohnmacht der Situation umzugehen. Doch dann sorgt eine Reihe von Mordanschlägen für Unruhe und Seuchen kommen auf …
Der Stillstand der Zeit, das Gefangensein in einer eingefrorenen Wirklichkeit und die Suche nach einem Ausweg, das ist eine für sich genommen faszinierende Vorstellung. Man stelle sich vor, die Zeit würde wirklich, zumindest für einen Moment, still stehen. Alles wäre in der Bewegung eingefroren, alle Menschen in einer Art Wachkoma gefangen, nur man selbst könnte sich durch die Welt bewegen und sie anfassen – als würde man durch eine Fotografie wandeln.
Dass bei Thomas Lehr dieser Zustand obendrein über mehrere Jahre anhält, wirft neben der wissenschaftlichen Begreifbarkeit einige weitere interessante Fragen auf, die sich vor allem auch auf sozialer Ebene stellen. Wie gehen die Bewegungsfähigen mit ihrem Schicksal in einer bewegungsunfähigen Welt um? Wie arrangieren sie sich mit ihrer komatös erstarrten Umwelt? Wie entwickeln sie sich als Gruppe? Und wie fühlt man sich, wenn nach fünf Jahren der lange herbeigesehnte Ruck einsetzt, der die Welt wieder in Gang setzt, nur um drei Sekunden später wieder alles anzuhalten? Es sind die wissenschaftlichen und sozialen Fragen, die das Ereignis aufwirft, die „42“ so faszinierend machen. Zumindest, solange man sich nur mit dem grundlegenden Ereignis und dem Klappentext befasst.
Lehr erzählt die Geschichte aus der Sicht des Journalisten Adrian, der einerseits die Versuche der Wissenschaftler beobachtet, die Zeitpanne rückgängig zu machen, und andererseits auch seine eigenen Wege durch die im Dornröschenschlaf liegende Welt geht. Ganz wissenschaftlich erzählt er den Werdegang der Gruppe und den Verlauf der Ereignisse anhand von fünf Phasen, die die Gruppe durchlebt:
|“1. Schock
2. Orientierung
3. Missbrauch
4. Depression
5. Fanatismus“| (S. 18)
Diese Phasen bestimmen ganz wesentlich die Entwicklung der Gruppe auf sozialer Ebene und zeichnen den Handlungsverlauf vor.
Ein großer Teil der Faszination des Ereignisses verliert sich aber leider schon nach wenigen Seiten. Die aufgeworfenen Fragen beschäftigen uns als Leser weiterhin, doch die Art, wie Lehr den Leser mit seinen Figuren, dem temporalen Kollaps und der daraus resultierenden Handlung konfrontiert, dürfte so manchen Interessierten ziemlich vor den Kopf stoßen. Lehr macht es dem Leser alles andere als leicht, in die Handlung einzusteigen und seinen Schilderungen zu folgen.
Ich persönlich war schon gleichermaßen erstaunt und verwirrt, als ich den Anfang des Buches, für den Lehr bereits 2002 mit dem Georg-K.-Glaser-Preis ausgezeichnet wurde, hinter mich gebracht hatte. So richtig begreifen konnte ich nicht, was Lehr dort schildert. Vieles ergibt erst wesentlich später Sinn, denn im Grunde wirft Lehr dem Leser die Puzzleteile zum Verständnis nur bröckchenweise hin. Der Klappentext lobt „42“ gerade auch wegen der |“funkelnden und souveränen Sprache“|. Aus meiner persönlichen Sicht wirkt das schon fast ironisch, denn für mich ist gerade die Sprache die größte Barriere zwischen Leser und Autor – eine Barriere, an der so mancher Leser scheitern dürfte.
Die ganze Geschichte wirkt wie durch eine halbtransparente Gardine betrachtet. Der Leser steht draußen vor dem Fenster und versucht einen Blick auf die drinnen sich im Licht bewegenden Figuren zu erhaschen. Schattenhafte Schemen lassen sich erkennen, Bewegungen und Aktivitäten erahnen, aber so sehr man sich die Nase auch an der Fensterscheibe platt drücken mag, die Gardine schluckt sämtliche Blicke und die Handlungen bleiben diffus. Diese halbtransparente Gardine ist Lehrs |“funkelnde und souveräne Sprache“|.
Er wirft mit Fremdwörtern um sich, konstruiert verschachtelte Sätze, die in der Literaturgeschichte ihresgleichen suchen und sich auch schon mal über Zweidrittel der Seite erstrecken, um an anderer Stelle dann mit unvollständigen Dreiwortsätzen daherzukommen. Obendrein verwirrt er den Leser mit seiner abstrakten Symbolik. Manche Passagen muss man zwei- oder dreimal lesen, nur um sie dann immer noch nicht so ganz verstanden zu haben.
Es wirkt so, als wäre es Lehr gar nicht so wichtig, ob der Leser ihn versteht oder nicht. Er scheint in irgendeiner abgehobenen Sphäre sprachlicher Selbstverliebtheit seinem Ego zu frönen. Und so kann man es eigentlich keinem Leser verübeln, wenn er das Buch nach wenigen Kapiteln bereits entnervt aus der Hand legt. Lehr verlangt dem Leser enorm viel ab, sowohl mit seinen sprachlichen Mitteln und dem verwirrenden, ironischerweise in der Zeit sprunghaften Erzählstil, als auch mit den vielen unverständlichen Begriffen, für die er nicht einmal ein Glossar anhängt. Während der Lektüre hin und wieder den Fremdwörterduden zu konsultieren, ist also durchaus ratsam.
Was den potenziellen Leser sprachlich erwartet, sei an einem Beispiel verdeutlicht: |“Dass ich für Karins Aufenthalt die gesamte deutsche Ostseeküste in Erwägung ziehen musste, gab ich den anderen preis, nicht aber – und wie auch? -, dass ich ein zerrissener Mann war, verschlagen auf die calvinistische Insel der Zeitschiffbrüchigen mitsamt einem befreundeten Arbeitskollegen und dessen Frau, die ich wenige Wochen zuvor in einem Fotolabor aus beruflichen Gründen aufgesucht und unversehens geküsst hatte in einem diffus glättenden, plötzlich mitleidlosen und pornografischen Rotlicht, das uns die Geschlechtsorgane freilegen ließ und hastig bearbeiten, für beide Seiten wohl erschreckend professionell, wie routinierte Lustnotfallhelfer, die vor nichts zurückschrecken dürfen (das aus der Hülle gleitende stumpfe Skalpell, der Tränengeschmack deiner klaffenden violetten Wunde, später, auf meinen Fingerkuppen) und keine Zeit zu verlieren zu haben, zu Recht, denn wir hatten nur wenige Minuten, bevor Annas Handy uns zur Vernunft brachte oder zur Feigheit bis auf den heutigen Tag, an dem uns kein elektrisches Klingeln mehr aufschrecken kann und nichts an Zeit mehr zu versickern oder wegzudriften scheint, wenigstens in dem enormen räumlichen Außerhalb jenseits unserer Körper.“| (S. 102/103) Das war in der Tat nur ein einziger Satz …
Lehrs sprachliche Mittel erschaffen in jedem Fall eine Distanz zum Leser. Man tut sich nicht nur schwer, die Handlung nachzuvollziehen, auch die Figuren rund um die Hauptfigur Adrian bleiben einem seltsam fremd, fast schon gleichgültig. Man fiebert nicht mit, staunt höchstens über die Welt, durch die die Protagonisten wandeln. In manchen Momenten kommt man nicht umhin, Lehrs Umschreibungen der eingefrorenen Welt als treffend zu bezeichnen. In Momenten, in denen man ihm folgen kann, geht von seinen Worten in der Tat eine gewisse Sprachgewalt aus. Doch das sind eher seltene Glanzpunkte in einem ansonsten oft fast hoffnungslos verworrenen Erzählstil.
Auch der Spannungsbogen hat darunter zu leiden. Ist es erst noch die Betrachtung der Menschen, die teils auf wirklich groteske Weise erstarrt sind, die den Leser fasziniert, so verliert sich dieser Effekt mit der Zeit und die Handlung dahinter tut sich etwas schwer damit, in Fahrt zu kommen. So wenig, wie der Leser anfangs in die Handlung eintauchen kann, so wenig wird er auch durch einen spannenden Handlungsverlauf bei der Stange gehalten.
Das ist alles sehr bedauerlich, in Anbetracht eines preisgekrönten Autors, eines prämierten ersten Kapitels und eines immerhin für den Deutschen Buchpreis 2005 nominierten Romans. „42“ ist in jedem Fall ein Paradebeispiel dafür, wie Lesereindruck und hochrangige Literaturkritik in ihrer Einschätzung divergieren können.
„42“ dürfte die Meinungen sehr stark spalten, denn entweder man bewegt sich als Leser in der gleichen Sphäre wie der Autor und kann ihm folgen, oder man findet erst gar keinen Zugang zu seinem Werk. Hier scheint es nur diese beiden Extreme zu geben (wie beispielsweise auch ein Blick auf die Kundenrezensionen bei Amazon.de offenbart) und in meinem Fall ist bedauerlicherweise das Letztgenannte zutreffend. Schade, denn das gesamte Szenario ist für sich genommen außerordentlichen vielversprechend.
[Verlagsseite zum Buch]http://www.aufbauverlag.de/index.php4?page=28&show=5326
Gilbert, David – Normalen, Die
Wenn man sich anschaut, mit wem die englischsprachige Presse David Gilbert nach seinem Debütroman „Die Normalen“ so alles in eine Schublade gestopft hat, dann fallen eine Menge großer Namen: Douglas Coupland, Bret Easton Ellis, T.C. Boyle, Don Delillo und noch einige andere mehr. Coupland selbst ist ein erklärter Fan von Gilbert, und Gilbert höchstselbst wurde die Ehre zuteil, für Don Delillos „Endzone“ das Drehbuch zu schreiben. Gilbert ist also ein Autor, der schon mit Erscheinen seines Debütromans für Furore sorgt und auch von den Kollegen seiner Zunft Respekt erntet. Grund genug, David Gilberts vielgepriesenen Debütroman einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Hauptfigur der Geschichte ist Billy Schine. Billy treibt ziellos durchs Leben. Er hat einen brillanten Harvard-Abschluss, ohne jemals etwas daraus gemacht zu haben. Er sitzt seine Zeit mehr oder weniger leidenschaftslos in einer Zeitarbeitsfirma ab, in einem Job, für den er hoffnungslos überqualifiziert ist. Das Verhältnis zu seiner Freundin Sally dümpelt ähnlich antriebslos vor sich hin. Obendrein ist Billy noch hochverschuldet, weil er sich mit seinem Harvard-Studium finanziell verhoben hat.
Billy entzieht sich gerne der Welt, bleibt gerne in den eigenen vier Wände und macht, wenn es um Krankheiten geht, aus einer Fliege einen Elefanten. Er liebt das Kranksein und die Bettruhe, aber natürlich nur, weil er sich bester Gesundheit erfreut und noch nie wirklich ernsthaft krank war. Doch Billys Leben kann nicht ewig so unmotiviert vor sich hin plätschern. Das merkt Billy, als die Geldeintreiber Ragnar & Sons einen zunehmend raueren Ton anschlagen und Billy in seiner Phantasie deren Schlägertrupp schon vor seiner Wohnungstür sieht.
Doch dann bietet sich Billy eine fantastische Gelegenheit, für einige Zeit abzutauchen. Er meldet sich beim Pharmakonzern Hargrove Anderson Medical als freiwillige Versuchsperson für einen Medikamententest. Zwei Wochen in einem hochgesicherten Medizinlabor mit Unterkunft, Vollverpflegung und 2.000,- Dollar Vergütung. Da lässt Billy sich gerne mal für vierzehn Tage mit einem atypischen Psychopharmakon zur Behandlung von Schizophrenie voll pumpen.
Wie Billy schon bald feststellt, ist er nicht der Einzige, der in der Klinik dem wirklichen Leben aus dem Weg zu gehen versucht. Was Billy in diesen vierzehn Tagen erlebt, ist sowohl schräg als auch absonderlich, tragikomisch und erschütternd …
Mit „Die Normalen“ ist David Gilbert ein wirklich erfrischender Debütroman geglückt, der bei Freunden moderner amerikanischer Literatur noch einigen Zuspruch finden dürfte. So leidenschaftslos Billy auf den Leser auch wirken mag, das bunte Treiben, das Gilbert anhand seiner Hauptfigur in den abgeriegelten Trakten der Versuchsklinik beschreibt, hält für den Leser so einiges bereit und ist durchaus mitreißend erzählt. Es ist sowohl die komische Seite des Lebens, die sich hier offenbart, als auch die tragische.
Es sind einige faszinierende Widersprüchlichkeiten des Lebens, die mit Billys Betreten der Versuchsklinik zutage treten. Auf der einen Seite ist seine Teilnahme an der Studie ein Versuch, sich dem Leben zu entziehen, auf der anderer Seite fordert er es auf provokante Art heraus. Einerseits zeigt er mit dem Verlassen seiner verfahrenen Lebenssituation den Ehrgeiz, sein Leben neu zu ordnen, andererseits setzt er sich mit seiner Teilnahme am Medikamententest in ebenso großem Maße einer gesundheitlichen Gefahr aus. Für Billy, den Hypochonder, ist der Klinikaufenthalt gleichzeitig eine Erfahrung, die er auf seine Art genießen kann. Er kann krank feiern, ohne krank zu sein.
Hinter den Türen trifft Billy auf eine ganze Reihe skurriler Figuren, die in erheblichem Maße zum Unterhaltungswert des Romans beitragen. Da wäre Lannigan, der überdrehte Schauspieler und Zimmergenosse von Billy, da wäre Do, der eigentümliche Hinterwäldler, die beiden aggressiven Cousins Ossap und Dullick, der abgehalfterte Trinker Rodney, der merkwürdige Frank, für den Schusswunden der größte Kick sind, und nicht zuletzt die geheimnisvolle Gretchen, die als einzige Frau in der Männerrunde stets faszinierend für Billy bleibt und zu der er ein ganz besonderes Verhältnis hegt.
Gilbert nutzt die Abgeschiedenheit seiner Hauptfigur vom Rest der Welt obendrein zu einem Blick auf die Gesellschaft insgesamt. Billys Nabel zur Welt ist der Fernseher, über den er an all dem teilhaben kann, was die Nation bewegt. Insbesondere das Spektakel und der Massenkult um einen Gehirntumorpatienten, dessen Gehirnscan dem Grabtuch von Turin ähnelt, wird stetig verfolgt und treibt immer absurdere Blüten. Gilbert erzählt seine Geschichte mit einem Blick für die Absurditäten der heutigen Gesellschaft und würzt sie mit einer großen Prise Ironie. Billy bleibt der stetige Beobachter, den kaum ein Ereignis aus seiner Lethargie zu reißen vermag. Das lässt das Absurde noch absurder erscheinen.
Die Versuchsreihe, an der Billy teilnimmt, das ganze Versuchsprozedere, das ständige Rätseln darüber, wer ein Placebo verabreicht bekommet und wer das wirkliche Medikament, das ständige Lauern auf Nebenwirkungen bei sich und anderen Probanden, dominiert die Schilderungen über das Leben in der Klinik. Billy erduldet all das weitestgehend teilnahmslos. Während um ihn herum so langsam alle verrückt zu werden scheinen, wirkt Billy wie ein ruhender, gleichgültiger Polt der Beständigkeit. Als solcher, herausgelöst aus Familie, Leben und Gesellschaft, eignet er sich hervorragend für Gilberts gesellschaftliche Betrachtungen und ironische Seitenhiebe.
Die Konstruktion der Geschichte ist gut durchdacht und geht voll und ganz auf, was den Roman besonders reizvoll macht. Nachdem sich der Leser an der Skurrilität der Welt der Versuchsklinik und der Testperson ergötzt hat, mischt Gilbert eine zunehmend tragische Komponente in die Geschichte. Billy versucht mit seinem Aufenthalt, der Welt und seinem Leben zu entrinnen, aber das Leben, das er draußen zurückzulassen glaubt, holt ihn schließlich ein und nimmt eine durchaus tragische und gleichsam glaubwürdige Wendung.
Zusammen mit Gilberts bravouröser und erfrischender Erzählart ergibt diese wohl überlegte Konstruktion der Geschichte einen wirklich stimmigen Roman. Gilberts Beschreibungen treffen den Nagel auf den Kopf und individuelle, absolut treffende Wortschöpfungen sind das Sahnehäubchen, mit dem Gilbert seine augenzwinkernde Erzählweise garniert.
Gilbert überzeichnet immer wieder, insbesondere bei der Beschreibung seiner teils grotesken Figuren innerhalb der Klinik, ohne dass diese Überzeichnung zu einem Makel wird. Die ganze Situation des Medikamententests, der ganze Alltag der Versuchskaninchen ist schließlich für sich genommen absurd genug, um diese Überzeichnung tragen zu können, und da die Schilderung nicht ins Lächerliche abdriftet, trägt sie obendrein erheblich zum Unterhaltungswert des Romans bei.
Bleibt unterm Strich festzuhalten, dass David Gilbert mit „Die Normalen“ einen absolut lesenswerten Debütroman abgeliefert hat. Sein Stil ist flott und erfrischend, seine Schilderung gleichsam komisch wie tragisch. Gilbert hat einen Roman geschaffen, der trotz der Kuriosität seiner Handlung auch einen treffenden Blick auf Leben und Gesellschaft wirft. „Die Normalen“ dürfte all diejenigen erfreuen, die auch Douglas Coupland, T.C. Boyle und Jeffrey Eugenides schon mit Begeisterung gelesen haben.
Wolfe, Tom – Ich bin Charlotte Simmons
Gerne wird Tom Wolfe als Amerikas „Mr. Zeitgeist“ tituliert. Ein Autor, der seinen Finger in die Wunden der heutigen Gesellschaft legt, der die gesellschaftlichen Strömungen auseinander nimmt und dadurch tiefere Einblicke vermittelt. Genau das will er auch mit seinem neuesten Roman „Ich bin Charlotte Simmons“ wieder erreicht haben. Ein Buch, das schon seinem äußeren Anschein nach den Eindruck vermittelt, dass Wolfe durchaus ein literarisches Schwergewicht ist – und das nicht nur, weil der Schmöker ein stolzes Kilo auf die Waage bringt.
Charlotte Simmons ist jung, beneidenswert intelligent und der Stolz von Lehrerschaft und Eltern. Sie schafft mittels Stipendium den Sprung aus einem kleinen 900-Seelen-Kaff in den Bergen North Carolinas an die traditionsreiche Elite-Uni Dupont in Pennsylvania. Für Charlotte geht damit ein Traum in Erfüllung. Endlich findet sie die richtige Heimstatt für ihren überragenden Intellekt. Sie wird auf den Olymp des Wissens ziehen, um mit unzähligen Gleichgesinnten Wissenschaft, Kultur und Bildung zu frönen.
Doch kaum hat das Provinzmädchen sein Studium angetreten, wird es auch schon von der grausamen Realität eingeholt. Der erhoffte Olymp des Wissens entpuppt sich als Paradies der Stumpfsinnigen, die Sex und Alkohol „studieren“. Charlotte ist entsetzt. Hier bringen nicht gute Noten Ansehen und Respekt, sondern nur die angesagtesten Klamotten, ungehemmter Alkoholkonsum bis zur Besinnungslosigkeit und sexuelle Freigiebigkeit. Charlotte, im so genannten „Bible-Belt“ aufgewachsenen und religiös erzogen, ist selbstverständlich noch Jungfrau und würde niemals auf die Idee kommen, Alkohol zu trinken.
Doch auch das Mauerblümchen Charlotte bleibt zu ihrem eigenen Entsetzen vor den Avancen männlicher Studenten nicht verschont, und so sieht sie sich schon nach wenigen Wochen von drei Verehrern umgarnt: Hoyt, dem coolsten Typen auf dem Campus, Jojo, dem weißen Star der Basketballmannschaft, und Adam, der sich für den letzten Intellektuellen am Campus hält. Charlotte entscheidet sich für den Falschen und braucht lange, um sich von der daraus resultierenden Depression zu erholen …
Der Plot klingt zunächst sehr vielversprechend. Wolfe verspricht schonungslos die vorherrschende Jugendkultur zu demaskieren und ganz nebenbei noch mit dem aktuell in Amerika schwelenden Kulturkampf zwischen dem Konservativismus des Mittleren Westens und dem Liberalismus von Ost- und Westküste abzurechnen. Damit packt Wolfe wieder mal ein heißes Eisen an und wird seinem Ruf als „Mr. Zeitgeist“ gerecht.
Wolfe, dessen Wurzeln im Journalismus liegen und der in den Sechzigern zu den Begründern des sogenannten „New Journalism“ gehörte, der den vorherrschenden Reportagestil mit literarischen Stilelementen versetze, scheint hier einen Themenkomplex gefunden zu haben, der genau nach seinem Geschmack ist. Allein optisch könnte der Kontrast zwischen dem Autor und seinen Figuren kaum größer sein: cremefarbene Maßanzüge gegen Schlabberhosen und schief sitzende Baselballkappen.
Der Stoff, der „Ich bin Charlotte Simmons“ zugrunde liegt, bietet in jedem Fall eine Menge Potenzial für eine gleichsam kritische wie auch provokante und ironische Betrachtung. Die ersten Kapitel scheinen dann auch diesen Eindruck zu bestätigen. Wolfe betrachtet zunächst Charlotte in der Provinz und vor allem die Distanz, die dort zwischen Charlotte und ihren Mitschülern herrscht: die Intelligente und der Provinz-Pöbel.
Schon Charlottes Umzug an den Campus von Dupont offenbart ganz neue Gegensätzlichkeiten. Charlotte tritt in eine völlig neue, völlig fremde Welt ein. Schon in ihrem Zimmer trifft sie auf einen Gegensatz, der größer kaum sein könnte. Zimmergenossin Beverly ist all das, was Charlotte nicht ist: reich, weltmännisch, attraktiv, ständig umworben, mit allem neumodischem Schnick-Schnack ausgerüstet und beliebt. Wie Wolfe diese beiden gegensätzlichen Charaktere und ihre Familien aufeinander prallen lässt, wie die Handelnden miteinander umgehen, das macht die ersten Kapitel durchaus zu einem gewissen Lesevergnügen.
Wolfe beobachtet des bunte Treiben am Campus von Dupont mit geradezu pedantischer Genauigkeit und mit einer Detailbesessenheit, die manchmal schon an die Grenze des Vertretbaren stößt. Seitenweise widmet er sich der Dynamik eines einfachen Basketball-Trainingsspiels. Haarklein nimmt er jede Bewegung der Spieler auseinander, seziert ihr Innerstes und beweist damit, dass er sich auf genaues Schildern versteht und dass er dem Leser damit tiefe Einblicke ermöglichen kann.
Dennoch hat man manchmal das Gefühl, er würde in seiner Pedanterie ein wenig über das Ziel hinausschießen. Viele Szenen wiederholen sich, bestimmte Themen werden immer wieder ausführlichst durchgekaut, wie z. B. die Verwunderung der Intellektuellen über die Sportbegeisterung der Mitstudenten. Manchmal hat man dabei das Gefühl, dass Wolfe irgendwie immer seinen eigenen Intellekt heraushängen lässt. Unzählige Beschreibungen durchtrainierter Basketballerkörper, in denen immer wieder alle möglichen Muskelpartien einzeln benannt werden. Ist ja schön, dass Tom Wolfe so gut Bescheid weiß, aber manchmal täte er gut daran, das nicht immer krampfhaft in die Geschichte einbinden zu wollen, um die Handlung mit einem etwas dynamischeren Erzählfluss zu versehen.
Die Thematik an sich bietet Stoff für jede Menge provokanten Witz, für die Ironie der Gegensätzlichkeiten des Alltags, aber durch Wolfes übertriebene Genauigkeit in seinen Schilderungen gerät der Erzählfluss mitunter ein wenig zäh. Seine genauen Beschreibungen mögen noch so meisterhaft sein, sein Blick mag noch so gnadenlos die Mechanismen des Campusgeschehens sezieren, irgendwie fehlt dem Ganzen in letzter Instanz dann doch der gewisse Biss. Etwas schnellere Schnitte und eine etwas flottere Gangart hätten sicherlich Wunder gewirkt und dem Roman seine teilweise kaum zu leugnende Langatmigkeit genommen.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Figuren. Wolfe wechselt immer wieder die Perspektive, schlüpft mal in die Rollen der drei Charlotte-Verehrer Hoyt, Jojo und Adam und erzählt dann wieder aus Charlottes Sicht. Alle vier Hauptfiguren wirken wie wandelnde Klischees: Hoyt, der Aufreißer, Jojo, der „Anabolika-Trottel“, Adam, der intellektuelle Streber und Charlotte, das Mauerblümchen und naive Landei. Eine Entwicklung lässt sich an den Hauptfiguren nur zum Teil und dann auch nur in Ansätzen ablesen, die meisten bleiben stumpfe Stereotypen.
Ein weiteres Problem bringt die Figur der Charlotte mit sich. Man mag ihr das Entsetzen über die ach so grausame, freizügige Realität des Campuslebens nicht so recht abkaufen. Wie weltfremd muss ein Mensch sein, um beim Anblick Tanzender auf einer Party schockiert festzustellen, dass auf der Tanzfläche quasi Geschlechtsverkehr simuliert wird? Auch die Simmons haben zu Hause schließlich einen Fernseher. Wie kann eine Charlotte also entsetzt sein, wenn jemand „Scheiße“ oder „Fuck“ sagt? Man wird das Gefühl nicht los, dass in Charlottes Kopf ein alter Mann hockt, der ihr das schockierte Entsetzen souffliert. Und dieser alte Mann kann dann eigentlich nur Tom Wolfe sein, der ja schließlich auch schon jenseits der Siebzig ist.
Diese Diskrepanz zwischen der konservativen Hauptfigur und der liberalen Realität mag vielleicht den aktuell in den USA tobenden Kulturkampf karikieren, aber ihn anhand einer Charlotte Simmons in dieser Form zu vollziehen, nimmt ihm ein wenig von der provokanten unterschwelligen Kritik. Und so wirkt das Ganze mehr wie der mahnende Zeigefinger der Großeltern, die über den Verfall von Kultur und Sittsamkeit der Jugend besorgt sind. Der Roman selbst verliert so einiges von seiner Schärfe.
Bleibt zusammenfassend ein etwas durchwachsener Eindruck im Gedächtnis. Tom Wolfe weiß mit Worten umzugehen, besitzt eine außerordentlich genaue Beobachtungsgabe und versteht sich darauf, das gesellschaftliche Leben messerscharf zu sezieren. Dennoch wird die Freude an „Ich bin Charlotte Simmons“ auch durch einige Schwächen getrübt. Stellenweise wirkt der Roman ein wenig langatmig, die Figuren sind wandelnde Klischees und bleiben auch am Ende nur als Stereotype in Erinnerung, und Wolfes „schonungsloses Demaskieren der Jugendkultur“ wirkt aufgrund der übergroßen Portion Naivität einer Charlotte Simmons nicht immer ganz glaubwürdig und bissig genug.