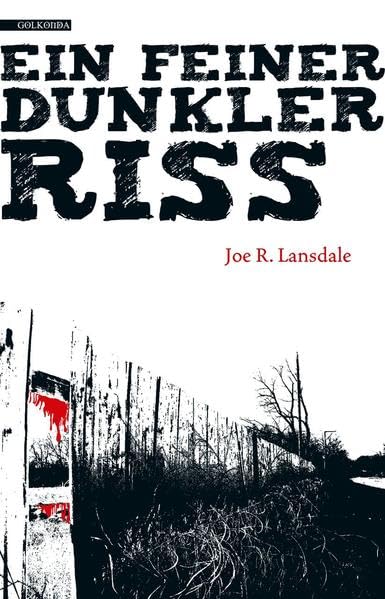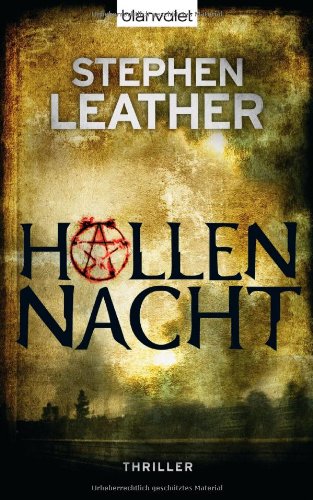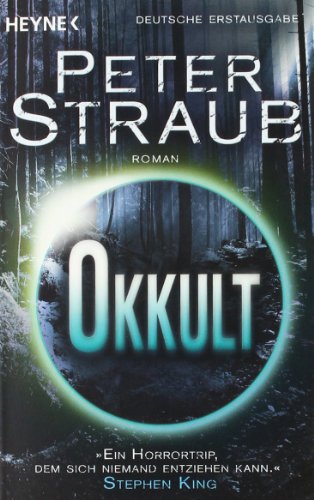King’s Abbot ist ein Dorf irgendwo in Südengland. Auf den ersten Blick ist die Zeit hier stehengeblieben; es geht beschaulich zu, die große Welt ist weit entfernt, Neuigkeiten bestehen aus Klatsch & Tratsch, der sich meist auf die zahlenarme örtliche Prominenz konzentriert. Diese beschränkt sich auf die Familien Ferrars und Ackroyd, die auf King’s Paddock bzw. auf Fernly Park residieren. Bisher stand Mrs. Ferrars im Zentrum des Dorfgeredes; sie gilt als Mörderin ihres Gatten, der vor einem Jahr recht unerwartet starb. Die Polizei sah keinen Grund zum Eingreifen, zumal Hausarzt Dr. James Sheppard einen natürlichen Tod bescheinigte. Nun starb auch Mrs. Ferrars – der Selbstmord einer von Reue zerfressenen Frau, wird in King’s Abbot gemunkelt. Agatha Christie – Alibi weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Joe R. Lansdale – Ein feiner dunkler Riss
13 Jahre ist Stanley jung, als die Familie Mitchel – Vater Stanley, Mutter Gal und Schwester Caldonia, frühreife 16 – in die kleine Stadt Dewmont im US-Staat Texas ziehen. Dort übernimmt der Senior das örtliche Autokino; ein Geschäft, das gut läuft, denn wir schreiben das Jahr 1958.
Allmählich lebt die Familie sich ein. Beim neugierigen Streifzug durch die Wälder der Umgebung stoßen Stanley Junior und Caldonia auf die Ruinen eines Hauses. Hier ging vierzehn Jahre zuvor die Villa der Stilwinds, der ersten Familie des Ortes, in Flammen auf; dabei starb die Tochter Juwel Ellen. Die Tragödie blieb der Bevölkerung auch deshalb im Gedächtnis, weil man in derselben Nacht die junge Margret Wood vergewaltigt und kopflos auf dem Bahngleis fand; der Täter wurde niemals ermittelt. Seitdem spuke Margrets Geist an der Mordstätte umher, heißt es. Joe R. Lansdale – Ein feiner dunkler Riss weiterlesen
Cyril Hare – Selbstmord ausgeschlossen
Als der alte Leonard Dickinson sein Leben aufgrund einer allzu großzügig bemessenen Schlafmittel-Dosis im ländlich ruhigen Pendlebury Old Hall Hotel aushaucht, ist als Urlaubsgast und Zeuge zufällig Inspektor Mallet von Scotland Yard vor Ort. Er hatte Dickinson am Vorabend als schwermütigen Mann kennengelernt, was er auch zu Protokoll gibt. Da es keine verdächtigen Indizien gibt, wird der Fall als Selbstmord zu den Akten genommen.
Diese Nachricht sorgt bei den Hinterbliebenen für Aufregung. Gattin Eleanor, Sohn Stephen und Tochter Anne sind für ihren Lebensunterhalt auf das Erbe angewiesen. Leonard hinterließ zwar eine Lebensversicherung in Höhe von 25.000 Pfund, die jedoch bei Selbstmord des Versicherten nicht ausgezahlt wird.
Leather, Stephen – Höllennacht
_Das geschieht:_
Jack Nightingale war Mitglied einer Elite-Einsatztruppe der Polizei, bis er in einem Anfall von Selbstjustiz einen besonders üblen Strolch richtete. Er musste seinen Abschied nehmen und schlägt sich nun als Privatdetektiv in London durch. Das Geschäft läuft genretypisch schlecht, weshalb Nightingale zwar misstrauisch aber auch erfreut ist, als sich ein Anwalt bei ihm meldet: Sein Vater habe ihm Gosling Manor, einen Landsitz in der Grafschaft Surrey, hinterlassen.
In der Tat war der nach einem selbst abgefeuerten Schrotschuss in den Schädel verstorbene Ainsley Gosling Nightingales leiblicher aber miserabler Vater. Dass er adoptiert war, wusste der Detektiv bisher nicht. Dafür hatte Gosling Sorge getragen, wie er in einer Videoaufnahme gesteht, denn für Geld und Macht habe er nicht seine, sondern die Seele seines Sohnes an einen Teufel verkauft. Drei Jahrzehnte konnte Gosling schwelgen, doch im Alter begann ihn die Reue zu plagen. Der Teufel gedenkt allerdings nicht, von dem Geschäft zurückzutreten. An seinem 33. Geburtstag werde er ihn holen, warnt Gosling Jack vor. Bis dahin sind es nur noch drei Wochen.
Der rational denkende Nightingale hält seinen Vater für verrückt. Allerdings stellt er bei der Besichtigung von Gosling Manor fest, dass Gosling ein Satanist gewesen sein muss. Im Keller des Anwesens lagern sowohl verbotene Bücher als auch hässliche Artefakte, die darauf hindeuten, dass auf Gosling Manor manche Teufelsbeschwörung stattfand.
Je weiter sich sein Geburtstag nähert, desto stärker beunruhigen Nightingale seltsame Vor- und ‚Zufälle‘. Mehrfach weisen ihn wie hypnotisiert wirkende Zeitgenossen auf die bevorstehende Höllenfahrt hin. Schlimmer ist jedoch eine Kette von Todesfällen, die Jacks ohnehin kleinen Freundeskreis stetig schrumpfen lässt. Der Detektiv beginnt sich zu fragen, ob an der Sache mit dem Seelenverkauf doch etwas dran ist, denn in diesem Fall gälte es allmählich Gegenmaßnahmen zu treffen …
|Noch ein „Urban-Fantasy“-Detektiv|
Oh ja, es dauert, bis Jack Nightingale endlich dämmert, was jeder Leser längst weiß. Das Publikum wird sogar ein wenig ungeduldig, weil Autor Leather seine Geschichte sichtlich zieht; schließlich ist er ein Profi, der jährlich mindestens zwei volumenstarke Romane auf den Buchmarkt wirft! Da geht Länge allemal vor Handlungsdichte.
Außerdem denkt Leather an die Zukunft. Auf seiner bemerkenswerten, weil über Leben und Werk nicht nur ungewöhnlich ausführlich Auskunft gebenden, sondern auch sehr aktuellen Website macht der Autor keinen Hehl daraus, dass er „Höllennacht“ wie die meisten seiner Werke mit dem Start einer lukrativen Serie im Hinterkopf kreierte. Dieser Plan ist aufgegangen; Leather produziert seit 2010 mindestens einen „Jack Nighingale“-Roman pro Jahr, wie er nicht nur angekündigt, sondern bisher auch durchgehalten hat.
Die Weichen für einen Erfolg standen günstig, weil Leather zu den Autoren gehört, die gezielt für einen möglichst großen Markt schreiben. Seine Geschichten sind stromlinienförmig, eingängig und flott; sie bieten, was die Leser in ihrer Mehrheit erwarten. Dies bekommen sie, mehr aber nicht: routinierte Unterhaltung, die nicht grundlos vor dem geistigen Auge Bilder flimmern lässt – Leather arbeitet auch für das Fernsehen.
|Die Kraft des gut Bekannten|
Das über Autor und Werk Gesagte sollte man übrigens neutral gestimmt zur Kenntnis nehmen: Auch für den schnellen Konsum gedachte Unterhaltung darf gern spannend sein. Dass Leather sich zeitsparend an die Konventionen & Klischees des Genres hält, ist kein Grund, sich den Lektürespaß verderben zu lassen. Nimmt die Handlung erst einmal Fahrt auf, lässt man sich gern in ihren Bann ziehen, auch wenn die dabei eingesetzten Tricks oft allzu deutlich als solche zu erkennen sind.
Leather weiß, wie man die Begegnung zwischen Detektiv und Teufel wirkungsvoll inszeniert. Der eine ist quasi die Verkörperung der professionellen Ratio, während der andere tief im menschlichen Unterbewusstsein wurzelt und dort für Unbehagen sorgt. Im 21. Jahrhundert ist der Glaube an ‚echte‘ Teufel, die in der Hölle hocken und bei Ausflügen in die Menschenwelt nach Seelen fischen, unter einer Schicht aus ‚wissenschaftlich‘ begründeter Sicherheit begraben. Darunter lauern weiter Aberglauben und alte Ängste, die nicht nur Stephen Leather, sondern ganzen Legionen von Schriftstellern und Drehbuchautoren ihr Auskommen sichern.
|Unglaube schützt vor Teufelsspuk nicht|
Die reizvolle Kombination von Detektiv und Geisterwelt geht nicht auf Leather zurück. Auch hier greift er routiniert auf, was sich – Stichwort „Harry Dresden“ – an anderer Stelle auf dem Buchmarkt bewährt hat. Leather setzt dabei früher ein; vor der Konfrontation mit den Bewohnern des Jenseits‘ steht bei ihm das Ringen um die Akzeptanz ihrer Realität. Jack Nightingale muss vom Saulus zum Paulus werden. Leather zögert die Konfrontation zwischen Jack und dem (übrigens weiblichen) Dämon, der den Schuldschein über seine Seele in den Klauen hält, so weit wie möglich hinaus. „Höllennacht“ ist trotz des martialischen deutschen Titels vor allem die Geschichte einer Spurensuche.
Ein gewisses Problem stellt Leathers Figurenzeichnung dar. Jack Nightingale bleibt flach. Ständig stolpert er über übel zugerichtete Leichen, aber Schrecken und Trauer bleiben reine Behauptungen und werden geschwind abgeschüttelt. Auch der Griff in die Profilkiste bringt nur Beliebiges zutage: Aufgrund deprimierender Erfahrungen, die aus seinen Jahren als Unterhändler und Scharfschütze resultieren, ist Nightingale zum religiös Ungläubigen sowie zum Zyniker geworden, der für das Böse in der Welt allein die Menschen verantwortlich macht.
Als wenig erfolgreicher Detektiv – ein Zustand, der für diesen Berufsstand längst eher Vorschrift als Klischee ist – hat sich Nightingale eine Nische etwas abseits des kollektivgesellschaftlichen Erfolgsstrebens eingerichtet, bis ihn – auch dies folgt dem üblichen Schema – ein unerhörtes Geschehen aus dem Alltagstrott reißt. Nightingale besinnt sich in der Krise alter Berufstugenden, die ihm auch im Umgang mit höllischen Dämonen nützlich werden, denn Leather postuliert ein Universum, in dem sogar die ewige Verdammnis zur Verhandlungssache wird.
|Dämon zu sein ist die Hölle!|
Zum kantenfreien Tenor passt ein simples Höllenbild. Da gibt es Satan selbst, der in der höllischen Hierarchie so weit oben thront, dass er sich in die Geschicke der Menschen nicht einmischt. Er überlässt dies seinen 66 Höllenfürsten, die wiederum über 666 Legionen gebieten, in denen jeweils 666 Soldaten-Teufel dienen. Dieses Konzept macht es möglich, dass sich Mensch und Dämon fast auf Augenhöhe begegnen.
Bis dies geschieht, reiht Leather seltsame Ereignisse episodisch aneinander. Hier könnte er eindeutig raffen, denn die Story tritt auf der Stelle bzw. ergeht sich in Wiederholungen. Von höllischer Allmacht ist wenig zu spüren, als im Finale tatsächlich eine Teufelin erscheint, um Nightingales Seele zu kassieren. Theaterdonner und große Worte erzeugen nur das Abbild einer gnadenlosen Gegnerin, die sich kurz darauf auf einen Deal mit dem Menschlein einlässt: Die Teufelsfrau hat sich an einer anderen Baustelle hereinlegen lassen, weshalb die Höllen-Kollegen sich nun über sie lustig machen und ihr der Chef womöglich seine Gunst entzieht.
Solche jede Raffinesse vermeidenden Einfälle verraten wohl am besten, mit welcher Art von Phantastik wir es hier zu tun haben. Auf diesen kurvenlosen, gut geschmierten Schienen dürfte die „Jack Nightingale“-Serie problemfrei von Station zu Station rollen. Die nächste Haltestelle steht bereits fest: Schließlich hat Jack herausgefunden, dass er eine Schwester hat, deren Seele der Senior einem anderen Teufel verkauft hat. Die muss er nun finden und ebenfalls retten, was unter dem Titel „Midnight“ in England bereits 2011 geschah und sicherlich auch in Deutschland nachgeholt wird, falls dieses erste Abenteuer hierzulande genug Leser findet.
_Autor_
Bevor Stephen Leather, geboren 1956 im britischen Manchester, Schriftsteller wurde, arbeitete er als Journalist und schrieb für Zeitungen im In- und Ausland. Ende der 1980er Jahre verlegte sich Leather auf das Schreiben actionbetonter, das Schwergewicht auf Unterhaltung legender Thriller, die u. a. in den USA, in Irland sowie im Fernen Osten spielten – Länder und Regionen, die Leather nicht nur ausgiebig bereiste, sondern in denen er sich zeitweise ansiedelte, um seine Geschichten in ein möglichst real wirkendes Umfeld einzubetten.
Zu seinen Erfolgen zählt die 2004 gestartete Serie um den Special-Air-Service-Trooper und Undercover-Agenten Dan ‚Spider‘ Shepherd. Verfilmt wurden die Leather-Thriller „The Stretch“ und „The Bombmaker“. 2010 startete Leather die Serie um den Privatdetektiv Jack Nightingale, der sich mit diversen Kreaturen der Hölle u. a. übernatürlichen Unerfreulichkeiten auseinandersetzen muss. Leather schrieb außerdem direkt für das Fernsehen und hier für Infotainment-Serien wie „The Knock“, „London’s Burning“ oder „Murder in Mind“.
|Taschenbuch: 446 Seiten
Originaltitel: Nightfall (London: Hodder & Stoughton 2010)
Übersetzung: Barbara Ostrop
Deutsche Erstausgabe: November 2011 (Blanvalet Verlag/TB Nr. 37814)
ISBN-13: 978-3-442-37814-2
eBook ISBN-13: 978-3-641-06153-1|
http://www.stephenleather.com
http://www.randomhouse.de/blanvalet
Christopher Evans (Hg.) – Die Angst hat tausend Namen

Christopher Evans (Hg.) – Die Angst hat tausend Namen weiterlesen
Tim Curran – Zerfleischt

Tim Curran – Zerfleischt weiterlesen
Loren D. Estleman – Blutiger Herbst

Straub, Peter – Okkult
_Das geschieht:_
Schriftsteller Lee Harwell gehört zu den erfolgreichen Mitgliedern seiner Zunft. Aktuell kreisen seine Gedanken um die eigene Vergangenheit, die womöglich den Stoff für ein neues Buch hergibt: Mitte der 1960er Jahre gehörte Harwell durch seine Freundin locker zu einer Gruppe, die in Madison, einer kleinen Stadt im US-Staat Wisconsin, in einen nie geklärten Kriminalfall verwickelt waren.
Während Lee „Eel“ Truax – besagte Freundin -, Donald „Dilly“ Olson, Jason „Boats“ Boatman, Howard „Hootie“ Bly, Meredith Bright, Keith Hayward und Brett Milstrap den Verführungskünsten des selbsternannten Gurus Spencer Mallon erlagen, glaubte Harwell diesem nie ein Wort; er selbst nahm deshalb nicht an jener ‚bewusstseinserweiternden‘ Geisterbeschwörung teil, die Mallon in einer Oktobernacht des Jahres 1966 auf einer abgelegene Wiese inszenierte. Am nächsten Morgen war Hayward in Stücke gerissen, Mallon und seine Jünger hatten sich in alle Winde zerstreut.
Was sie in dieser Nacht erlebten, beschäftigt die Überlebenden seit Jahrzehnten, denn es prägte oder zerstörte ihre Leben. Hootie Bly ist seitdem geisteskrank, Meredith Bright ihrer Gefühle beraubt, Lee Truax erblindet. Sie hat später Harwell geheiratet, konnte ihm aber nie erzählen, was damals geschah. Jetzt ist sie es, die Harwell mit ihren Leidensgefährten zusammenführt. Heimlich hat Lee den Kontakt stets aufrechterhalten. Ihr Mann soll die Ereignisse von 1966 rekonstruieren.
Harwell macht sich an die Arbeit. Mühsam aber immer deutlicher enthüllt sich ihm eine unglaubliche Wahrheit: Durch einen Zufall gelang es Spencer Mason, jene schützende Membran zu durchdringen, die das umgibt, was „Realität“ genannt wird. Jenseits dieser Grenze existieren Mächte, die dem Menschen bestenfalls gleichgültig gegenüberstehen. Oft sind sie jedoch feindlich gesonnen und lauern auf Dummköpfe wie Mason, die ihnen ohne echte Ahnung von ihrem Tun eine Tür öffnen. Dies geschah 1966, und was dabei auf diese Welt gerufen wurde, nistet noch heute in denen, die ihm damals ausgesetzt waren …
|Kein Grusel von der Stange|
Peter Straub ist ein Autor, der es seinem Publikum nicht leicht macht. Weil er zwei Bücher mit Stephen King geschrieben hat, neigen die Anhänger eines eher handfesten Horrors dazu, auch aus seiner Feder vor allem spannende Geschichten über Geister und Monster zu erwarten. Die liefert er durchaus, aber manchmal erinnert sich Straub daran, dass er einst als ‚richtiger‘ Literat ins Schriftstellerleben startete. Dann geht er in sich, reflektiert über die Phantastik und entwickelt handwerklichen Ehrgeiz.
Das Ergebnis sind Romane wie dieser: sehr interessant, aber anstrengend zu lesen und unterm Strich nicht annähernd so gehaltvoll, wie ihr Verfasser dies geplant haben mag. Man könnte „Okkult“ vorsichtig und zur Ehrenrettung seines Verfassers als Fingerübung bezeichnen, wiese dieses Buch in seiner deutschen Version nicht den stolzen Umfang von 560 Seiten auf.
Im nüchternen Rückblick bleibt erstaunlich wenig Ereignissubstanz im Gedächtnis des Lesers haften. Dies liegt unter anderem daran, dass Straub sich des „Rashomon“-Prinzips bedient und seine Story aus mehreren Blickwinkeln betrachtet bzw. mehrfach – fünfmal, um genau zu sein – erzählt. Darüber hinaus zersplittert er das Geschehen zusätzlich in Fragmente; er springt in der Handlungszeit vor und zurück, arbeitet mit eingeschobenen Mini-Storys, die der Leser entschlüsseln soll, und bleibt auch sonst gern kryptisch.
|Die Rätsel einer Nacht|
Stringenter Horror sieht jedenfalls anders aus. Gelungene Phantastik allerdings auch. Zwar wird deutlich, worauf Straub hinauswill, doch er schafft es nicht, das Gerüst zu verbergen, das er stützend um seine Idee errichtet hat. Immer wieder schimmert es durch und zeigt uns Straub, der nicht nur erzählt, sondern auch ein ehrgeiziges Handwerk verrichtet, was wir aber nicht wissen und vor allem nicht bemerken wollen.
„Okkult“ ist darüber hinaus allzu angestrengt mehrschichtig und hintergründig geraten. Straub ist verliebt in Einfälle, die zur Handlung kaum oder gar nicht beitragen, seine Geschichte mit wenig interessanten bzw. sympathischen Figuren besetzt und vor allem viel zu lang geraten.
Trotzdem macht es einen Heidenspaß, diesen Roman zu lesen: Wo steht geschrieben, dass Lektüre nicht Ansprüche stellen darf? Selbst das allzu offensichtliche Spiel mit literarischen Formen und erzählerischen Chiffren kann einen eigenen Reiz entfalten. „Okkult“ ist trotz des Umfangs ein Buch, das man aufmerksam lesen muss. Straub spickt diese Geschichte mit Hinweisen und Schlüsseln, die der Leser parat haben sollte, wenn er an jene Stellen gelangt, die nur aufgrund ihrer Kenntnis einen Sinn ergeben. In diesem Spiel bleibt Straub, auch wenn er nicht auf der Höhe seiner Möglichkeiten arbeitet, ein Meister.
|Die Realität der Phantastik|
Zudem versteht es Straub, die Ereignisse der mysteriösen Oktobernacht mit einer Bildgewalt zu vermitteln, die sich nicht aus der minutiösen Schilderung von Details, sondern gerade aufgrund der fragmentarischen Überlieferung speist: In dieser Nacht geschah tatsächlich Unfassbares in einem Sinn, der sich nur annähernd in Worte fassen lässt. Straub versucht, der ‚jenseitigen‘ Welt ihre Fremdheit zu bewahren. Das klingt seltsam, wird aber verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wie simpel das Grauen gemeinhin daherkommt. Dämonen, Vampire, Ungeheuer: Sie sehen irgendwie gruselig aus, wirken aber nicht wirklich fremd und benehmen sich auch nicht so; ihre Ziele sind simpel. Wenn sie foltern & killen, gewinnen sie beim besten Willen nicht an Charisma.
Oft aber selten mit Erfolg haben Phantasten sich an einem Grauen versucht, das höchstens ansatzweise vom menschlichen Geist erfasst werden kann. William Hope Hodgson (1877-1918) gelang dies mit „The House on the Borderland“ (1908; dt. [„Das Haus an der Grenze“),]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=416 Algernon Blackwood (1869-1951) war in dieser Hinsicht vor allem in seinen längeren Erzählungen erfolgreich. Später war es Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), der einen kosmischen Schrecken beschwor, der in der Konfrontation dem Erzähler immer wieder buchstäblich die Sprache verschlug.
Dass Peter Straub auf Lovecrafts Spuren wandelt, ist mehr als eine Vermutung. Schon einmal hat er sich auf ihn berufen. „Mr. X“ (dt. „Mister X“/“Schattenbrüder“) markierte 1999 den ehrgeizigen Versuch, Lovecrafts „Cthulhu“-Mythos in einer Gegenwart zu etablieren, die mehr als nur Kulisse für eine tentakelreiche Spukstory war.
|Zeitgeschichte ohne echte Wurzeln|
Mit „Okkult“ versucht Straub viel, wobei ihm nicht alles gelingt. So erzählt er im Interview von der Faszination, mit der er in seinen Studentenjahren die schier allgegenwärtigen Gurus und Sektenführer der 1960er Jahre beobachtete. Mit selbst gestrickten Weisheiten und angelesenen, nach eigenem Gusto interpretierten (oder verbogenen) ‚Wahrheiten‘ gelang es ihnen, Männer und Frauen in ihren Bann zu ziehen, die es besser hätten wissen und die Manipulationen und blanken Lügen hätten durchschauen müssen. Spencer Mallon, von dem immer wieder die Rede ist, taucht als Figur in „Okkult“ freilich niemals auf. Im Spiegel seiner Anhänger und Feinde bleibt er schemenhaft. Deshalb wird die Faszination, die angeblich von Mallon ausging, nicht nachvollziehbar.
Faktisch besitzt die gesamte Handlungsebene des Jahres 1966 nur eine von Straub behauptete Bedeutsamkeit. Die „Swinging Sixties“ bleiben blass, die angebliche Umbruchphase ist für die Handlung belanglos. Im Zentrum steht die Geisterbeschwörung. Sie könnte zu jedem anderen Zeitpunkt geschehen. Dass sie gelingt und gleichzeitig fehlschlägt, weil Mallon ein ‚Zauberer‘ ist, dem dies eine Mal ein Trick ohne doppelten Boden gelingt, ist eine Ironie, die nicht zünden will.
|Kühles Drama mit gesetzten Beteiligten|
Mit Straubs Figuren wird der Leser nie warm. Dies liegt nicht nur daran, dass sie in der Tat nicht sympathisch sind und dies womöglich gar nicht sein sollen. Zudem baut Straub – nicht unbedingt notwendig – eine zweite, die Handlung dem Leser zusätzlich entfremdende Ebene ein: Lee Harwell ist Sammler und Chronist der Ereignisse. Er plant ein neues Buch. Das nicht von Straub, sondern angeblich von Harwell geschriebene „Okkult“ stellt so etwas wie sein Notizbuch dar. Erst später besinnt er sich auf seine Rolle als Protagonist in einer Geschichte, in der er sich lange nur als passiver Zeitzeuge betrachtete.
In dieser zweiten Hälfte gewinnt „Okkult“ Profil und Schwung, aus literarischem Ehrgeiz geht eine echte Geschichte hervor. Damit gibt Straub freilich seinen ursprünglichen Anspruch notgedrungen auf. Die Auflösung kann schließlich wieder einmal mit dem Rätsel nicht mithalten. Straubs Konzept einer mehrdimensionalen Realität wird erneut in eindrucksvolle Bilder gekleidet, was an der Banalität der Botschaft wenig ändert. An diesem Problem ist allerdings nicht nur Straub gescheitert.
Im letzten Drittel dominiert der Inhalt die Form. Alle losen Fäden werden zum finalen Knoten geschürzt, sogar Tempo kommt in die Handlung. Am Ende ist da zwar die Erkenntnis, dass Straub mit einer Kanone auf Spatzen geschossen hat. Doch er hat das Risiko unternommen, die Phantastik gegen ihren Strich zu bürsten. Das ist ihm mit „Okkult“ nur bedingt aber doch allemal unterhaltsamer gelungen als die x-te Invasion randalierender Zombies oder liebeskranker Vampire.
|Anmerkung: Facetten der Wahrheit|
„Rashomon“ (dt. „Rashomon – Das Lustwäldchen“) ist ein vom japanischen Regisseur Akira Kurosawa inszenierter Filmklassiker aus dem Jahre 1950. Die Vergewaltigung einer Frau und der Mord an ihrem Mann werden im Verlauf einer Gerichtsverhandlung rekonstruiert. Dabei erzählen die in den Fall verwickelten Personen und ein Zeuge jeweils ihre Versionen der Ereignisse, die als Film im Film wiedergegeben werden und erhebliche Widersprüche aufweisen. Was hat sich tatsächlich ereignet?
Über die spannende Handlung hinaus beschäftigt Kurosawa – der auch am Drehbuch mitschrieb – die Frage nach dem Wesen der Wahrheit, die es womöglich gar nicht gibt, weil ein Geschehen stets durch die individuelle Sicht der Beteiligten gefiltert wird; diese haben zudem oft ein Interesse daran, die objektive Wahrheit zu ihren Gunst zu verdrehen. Das Problem oder vielleicht besser: die Tatsache einer selektiven Wahrnehmung bestimmt auch Lee Harwells Suche.
_Autor_
Peter Francis Straub wurde am 2. März 1943 in Milwaukee im US-Staat Wisconsin geboren. Der Schulzeit folgte ein Studium der Anglistik an der „University of Wisconsin“, das Straub an der „Columbia University“ fortsetzte und abschloss. Er heiratete, arbeitete als Englischlehrer, begann Gedichte zu schreiben. 1969 ging Straub nach Dublin in Irland, wo er einerseits an seiner Doktorarbeit schrieb und sich andererseits als ‚ernsthafter‘ Schriftsteller versuchte. Während die Dissertation misslang, etablierte sich Straub als Dichter. Geldnot veranlasste ihn 1972 zur Niederschrift eines ersten Romans („Marriages“; dt. „Die fremde Frau“), den er (mit Recht) als „nicht gut“ bezeichnet.
1979 kehrte Straub in die USA zurück. Zunächst in Westport, Connecticut, ansässig, zog er mit der inzwischen gegründeten die Familie nach New York. Ein Verleger riet Straub, es mit Unterhaltungsliteratur zu versuchen. Straub schrieb „Ghost Story“ (1979; dt. „Geisterstunde“), seine Interpretation einer klassischen Rache aus dem Reich der Toten. Der Erfolg dieses Buches (das auch verfilmt wurde), brachte Straub den Durchbruch. Mit „Shadowland“ (1980; dt. „Schattenland“) und „Floating Dragon“ (1983; dt. „Der Hauch des Drachens“) festigte er seinen Ruf – und erregte die Aufmerksamkeit von Stephen King, mit dem er sich bald anfreundete. Die beiden Schriftsteller verfassten 1984 gemeinsam den Bestseller „The Talisman“ (dt. „Der Talisman“), dem sie 2001 mit „Black House“ (dt. „Das schwarze Haus“) eine ebenso erfolgreiche Fortsetzung folgen ließen.
|Taschenbuch: 559 Seiten
Originaltitel: A Dark Matter (New York : Doubleday 2010)
Übersetzung: Ursula Gnade
ISBN-13: 978-3-453-43590-2|
[Autorenhomepage]http://www.peterstraub.net
[Verlagshomepage]http://www.randomhouse.de/heyne
_Peter Straub auf |Buchwurm.info|:_
[„Haus der blinden Fenster“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=1003
[„Hellfire Club – Reise in die Nacht“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=1110
[„Esswood House“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=1603
[„In the Night Room“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=2568
[„Schattenstimmen“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=3090
Collins, Paul – Mord des Jahrhunderts, Der
_Das geschieht:_
Einen ersten Teil des Körpers ziehen spielende Kinder am 26. Juni 1897 in New York aus dem East River: den Brustkorb mit zwei Armen. Einen Tag später stoßen Spaziergänger im spärlich besiedelten Stadtteil Highbridge auf den dazu passenden, im Unterholz abgelegten Unterleib. Die wenig interessierte Polizei tippt auf die illegale Entsorgung einer sezierten Leiche durch Medizinstudenten, bis eine nähere Untersuchung des Brustkorbs ergibt, dass dieser Mann mit einem Messer attackiert wurde und durch einen Stich ins Herz starb.
In einer Großstadt wie New York werden täglich verstümmelte Leichen gefunden, doch diese wird zum Auslöser eines regelrechten Medienkrieges: In Sommer 1897 liefern sich zwei große Zeitungen einen erbitterten Kampf um Kunden und Auflagen. Joseph Pulitzer ist Herr der „New York World“, sein jüngerer Herausforderer William Randolph Hearst leitet das „Evening Journal“. Sie sind Publizisten einer neuen Generation: Die nüchterne Schilderung von Fakten weicht dem Boulevard-Journalismus und damit der spekulativ aufbereiteten, nicht selten selbst inszenierten Sensation.
Weniger wichtig und bisweilen störend sind die Fakten. Als sich herausstellt, dass die deutsche Einwanderin Augusta Nack sich mit der Unterstützung ihres aktuellen Liebhabers Martin Thorn des lästig gewordenen Vorgängers William Guldensuppe entledigt hat, ist dies der Presse vor allem Anlass, ein Eifersuchts- und Morddrama zu inszenieren, in welchem den Beteiligten Rollen zugewiesen werden.
Von den Zeitungen und einer manipulierten Öffentlichkeit vorverurteilt, werden Nack und Thorn zum Spielball der Justiz. Vor Gericht liefern sich ein ehrgeiziger Staatsanwalt und ein skrupelloser Verteidiger eine Schlacht, die wiederum von den parteiischen Medien angeheizt wird. Als das Urteil gesprochen wird, steht immerhin ein Sieger fest: Hearst ist der neue König des Boulevards.
_Übel von gestern als Saat für heute_
Dies ist eine jener Geschichten, deren Realität man sich immer wieder vor Augen führen muss, um sie richtig goutieren zu können. Hätte Paul Collins einen ‚echten‘ Kriminalroman geschrieben, würde man ihm sicherlich den Vorwurf schamloser Übertreibung machen. Doch so kann er kontern: mit einem mehr als 50-seitigen Anhang, der die herangezogenen Quellen akkurat auflistet. Spätestens jetzt versteht man, wieso Collins im Vorwort selbstbewusst behaupten kann: |“Sämtliche in Anführungszeichen gesetzte Aussagen sind Originalzitate, und während ich den Wust an Worten freizügig gekürzt habe, wurde nicht ein einziges Wort hinzugefügt.“|
Diese überwältigende Informationsflut aus der Vergangenheit dürfte vor allem die jüngeren Generationen der Gegenwart verblüffen, die mit dem Internet großgeworden sind und oft davon überzeugt sind, die Ersten zu sein, die für Recherchen aus dem (digitalen) Vollen schöpfen können. Doch „vergangen“ ist kein Synonym für „primitiv“, und auch im ‚analogen‘ Zeitalter wusste man Neuigkeiten an den Mann und die Frau zu bringen. So erschien im New York des Jahres 1897 mehr als ein Dutzend Tageszeitungen – oft in drei Ausgaben täglich.
Auch in dieser Hinsicht ist der Leser nach der Lektüre von „Mord des Jahrhunderts“ schlauer geworden. Collins erzählt nicht nur eine fesselnde „True-Crime“-Story, sondern verknüpft die Darstellung eines Mordereignisses mit der Alltags-Schilderung der Ereigniszeit, was unbedingt erforderlich ist, um den Fall Guldensuppe in seiner Gesamtdimension begreiflich zu machen. Im 21. Jahrhundert ist die Presse – über die gedruckte Zeitung erweitert auf die modernen Massenmedien – als zwar inoffizielle aber einflussreiche „vierte Macht“ (neben Gesetzgebung, Gesetzausübung und Rechtsprechung) etabliert.
Verlorengegangen ist die Tatsache, dass dieser Ehrentitel sich ursprünglich auf eine ’seriöse‘ Presse bezog, die sachlich und ausgewogen über Ereignisse berichtete und Missstände aufdeckte. Die Herrschaft des Boulevards, der auf die Wahrheit nicht angewiesen ist, gründet sich auf Männer wie William Randolph Hearst, und sie reicht keine 150 Jahre zurück.
|Sensationen werden „gemacht“|
Sicherlich gäbe es andere historische Dreh- und Angelpunkte, an denen Collins die Geschichte des US-Boulevard-Journalismus verankern könnte. Nüchtern betrachtet stellt der Mord an William Guldensuppe auch keinen „Mord des Jahrhunderts“ dar. Collins selbst macht daraus keinen Hehl und erwähnt sowohl alternative Sensationen als auch weitere spektakuläre Kapitalverbrechen. Den Fall Guldensuppe greift er auf, weil dieser einer bereits angelaufenen Entwicklung zum exemplarischen und perfekten Katalysator wurde: Die Sensation trägt allemal den Sieg über die Wahrheit davon, wenn man sie nur ansprechend verpackt.
Was in diesem Fall mit dem Appell an die sprichwörtlichen niederen Instinkte gleichzusetzen ist. Der Mensch liebt das Grausige ebenso wie den Skandal und schwelgt darin, solange er nicht selbst betroffen ist. Gaukelt man ihm vor, ihn über solche Dinge, die ihn in der Regel nichts angehen, ‚informieren‘ zu wollen, kommt ein schlechtes Gewissen erst recht nicht auf. Dies gilt erst recht in der Welt des Jahres 1897 und für ein Zeitungspublikum, das noch lernen musste, Information von Klatsch, Lüge und Meinungsmache zu unterscheiden.
Als Bösewichte stehen in diesem Spiel die Journalisten von Hearst und Pulitzer nur vorgeblich fest. Collins weiß zu differenzieren: Er beschreibt Menschen, die in den Sog der eigenen Erfolge geraten. Noch gibt es 1897 kaum Grenzen, die der Presse gesetzt werden. Also darf ein Zeitungsverleger tatsächlich eine eigene Truppe ins Leben rufen, die – besser ausgestattet als die echte Polizei – Ermittlungen anstellt und keine Skrupel hat, gefundene Indizien zu unterschlagen, wenn dadurch die nächste Schlagzeile gesichert ist.
|Die Mörder und die Meute|
Dies ist auch deshalb möglich, weil New York anno 1897 eine nur mühsam verwaltete Millionenstadt in einem Staatengebilde ist, dessen Regierungssystem der individuellen Freiheit größere Rechte einräumt als der Eindämmung der daraus erwachsenden Fehler. Das Glück ist mit dem Tüchtigen, und wer bei der täglichen Jagd nach dem Dollar nicht mithalten und die Ellenbogen einsetzen kann, hat Pech gehabt und trägt ausschließlich selbst die Schuld. Die Armen und Kranken ignoriert man am besten; wenn man Glück hat, gehen sie von allein zugrunde.
Solcher Brachialdarwinismus war noch wesentlich deutlicher als heute ein Wesenszug der US-Gesellschaft. Collins zeichnet das Bild einer unbarmherzigen Welt. Rassismus, Ausbeutung, Hunger, Analphabetentum: Solche alltäglichen Missstände sind der Kompost, der nicht nur Unwissenheit, Krankheit und Verbrechen düngt, sondern auch den Boulevard sprießen lässt. Collins erinnert daran, dass es ohne die Presse einen „Jahrhundertmord“ Guldensuppe gar nicht gegeben hätte – der Fall stand kurz davor, ad acta gelegt zu werden, weil quasi täglich Leichen im Hudson trieben. Besonderer Ermittlungsaufwand wurde für diese Pechvögel nicht getrieben. Ohnehin waren die meisten Polizisten korrupt oder unfähig oder beides.
Man glaube außerdem nicht, dass der Mord an William Guldensuppe ein ‚perfektes‘ Verbrechen darstellt. Die Beteiligten waren Amateure und profitierten zunächst von der Gleichgültigkeit der Behörden. Ohne die Einmischung der Presse wären sowohl Augusta Nack als auch Martin Thorn unbehelligt ihrer Wege gegangen.
|Die Mühlen des Gesetzes|
Erst der Medienwirbel ließ die Maschinerie des Gesetzes anlaufen – stockend, knirschend, schlingernd. Collins widmet sich im zweiten Teil seines Buches verstärkt den Mächten 2 (Legislative) und vor allem 3 (Judikative). Nachdem Nack und Thorn wider Erwarten gefasst sind, wird „Der Mord des Jahrhunderts“ zum „court drama“, während die Presse allzeit bereit in den Hintergrund rückt.
Die Bezeichnung „Drama“ ist doppeldeutig und entlarvend; sie deutet gewisse Besonderheiten des US-Rechtssystems an. Auch vor Gericht scheint die Wahrheit von sekundärer Bedeutung zu sein. Faktisch geht es darum, zwölf Geschworene von der Schuld oder der Unschuld eines Angeklagten zu überzeugen. Dies gelingt nicht nur durch Fakten, sondern wird auch durch das Auftreten von Ankläger und Verteidiger beeinflusst. Sie arbeiten mehr oder weniger manipulativ, denn auch die US-Justiz ist erfolgsorientiert: Der Sieg des Juristen ist wichtiger als der Sieg der Gerechtigkeit.
Auch hier war die Welt von 1897 unbarmherziger – oder ehrlicher. Staatsanwalt Young und vor allem Verteidiger Howe spielen vor Gericht offen Rollen. Vor allem Howe trägt dick auf; er kleidet sich in schreiend bunte Anzüge, trägt Ringe an jedem Finger und täglich eine neue, obszön teure Krawattennadel. Er schüchtert Zeugen ein, ‚führt‘ sie zu Aussagen, die er hören will, arbeitet eng mit der Presse zusammen, um für sich zu werben – dies alles mit Billigung des Gesetzes. Dass womöglich doch die Richtigen verurteilt werden, mutet wie ein glücklicher Zufall an.
_Geschichte in Geschichten_
Wenn man Paul Collins einen Vorwurf machen muss, dann den einer fehlenden Distanz zwischen dem Verfasser und seinem Stoff. Dahinter mag Absicht stecken: Collins kündigt im Vorwort an, dass er den O-Ton nutzen werde, um seine Figuren ’sprechen‘ zu lassen. Deren Aussagen sind freilich dort, wo historische Zeitungen zitiert werden, zeitgenössisch eingefärbt: Zeugen wurden gern ‚korrigiert‘, um ihre Äußerungen schlagzeilenwürdiger zu gestalten. Nach dem Willen der zeitgenössischen Presse war die Welt ein Ort der Wunder und der Gefahren. Also wurde sie entsprechend dargestellt.
Die Realität sah allerdings deutlich nüchterner bzw. alltäglicher aus. Collins macht sich die Atemlosigkeit der Boulevard-Journalisten zu eigen; aufgrund des Themas ein naheliegendes Stilmittel, das er indes ein wenig zu frei einsetzt, weil er auch die Vorurteile konserviert, die deshalb schwer oder gar nicht erkennbar sind. New York wird zum Irrenhaus, dessen geistig wenig regen Bewohner nach den Pfeifen von Hearst oder Pulitzer tanzen: Collins trägt dick auf, was er dort fortsetzt, wo er sich auf originale, nicht für eine Veröffentlichung vorgesehenen Gerichtsprotokolle stützen konnte. Also besetzt er die Geschworenenbank mit ulkig-tumben Bauern und Arbeitern und den Zuschauerraum mit neugierigen Frauen, die nach schlüpfrigen Details gieren, während Richter, Verteidiger und Staatsanwalt eine Show präsentieren, die verdächtig nach US-Fernsehen riecht.
So ist Paul Collins letztlich selbst in den Sog des Boulevards geraten. Mehr Sachlichkeit hätte seinem Buch gutgetan sowie deutlich gemacht, dass er nicht nur in kuriosen, kruden, komischen Episoden aus alter Zeit schwelgen will. Dafür hat er sich zu viel echte Recherche-Arbeit in staubigen Archiven und Bibliotheken gemacht. Wer auf solche Differenzierung keinen Wert legt, kann diese Einwände ignorieren und sich einer ebenso spannende wie irrwitzige Geschichte mit reichlichem Zeitkolorit erfreuen.
_Autor_
Paul Collins wurde 1969 in Perkiomenville im US-Staat Pennsylvania geboren. Er studierte Englische Literatur an der „University of California“, Davis und am „College of William and Mary“, das er 1993 mit einem Magistergrad verließ.
Als Autor hat er sich auf die Wiederentdeckung lange vergessener Sachbücher und Biografien spezialisiert. Darüber verfasste er mehrere Bücher sowie zahlreiche Artikel für Zeitungen und Magazine wie New York Times, Slate oder New Scientist. Als „literary detective“ tritt Collins regelmäßig für das National Public Radio vor das Mikrofon. Für den Verlag McSweeneys Books gründete und betreut er das auf ausgegrabene Titel spezialisierte Imprint Collins Library.
Mit seiner Familie lebt Collins in Portland, Oregon, wo er seit 2005 dem Lehrkörper der „Portland State University“ angehört; er lehrt dort das kreative Schreiben von Sachbüchern.
|Gebunden: 431 Seiten
Originaltitel: The Murder of the Century: The Gilded Age Crime That Scandalized a City and Sparked the Tabloid Wars (New York : Crown 2011)
Übersetzung: Carina Tessari
ISBN-13: 978-3-4241-5122-0|
http://www.randomhouse.de/irisiana
Agatha Christie – Das Eulenhaus

Agatha Christie – Das Eulenhaus weiterlesen
Dan Waddell – Das Erbe des Blutes
Als auf dem Gelände der St. John’s Church im Londoner Stadtteil Kensington der Broker James Darbyshire erstochen und ohne seine Hände gefunden wird, geht der Fall an die Metropolitan Police und dort an Chief Inspektor Grant Foster von der Mordkommission West-London. Mit seinen Kollegen Inspektor Andy Drinkwater und Sergeant Heather Jenkins nimmt er die Ermittlungen auf, die aufgrund mangelhafter Indizien ins Leere zu laufen drohen, bis Foster auf der Brust der Leiche eine eingeritzte Botschaft entdeckt.
Was „1A137“ bedeutet, weiß Sergeant Jenkins, die sich für Familiengeschichte interessiert: Es ist der Verweis auf eine alte Sterbeurkunde. Um sich die Arbeit zu erleichtern, heuert das Team den Ahnenforscher Nigel Barnes an, dessen Job es ist, in uralten Akten und Büchern zu fahnden.
Clifton Adams – Satans Silberdollar

Cherie Priest – Boneshaker
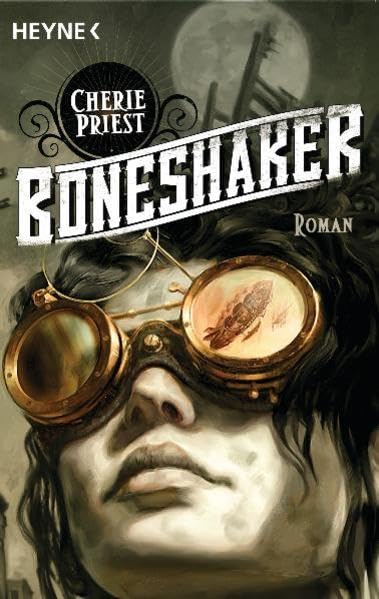
Dell, Christopher – Monster. Dämonen, Drachen & Vampire – Ein Bestiarium
_Inhalt:_
Nach einer Einleitung, die generell und ‚artenübergreifend‘ Herkunft und Geschichte/n der Monster beleuchtet sowie ihre Omnipräsenz in sämtlichen menschlichen Kulturen hervorhebt, versucht der britische Kunsthistoriker Christopher Dell, in zehn Kapiteln Ordnung in das ungeheuerliche Gewimmel zu bringen. Hier werden die Informationen der Einleitung aufgegriffen, vertieft und mit zahlreichen Bildern verdeutlicht.
(1) „Götter und Ungeheuer“: Die Kapitel-Überschrift deutet eine enge und zunächst erstaunliche Verwandtschaft an. Allerdings sind „Götter“ den Menschen durchaus nicht immer freundlich gesonnen. Sie verkörpern auch eine einst nur ansatzweise verstandene und deshalb gefürchtete Natur, treten als „Geschöpfe des Chaos“, sogar als „monströse Gottheiten“ auf, unter denen die „Titanen“ der antiken griechischen Mythologie, mesopotamische oder altägyptische Götter sowie „aztekische Schrecknisse“ genauer unter die Lupe genommen werden.
(2) Das Kapitel „Teufel und Dämonen“ beschäftigt sich mit den Monstern des Alten und Neuen Testaments. Hier sind sie erstaunlich selten und wurden erst in ’nachbiblischer‘ Zeit als Symbole des Bösen instrumentalisiert. So entstand „Satan und die Hierarchie der Dämonen“. Sie wurde zur Basis einer wahren Menagerie bösartiger Höllenwesen, die den Christenmenschen nicht nur im Leben piesacken, sondern auch „das Jüngste Gericht“ umrahmen, hinter dessen Schranken sie auf jene Pechvögel lauern, die ins Höllenfeuer geworfen werden.
(3) Im Mittelalter begann die Naturfurcht sich mit einer jungen Wissenschaft zu mischen. Seltsames ‚Wissen‘, geboren aus Hörensagen und Fehlinterpretation, schürte den Glauben an „Zauberische Monster“: „Wesen der Alchimie, Zaubersprüche und Beschwörungen, Golems, Einhörner“.
(4) In den Himmeln vor allem über abgelegenen Landstrichen trieben „Drachen und fliegende Monster“ ihr Unwesen. Erstaunlicherweise gibt es diese in Kulturkreisen, die nachweislich nie direkt miteinander in Kontakt kamen. Die „Drachen des Westens“ rauben freilich Gold und fressen Jungfrauen, während die „Drachen des Ostens“ eher als freundliche Glücksbringer gelten. Weitere berühmte Luft-Monster waren „Lindwürmer und der Vogel Rok“.
(5) Selbstverständlich tummelten sich in den gewaltigen und gefährlichen Ozeanen „Wassermonster“. In den großen Kreis der „Meer- und Seeungeheuer“ gehört der biblische „Leviathan“. In schottischen Flüssen und Seen lauern die „Kelpies“ auf unvorsichtige Wanderer, in Japan sind es die kuriosen „Kappa“. Klein aber gemein und seit der Antike ‚bekannt‘ sind „Sirenen und Meerjungfrauen“.
(6) Auf dem festen Land kann es ebenfalls ungeheuerlich zugehen, zumal sich hier zu allem Überfluss „Transformationen und Hybridwesen“ tummeln. Gemeint sind „Gestaltwechsler, Werwölfe, Wesen bei Ovid, der Minotaurus, hundsköpfige Menschen“, also Kreaturen, die sich ganz oder teilweise als Menschen ‚tarnen‘ können und deshalb besonders gefährlich sind. Der römische Dichter Ovid widmete solchen Geschöpfen seine „Metamorphosen“ – ein ganzer Zyklus von Geschichten, die er aus etwa 250 antiken Sagen destillierte.
(7) Auch das Jenseits galt als Heimat von Monstern. „Geister und Ghule“ gingen auf Friedhöfen um, „Gespenster“ und „Untote“ besaßen einen unheilvoll erweiterten Aktionsradius; auch „böse Geister“ konnten den Menschen in seinem Heim überfallen. Sicher war man nicht einmal bzw. gerade nicht im Schlaf, denn „Träume und Alpträume“ waren geradezu eine Wiege hässlicher Nachtmahre, Monster auch Ausgeburten unruhig verbrachter Nächte.
(8) Als die Wissenschaft im 18. und 19. Jahrhundert dem Glauben an Ungeheuer die Grundlage zu nehmen begann, fanden „Monster in Volkserzählungen“ ein Reservat. „Untiere aus der Wildnis“ wie „Riesenwölfe, die Tarasque, der Krampus“ wurden – oft schon mit mehr als einem Funken Humor – ins ‚Leben‘ gerufen.
(9) Zumindest einige Ungeheuerlichkeiten musste der Mensch nicht hinnehmen. „Wie man Monster bekämpft“ erinnert an „Helden und Untiertöter“, die oft die Grundlage für ebenso spannende wie erbaulich-lehrreiche Geschichten über „Heilige und Ungeheuer“ bildeten.
(10) Geblieben ist in der Gegenwart die Freude am Monster als Relikt einer Welt, die „Jenseits der Landkarten“ noch unentdeckte Winkel und Abenteuer bieten kann. Die frühe Wissenschaft bot Raum für eine „‚Natur‘-Geschichte“, die „monströse Rassen“ und andere Kreaturen neben die uns bekannte Flora und Fauna stellte. Heute halten die „Kryptiden“ auf die Sache nach dem Yeti oder dem Ungeheuer von Loch Ness die Tradition lebendig. Doch „die letzte Grenze“ bildet das Weltall, das womöglich allerlei außerirdische Monster beherbergt.
|Der Mensch braucht seine Monster|
Sie repräsentieren das Chaos-Element in einer Welt, die nur zum Teil verstanden und deshalb gefürchtet wird: „Monster“ geben dem Schrecken immerhin Gestalt – eine fürchterliche Gestalt, die bereits erklärt, dass seltsame oder schlimme Dinge geschehen. Dieser Versuch einer in der Psychologie wurzelnden Erklärung scheint weltweit die Kulturen zu einen, denn Monster gibt es zu allen Zeiten und auf sämtlichen Kontinenten. Autor Christopher Dell zeigt uns steinzeitliche Höhlenzeichnungen sowie Skulpturen oder Reliefs aus zwar späteren, aber ebenfalls versunkenen Hochkulturen; es ist davon auszugehen, dass jene Zeitgenossen, die in den Lücken zwischen den belegten „hot spots“ existierten, ebenfalls von Monster geplagt wurden.
Das Thema ist vielschichtig und auf weniger als 200 sowie meist bebilderten Seiten nicht einmal annähernd auszuschöpfen. Christopher Dell versteht sein Buch als Einführung in eine Welt, die uns auch im 21. Jahrhundert begleitet. Monster werden nicht mehr gefürchtet, sondern dienen der Unterhaltung. In allen Medien der Gegenwart sind sie präsent. Dabei wirken sie so modern, dass man meinen könnte, sie seien für ihren aktuellen Ruhm geschaffen worden. Dell stellt klar, dass dem keineswegs so ist. Auch die Monster von heute sind Relikte uralter Traditionen. Nicht alle haben sie die Jahrtausende überstanden, aber sie sind zäh: Manches Ungeheuer, das beispielsweise über die Leinwände dieser Welt tobt, ist schon einmal dagewesen und war nur abgetaucht.
|Das Problem des Überblicks|
Angesichts des Füllhorns grotesker Geschöpfe, das Dell über uns ausschüttet, wird verständlich, welchen Quellen die Monster der Moderne entspringen. Schon die Ausblendung der griechischen Antike würde eine Unzahl klassischer Blockbuster-Bestien verschwinden lassen. Dells Verdienst ist es, diesen ‚europäischen‘ Monstern die mindestens ebenso vielfältige Menagerie der asiatischen Gruselgestalten gegenüberzustellen. Nur singulär bleiben Verweise auf Südamerika, während Australien und Afrika ausgespart sind.
Die Sprunghaftigkeit ist glücklicherweise nicht so gravierend wie befürchtet. Dell hat sein Thema trotz des knappen Raumes gut im Griff. Man muss sich freilich damit abfinden, dass erschöpfende Kenntnisvermittlung nicht das Ziel dieses Buches ist. Dann ist es möglich, die knappen, aber informativen Texte zu würdigen. Dell springt nicht von einem Monster zum nächsten. Er schafft zeitliche und räumliche Zusammenhänge, die eine gewisse Globalität der Monster erklären.
|Bunte Welt der Bestien|
Im Vordergrund stehen ohnehin die Bilder. Gemeint sind Abbildungen historischer Gemälde, Stiche, Figuren, Masken, Karten etc. aus vielen Jahrhunderten. Zwar mag der Mensch Monster einst gefürchtet haben, er hielt sie jedoch schrecklich gern im Bild oder als Figur fest. Auch hier spielen psychologische Aspekte eine Rolle; die Beschäftigung mit dem Objekt der Furcht hilft, diese zu überwinden. Eine andere Begründung ist handfester: Künstler stellen gern Monster dar, denn das Böse ist meist interessanter als das Gute. Daran hat sich definitiv nichts geändert, wie unter anderem jeder Horrorfilm-Freund bestätigen wird, der die Minuten zählt, bis Held und Heldin endlich das Schwätzen & Turteln einstellen und das Ungeheuer auftaucht.
Die schier unendliche Vielfalt bizarrer, verdrehter, der ‚ordentlichen‘ Realität spottender Gestalten unterstreicht diese Faszination. Der menschlichen Fantasie war und ist in der Erfindung von Monstern offensichtlich keine Grenze gesetzt. Dass sie sich nicht nur in die Kryptozoologie oder in den UFO-Wahn, sondern auch in jene Sicherheit geflüchtet haben, die Film, Fernsehen oder die digitale Spielwelt ihnen bieten, erwähnt Dell nur am Rande. Multimedial werden die Monster uns zuverlässig über weitere Jahrhunderte begleiten!
|Ein Fest für die Augen|
„Monster“ liegt als Buch deutlich schwerer in der Leserhand als andere, oft deutlich seitenstärkere Bücher dieser Größe. Dies liegt an einem besonders hochwertigen Papier. Es ist dick, verhindert jedes Durchscheinen und gibt Farben brillant und Bilddetails deutlich wieder. Noch unter der Lupe löst sich das Motiv nicht in Farbpunkte auf. Stattdessen werden neue Einzelheiten sichtbar.
Berühmte, anonyme und obskure Künstler haben sich an Monsterdarstellungen versucht. Mal stehen Ungeheuer im Mittelpunkt einer Darstellung, dann wieder bilden sie eher dekorative Elemente. Dell sind stets die Monster wichtig. Er beschränkt sich bei den Abbildungen deshalb oft auf entsprechende Ausschnitts-Vergrößerungen. Diese sind freilich nicht immer glücklich gewählt; Dell ignoriert dann einen Zusammenhang, den erst das Gesamtmotiv widerspiegelt.
Diverse Abbildungen wirken übermäßig bunt. Sie scheinen nachträglich für dieses Buch koloriert worden zu sein. Auch dies stört die ursprüngliche Aussage. Wirklich übel sind jene Abbildungen, die aus verschiedenen Vorlagen ‚komponiert‘ wurden. Ihnen wohnt keinerlei Informationswert mehr inne; sie sind nur noch Dekoration. Erfreulicherweise dominiert die Originaltreue.
Insgesamt hätte dem Werk ein strengeres Layout gutgetan. Die Bilder quellen förmlich über die Ränder hinaus, und oft sehen wir links ein Motiv, das sich mit der Abbildung auf der rechten Seite ‚beißt‘. Zudem wirkt die Bildauswahl willkürlich. Dell springt wie entfesselt durch Raum und Zeit und lässt einen roten Faden vermissen. Manchmal ist weniger mehr, weil es sauberer gegliedert ist.
Ungeachtet solcher Kritik ist „Monster“ eine Fundgrube für den Phantastik-Freund, der sich einen Spaß daraus machen kann, ’seine‘ Lieblingsmonster in ihren historischen Gestalten wiederzuerkennen. Zudem ist nach der Lektüre eines definitiv klar: Für seine Liebe zu Monstern muss sich niemand schämen – sie wird uns Menschen offensichtlich in die Wiege gelegt!
|Gebunden: 192 Seiten
Originaltitel: Monsters – A Bestiarium of the Bizarre (London : Thames & Hudson Ltd. 2010)
Übersetzung: Brigitte Hilzensauer
ISBN-13: 978-3-8503-3437-2|
[Verlagshomepage]http://www.cbv.at
Nate Southard – Red Sky
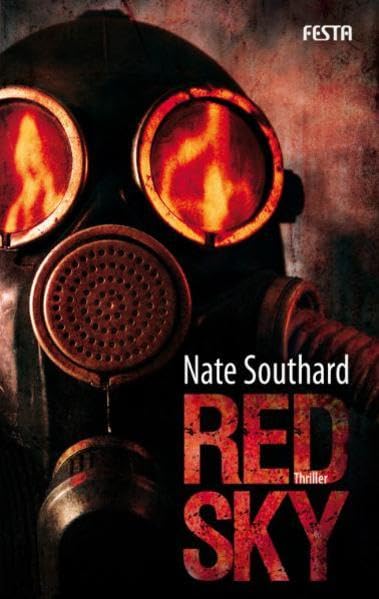
Nate Southard – Red Sky weiterlesen
John Dickson Carr – Das Skelett
Eigentlich ist die Tragödie von Fleet House längst in Vergessenheit geraten. Dort in der englischen Grafschaft Berkshire stürzte von zwanzig Jahren unter nie wirklich geklärten Umständen Hausherr Sir George Fleet vom Dach und in den Tod, als er nach einer Jagdgesellschaft Ausschau hielt. Jetzt erreichten drei anonyme Briefe Scotland Yard, die einen raffinierten Mord als Ursache andeuten.
Unwillig muss Chefinspektor Masters den längst ‚kalten‘ Fall wieder aufrollen. Leider kleidete der Briefschreiber seine Worte in Rätselform. Zwecks Deutung bittet Masters seinen alten Freund Sir Henri Merrivale um Unterstützung, der sich als Privatermittler der unkonventionellen aber erfolgreichen Art einen Namen gemacht hat. Eines der Rätsel rankt sich um ein bizarres Objekt: eine alte Standuhr, deren Gehäuse kein Uhrwerk, sondern ein sorgfältig fixiertes Skelett beherbergt. Merrivale hat es ersteigert und dabei erfahren, dass seine Mitbieterin Sophie, Gräfin von Brayle, eine enge Freundin von Lady Cicely, Fleets Witwe, ist. Die seltsame ‚Uhr‘ sollte an den Hausarzt Dr. Laurier gehen, dessen Vater sie einst baute. John Dickson Carr – Das Skelett weiterlesen
Agatha Christie – Der Tod wartet

Agatha Christie – Der Tod wartet weiterlesen
Carsten Stroud – Niceville (Niceville-Trilogie 1)
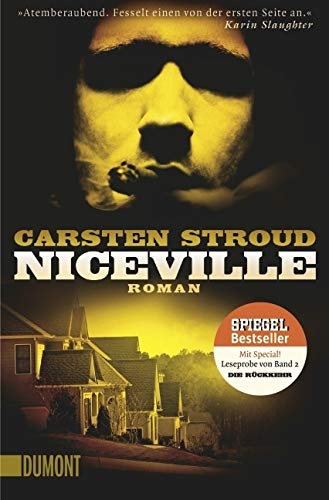
Carsten Stroud – Niceville (Niceville-Trilogie 1) weiterlesen
Ellery Queen – Die Zange

Ellery Queen – Die Zange weiterlesen
Strand, Jeff – Grabräuber gesucht – Keine besonderen Kenntnisse erforderlich
_“|Andrew Mayhem|“-Serie_
(2000/03) Grabräuber gesucht (Keine besonderen Kenntnisse erforderlich) |(Graverobbers Wanted [No Experience Necessary])|
(2001/03) Alleinstehender Psychopath sucht Gleichgesinnte |(Single White Psychopath Seeks Same)|
(2004) |Casket for Sale [Only Used Once])|
(2009) |Suckers| (mit J. A. Konrath; Storys)
(2011) |Lost Homicidal Maniac [Answers to „Shirley”])|
_Das geschieht:_
Andrew Mayhem versucht sich als Privatdetektiv. Eine Lizenz besitzt er nicht und hat kaum Ahnung von seinem Traumjob, weshalb es immer wieder zu unerwarteten Zwischenfällen und hässlichen Zusammenstößen mit observierten Ehebrechern kommt. Chambers, eine Kleinstadt im US-Staat Florida, ist zudem kein einträgliches Pflaster für Detektive. Mayhem hat genug Zeit, seine beiden Kinder zu hüten, während Gattin Helen als Krankenschwester den Lebensunterhalt der Familie sichert.
Um endlich den Versager- und Schmarotzerstatus abzuschütteln, nimmt Mayhem einen bizarren und eindeutig illegalen Auftrag an: Klientin Jennifer Ashcroft bietet ihm 20.000 Dollar, um ihren in der Wildnis begrabenen Ehemann Michael auszubuddeln. Er wurde dummerweise mit einem Schlüssel bestattet, den sie dringend benötigt. Mayhem stellt lieber keine Fragen, sondern macht sich mit seinem widerwilligen Assistenten und Busenfreund Roger an die Arbeit.
Der Job nimmt ein spektakuläres Ende: Michael schießt aus dem Sarg auf die Grabschänder und stirbt anschließend an einem Herzschlag. Ein unsichtbarer Dritter schlägt Mayhem zusammen, schießt Roger zwei Pfeile in den Leib und zerstückelt Jennifer. Mayhem schickt er Videos, auf denen Menschen grausam gefoltert und getötet werden. Der Detektiv soll ihn suchen und finden. Weigert er sich oder informiert er die Polizei, werden fünf weitere Menschen sterben.
Mayhems Ermittlungen führen ihn zur obskuren Firma „Makabre Freuden“, der Michael Ashcroft als Geschäftsführer vorstand. Wie Mayhem herausfindet, werden hier nicht nur Horrorfilmchen gedreht. Einer der Mitarbeiter muss der Killer sein, doch leider kommt ihm Mayhem zu spät auf die Schliche und sorgt durch sein notorisches Ungeschick für eine dramatische Zuspitzung des Falls …
|Horror & Humor als bedingt erfolgreiche Mischung|
Man nehme einen simplen Krimi-Plot und polstere ihn durch möglichst schwarzen Humor sowie makabre Splatter-Effekte auf: So funktioniert „Grabräuber gesucht“ – oder auch nicht, denn noch mehr als üblich obliegt dem Leser die Entscheidung, ob ihm gefällt, was Jeff Strand da versucht. Der Autor hat sich auf ein gefährlich schmales Brett gewagt, denn man sollte sein schriftstellerisches Handwerk sehr gut beherrschen, um angesichts der genannten Mischung nicht ins Rutschen zu geraten. Strand hat nur phasenweise Erfolg und schliddert vor allem im großen Finale gefährlich ins Abseits, als er – plötzlich gar nicht mehr komisch – den Detektiv und den Killer um das Leben zweier Kinder schachern lässt, die in einer infamen Todesfalle stecken.
Generell passt ein Plot, der sich um Snuff-Filme dreht, bei denen Menschen vor laufender Kamera ermordet werden, nicht zum leichten Grundton dieses Romans. Der Humor konterkariert nicht das Grauen, sondern hinterlässt in solchen Passagen einen schlechten Nachgeschmack.
Ein Roman wie „Grabräuber“ stellt nicht nur den Leser, sondern auch die moderne Buchindustrie vor ein Problem. Wie vermarkte ich einen Roman, der nicht in eine bestimmte Schublade passt? Hier wird der komödiantische Faktor in den Vordergrund gestellt. Allerdings ist Strand nicht so geistreich wie er meint. Oder hat die Übersetzung dem ursprünglich grandiosen Witz den Garaus gemacht. Da sich die deutsche Fassung sehr flüssig liest, dürfte wohl die erste Vermutung ins Schwarze treffen.
|Humor ist … komplex|
Strand liegt im Prinzip richtig: Sein keinesfalls durch Originalität glänzendes Kriminalstück benötigt dringend ein wenig Pep. Erzählt wird nicht nur die allseits bekannte Geschichte vom ebenso irren wie genialen Killer, der ständig Rätselraten spielen will und trotzdem die Zeit findet, abenteuerliche Mordpläne in die Tat umzusetzen – erzählt wird außerdem sehr schlicht.
Über den Plot sollte man lieber nicht nachdenken, was Strand deshalb durch eingeschobene Skurrilitäten die manchmal besser – Michael Ashcrofts kurzfristige ‚Auferstehung‘ hat auf jeden Fall eine einprägsame Wirkung! -, manchmal schlechter und – immerhin selten – gar nicht gelungen sind.
Vor allem misslingt Strand die Schaffung einer Hauptfigur, die als Führer durch diese Welt der konstruierten Seltsamkeiten taugt. Schon der Name ist kein Wink, sondern ein Hieb mit dem sprichwörtlichen Zaunpfahl: „Mayhem“ bedeutetet Chaos, und das ist es, was unser Held entweder verbreitet oder in das er gerät. Leider kann sich Strand nicht entscheiden: Ist Mayhem das bevorzugte Opfer der Tücke des Objekts, oder steckt in ihm doch ein Kämpfer, der zum Vorschein kommt, wenn es richtig ernst wird? Doch wie erklärt sich dann, dass dieser Kämpfer immer wieder verschwindet und dem Trottel Platz macht?
|Chaot mit Familienanhang|
Mayhem zur Seite steht Kumpel Roger, der ebenfalls nicht durch Alltagstauglichkeit glänzen kann. Für einen zweiten Kampf-Trottel besteht in dieser Geschichte ohnehin kein Bedarf, weshalb Strand Roger durch einen Pfeilschuss so außer Gefecht setzt, dass er anschließend vor allem dann auftritt, wenn Mayhem seine Kinder irgendwo zwischenlagern muss.
Denn er ist ein Privatdetektiv mit Familie, die er in seine Arbeit einbezieht. Offenbar soll es witzig wirken, dass Mayhem beispielsweise zur Observation eines Friedhofes mit zwei altklugen, naseweisen Gören vorfährt. Daheim lauert selbstverständlich eine liebevolle aber strenge Gattin, die einerseits mit kurzem Geduldsfaden und andererseits unerklärlich nachsichtig Mayhems Eskapaden registriert. Auch für sie hat Strand keine Verwendung über diese Witzfunktion hinaus, weshalb er sie bald durch einen Beinbruch aus der Handlung nimmt.
|Aller Anfang ist schwer|
„Grabräuber gesucht“ zeigt Jeff Strand in der Frühzeit seiner Schriftsteller-Laufbahn. Die zur Sprache gebrachten Unbeholfenheiten mögen ihre Erklärung in dieser Tatsache finden. Zumindest im englischsprachigen Raum hat Strand in den vergangenen Jahren eine Produktivität an den Tag gelegt, die auf Publikumserfolg deuten lässt. Die „Andrew Mayhem“-Serie setzt er weiterhin fort.
Auf dem deutschen Buchmarkt ist ein erster Landeversuch anscheinend gescheitert. Nur die ersten beiden Romane erschienen; ein dritter Band wurde angekündigt; er hatte schon einen Titel („Sarg zu verkaufen – Nur einmal benutzt“), wurde aber aus dem Verlagsprogramm gestrichen. Wie es scheint, sind den Lesern die erwähnten Schwächen ebenfalls ungünstig aufgefallen.
Nun geht Jeff Strand in Deutschland in die zweite Runde. Vom Verkaufserfolg wird es abhängen, ob die Reihe dieses Mal über die volle Distanz Veröffentlichung findet. Schwächen lassen sich überwinden, und die unterhaltsamen Stellen in „Grabräuber gesucht“ sind zu zahlreich, um Zufall zu sein: Strand kann schreiben. Hier muss er noch lernen, dies ökonomisch einzusetzen und dem Gag nicht die Story zu opfern. Womöglich ist ihm dies inzwischen gelungen.
_Autor _
Geboren am 4. Dezember 1970 in Baltimore, US-Staat Maryland, zog Jeff Strand als Säugling mit seinen Eltern nach Fairbanks in Alaska. Nach deren Trennung siedelten er und seine inzwischen geborene Schwester mit der Mutter nach Kent in Ohio um. 1989 schrieb Strand sich an der „Bowling Green State University“ ein. Seinen Abschluss machte Strand im Fach Kreatives Schreiben.
Schon in seiner Studienzeit schrieb Strand Theaterstücke und Drehbücher. Ab Mitte der 1990er Jahre versuchte er sich auch an Romanen, wobei er die Genres Phantastik und Krimi gleichermaßen bediente bzw. gern mischte und sie mit schrägem Humor abschmeckte. In dieser Zeit entstanden zahlreiche Manuskripte, von denen nur wenige vollendet wurden. Auch eine Veröffentlichung gelang Strand lange nicht; Seine Drehbücher wurden nie verfilmt, seine Storys und Romane abgelehnt.
Inzwischen in Tucson, Arizona, lebend und seinen Lebensunterhalt in der Erwachsenenbildung verdienend, arbeitete Strand weiter an sich und seiner Schriftstellerei. Auch diese Texte wurden nicht veröffentlicht, sodass Strand 1998 zunächst aufgab und Drehbücher für Filmkomödien schrieb, die ebenfalls keine Abnehmer fanden. Ratlos schickte er das Manuskript seines Romans „How to Rescue a Dead Princess“ an einen der zu diesem Zeitpunkt noch jungen Verlage, die sich darauf spezialisierten, Bücher nicht gedruckt, sondern als eBooks auf den Markt zu bringen.
Hier fand Strand endlich seine Nische. Seit 2000 war er gut im Geschäft. Seine Romane erschienen bei verschiedenen eBook-Verlagen. Weil er ‚vorgeschrieben‘ hatte, lagen genug druckfertige Manuskripte in seiner Schublade, sodass Strand in schneller Folge ’neue‘ Romane vorlegen konnte. Jeff Strand lebt und arbeitet in Tampa, Florida.
|Taschenbuch: 270 Seiten
Originaltitel: Graverobbers Wanted (No Experience Necessary) (Cincinnati/Ohio : Mundania Press 2003)
Übersetzung: Michael Krug
ISBN-13: 978-3-404-164196-7|
[jeffstrand.wordpress.com]http://jeffstrand.wordpress.com
[www.luebbe.de ]http://www.luebbe.de