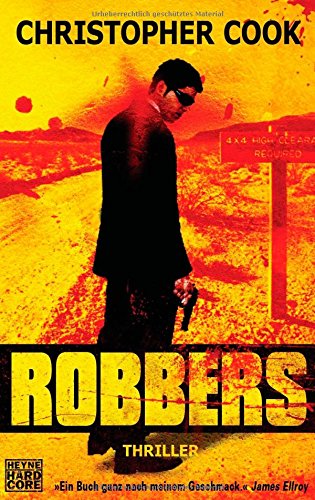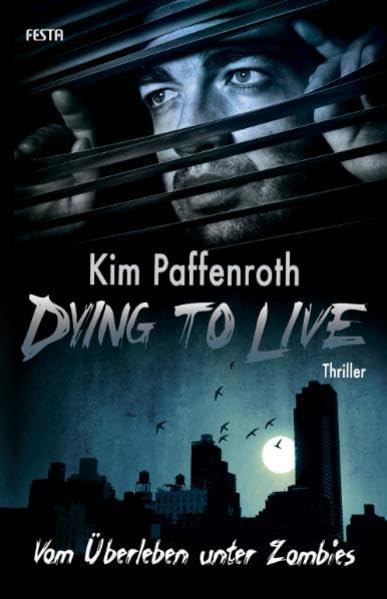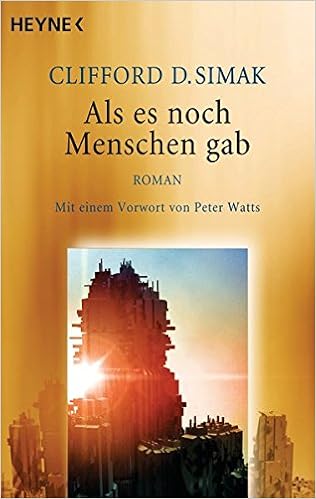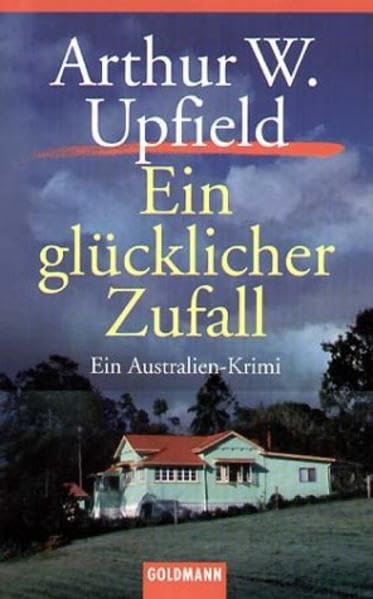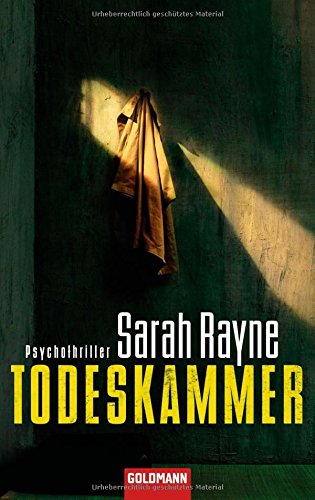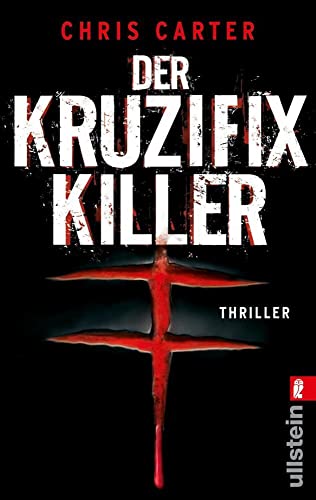_Das geschieht:_
Leppington ist eine kleine Hafenstadt im nördlichen Yorkshire. Sie ist im Niedergang begriffen, nur die gewaltigen Schlachthöfe sorgen noch für Arbeit – und viel Blut, das scheinbar direkt in die Kanalisation geleitet wird. Dies ist Leppingtons seltsamer Geschichte geschuldet, die Dr. David Leppington, ein Nachfahre des Stadtgründers, von seinem Großonkel George erfährt, als er, der den Ort schon als Kind verlassen hat, zurückkehrt, um sich eventuell als Arzt in ’seiner‘ Stadt niederzulassen.
Nach George Leppington schloss vor tausend Jahren der Donnergott Thor einen Pakt mit dem ersten Leppington. In jenen frühen Tagen des Christentums sah Thor den Untergang der nordischen Götter bereits vorher. Um Einhalt zu gebieten, schuf er eine Armee untoter, vampirischer Krieger, die in großen Höhlen und Kavernen unter der Stadt darauf warteten, von einem Leppington in den Kampf geführt zu werden. Doch der Pakt wurde einseitig aufgekündigt. Seither lauern die Vampire unter der später entstandenen Stadt, und die Leppingtons hüten sie, wobei schwere Gitter nützlich sind.
Ausgerechnet der alte George beschließt, Thors Forderung endlich zu erfüllen. Er lässt die Vampire frei, die in Leppington das oberirdische Blutsaugen üben, bevor sie später in die Welt hinausziehen. David versucht verzweifelt, den Kreaturen Einhalt zu gebieten. An seiner Seite stehen Electra Charmwood, Inhaberin eines alten Hotels, ihre Angestellte Bernice Mochardi und der Vagabund Jack Black – ein Quartett, das sich aus Wiedergeburten jener mittelalterlichen Männer und Frauen rekrutiert, die einst für das Ende des Paktes verantwortlich waren.
Während Leppingtons ahnungslose Bürgerschaft sich nach und nach in Untote verwandelt, versuchen diese vier Personen, die Ausbreitung der Vampir-Seuche zu stoppen. Doch wie bekämpft man Kreaturen, die einerseits nicht mehr sterben können, während sie andererseits die durch Buch und Film bekannten Methoden zur Vampir-Abwehr kaltlächelnd ignorieren …?
_Tod, Blut plus Sex = echte Vampire!_
Der erwachsene Freund zumal der klassischen Phantastik hat in den ersten Jahren des noch jungen 21. Jahrhunderts Grund zur Klage. So viele Archetypen zählt der Horror nicht, dass er auf eine prägende Gestalt wie den Vampir verzichten könnte. Aber den stolzen Blutsauger scheint es dahingerafft zu haben; er wurde nicht gepfählt, sondern meyerisiert. Ein grässliches Schicksal, denn ausgerechnet DAS klassische Symbol für wilden, aller Gesetze und Regeln enthobenen Sex wurde seines Beißtriebs beraubt (= kastriert) und zum platonischen Minne-Kasper für die Maid, die sich (noch) nicht traut, herabgewürdigt.
Diese horromantische Demütigung wird der Vampir hoffentlich bald überstanden haben und zur alten Form zurückkehren. Bis es soweit ist, müssen seine wahren Anhänger mit ihm in der Grusel-Diaspora schmachten oder sich mit unbekanntem Stoff aus besseren, alten Zeiten über die Dürre trösten. „Vampyrrhic“ erschien bereits 1998, als sowohl Edward als auch Bella sowie ihre doppelt untoten Klone noch so undenkbar waren wie die aktuelle Gesundheitsreform oder die Ölpest im Golf von Mexiko.
Simon Clark ging damals einen eigenen Weg; ’seine‘ Blutsauger sind keine vornehm in samtgefütterte Capes gewandete Aristokraten, sondern eine gänzlich unattraktive Mischung aus Vampir und Zombie. Sie benehmen sich so schlecht wie sie aussehen, und sie sind viel zu dumm, um sich Gedanken über ihr unerfülltes, untotes Dasein zu machen, sich deshalb zu grämen oder gar auf Erlösung zu hoffen.
In einem Punkt sind sie allerdings klassisch geblieben: Sie definieren sich über das Blut bzw. die Gier danach. Clarks Vampire können sich tarnen und quasi einen Liebeszauber über ihre Opfer werfen, der jedoch wie der Duft der Venusfliegenfalle oder die bunte Schönheit des Fliegenpilzes reines Mittel zum Zweck ist. Dahinter lauert die unkontrollierbare Gier, weshalb diese Vampire wie wilde Hunde hinter massiven Gittern und Türen eingesperrt wurden. Auf den Zeitpunkt ihrer Freilassung haben sie keinen Einfluss: Der Vampir degeneriert zum gelenkten Kollektiv, das als Waffe instrumentalisiert wird.
|Böse Meister und verdammte Helden|
Solche Blutsauger taugen nur als Scheusale, die einen grässlichen (aber vom Verfasser detailfroh ausgemalten) Tod bringen bzw. selbst ein scheußliches Ende finden. Damit sind sie ungeeignet als böse Widersacher, weshalb Clark eine Art Über-Vampir postuliert, der das Denken übernimmt. Logischerweise übernehmen jene Blutsauger diesen Job, die erst jüngst zu Untoten wurden. Sie sind im Gegensatz zu den im Untergrund von Leppington hausenden Dumm-Vampiren mit den Verhältnissen der Gegenwart vertraut und daher fähig, den doch reichlich angestaubten Plan zur Vernichtung des Christentums durch eine zwar ebenso menschenfeindliche aber zeitgemäße Schurkerei zu ersetzen.
Deshalb sind es primär diese ‚modernen‘ Vampire, die unseren menschlichen Helden die echten Probleme verursachen. Wie es sich gehört sowie die Spannung schürt, sind sie eigentlich hoffnungslos in der Minderzahl. Außerdem bilden sie einen bunten, zur Rettung der Welt faktisch untauglichen Haufen. Deshalb dauert es viele Seiten, bis sie ihre Mission begreifen, akzeptieren und in die Tat umsetzen. Diese Zeit ist auch deshalb erforderlich, weil sich die vier Kämpfer gegen das Böse erst einmal finden und zusammenraufen müssen.
Wie einst Abraham van Helsing stellt Clark einen Arzt in den Mittelpunkt des Geschehens. Allerdings ist Dr. David Leppington ein Mann der Gegenwart sowie Wissenschaftler und deshalb zunächst gänzlich unwillig, an Vampire zu glauben. Ihm wird deshalb ein echter Krieger zur Seite gestellt.
Mit Jack Black gelang Clark die sicherlich beste Figur dieses Romans. Bereits der Name ist ein gelungener Insider-Scherz: „Jack Black“ war ein Rattenfänger, der im London der 1850er Jahre nach Ungeziefer jagte. ‚Unser‘ Jack Black setzt die Vampire von Leppington mit Ratten gleich. Dass er einer der ‚Guten‘ ist, vermag Clark gut zu verbergen, denn er wird wie ein Bösewicht eingeführt. Erst allmählich und für den Leser überraschend schält sich seine wahre Rolle heraus.
Wesentlich prosaischer sind dagegen die beiden weiblichen Hauptrollen gezeichnet, obwohl Clark sich alle Mühe gab, Electra Charmwood und Bernice Mochardi ein wenig Normabweichung einzuhauchen. Letztlich beschränkt sich der Verfasser dabei auf Klischees. Electra ist allzu dramatisch, und Bernice wird zum Weibchen in Not, für das sich der zauderliche Leppington mannhaft den Blutsaugern stellt.
|Mancher Plan erledigt sich (von) selbst|
Sowie Götter als auch Untote haben ein gänzlich anderes Verständnis vom Wesen und dem Verstreichen der Zeit, weshalb für sie die Einleitung von Ragnarök weiterhin aktuell ist. Nur wenn man sich diese Tatsache vor Augen führt, ist es möglich, sich mit der Idee einer donnergöttlichen Vergeltungsmaßnahme durch Vampire wenigstens halbwegs anzufreunden. Die überzeugende Rekonstruktion einer Zeit, in der nordische Götter über die Erde wandelten, übersteigt Clarks Fähigkeit eindeutig. Als Leser kann man sich ein Grinsen nicht verkneifen, zumal die ‚Logik‘ in Thors Racheplan sich wohl nur seinem Schöpfer erschließt. Selbst im Mittelalter wäre dieses Heer der grenzdebilen Untoten mit der Vernichtung der Menschheit definitiv überfordert gewesen. Tausend Jahre später wirkt dieses Vorhaben erst recht lächerlich. Nicht grundlos beschloss Stephen King, ’seine‘ Vampire in „Salem’s Lot“ (dt. „Brennen muss Salem“) auf entsprechende Ambitionen verzichten zu lassen. Sie beschränkten sich darauf, ein Territorium zu schaffen, in dem sie unbemerkt von einer Menschenwelt ‚leben‘ konnten, die sie ansonsten problemlos vernichten könnte.
Genau dies würde den Vampiren blühen, sollten sie Leppington verlassen. Nur im Untergrund konnten sie überdauern. Dass sie sich plötzlich in apokalyptische Zerstörer verwandeln sollen, will man Clark beim besten Willen nicht abnehmen. In der Tat scheint ihm diese Drohung nur als spannungsförderlicher Vorwand zu dienen. Die Handlung verlässt Leppington niemals, und selbst dort bemerken die meisten Bürger nicht einmal, dass Blutsauger durch die Straßen gaukeln.
Diese vage Bedrohlichkeit spiegelt sich in der wenig stringenten Entwicklung der Handlung wider. „Vampyrrhic“ ist hervorragend in den ersten beiden Romandritteln. Clark geizt nicht mit blutigen Effekten, vermag aber dennoch eine sich steigernde Atmosphäre der Angst zu entfachen. Als die finale Konfrontation zwischen Gut und Böse ansteht, fällt ihm freilich nur ein, die Helden mit Kettensägen auszustatten, als sie den Vampiren in die Höhlen unter Leppington folgen. Dort wird gesäbelt und geschnetzelt, bis sich Vampire und Vampirjäger unter einer Schicht aus Schmutz, Blut- und Fleischfetzen nicht mehr unterscheiden lassen.
|Parforceritt statt Meisterwerk|
Die Auflösung der Handlung ist weder originell noch wirklich entschlossen; sie lässt Raum für ein Wiederauftauchen der Vampire, und tatsächlich kehrten sie 2003 und 2009 in zwei Fortsetzungen zurück. „Vampyrrhic“ ist kein Klassiker des Horrorgenres wie Bram Stokers „Dracula“ oder Kings „Brennen muss Salem“. Er war auch nie als solcher gedacht. „Vampyrrhic“ ist pure Unterhaltung mit harten Bandagen. Zur Gruselstimmung gehören hier drastische Ekel-Effekte. Weil „Vampyrrhic“ immer wieder durchscheinen lässt, dass mehr in diesem Roman stecken könnte, ist zumindest derjenige Leser leicht enttäuscht, der darauf wartet, dass Clark dieses Potenzial nutzt, wozu es nie kommt.
Langeweile wird sich deshalb freilich nicht einstellen. Clark kann schreiben und sich der einschlägigen Grusel-Effekte virtuos bedienen. Die Handlung schreitet rasch voran, und sie wird – klammert man den Ragnarök-Faktor (s. o.) aus – mit gelungenen Einfällen aufgewertet.
Auch die deutsche Ausgabe kann – abgesehen von der Tatsache ihrer bloßen Existenz – sowohl den Leser auch auch den Sammler erfreuen. Die Übersetzung ist gut, das Buch ein Paperback mit Klappenbroschur, solidem Papier und – dies ist heutzutage eine Extra-Erwähnung wert – einem gezeichneten Cover statt eines nichtssagenden Fotos, das lieblos einem Billig-Bildstock entnommen wurde.
_Autor_
Simon Clark wurde am 20. April 1958 in Wakefield im Westen der englischen Grafschaft Yorkshire geboren. Er stammt nach eigener Auskunft aus einer Familie von „Geschichtenerzählern“ und hat bereits in sehr jungen Jahren erste Kurzgeschichten geschrieben. Die Jahre zwischen Schule bzw. Ausbildung und einer vollzeitlichen Schriftsteller-Tätigkeit füllte Clark standesgemäß mit den üblichen langweiligen, exotischen oder verrückten Aushilfs- und Kurzzeit-Jobs.
Clark ist ein Genre-Autor, der sich auf Horror und Science-Fiction konzentriert. Er debütierte 1995 mit dem Roman „Nailed by the Heart“, dessen Titel er für seine Website übernommen hat. Für seine Romane und Kurzgeschichten wurde Clark mehrfach für Preise nominiert; gewonnen hat er zweimal den „British Fantasy Award“.
Mit seiner Familie lebt Simon Clark in Doncaster im Süden von Yorkshire. Über seine Aktivitäten informiert er (nicht sehr aktuell) auf [dieser Website]http://www.bbr-online.com/nailed .
|Kartoniert: 448 Seiten
Originaltitel: Vampyrrhic (London : Hodder & Stoughton 1998/Forest Hill, Maryland : Cemetery Dance Publications 1998)
Übersetzung: AZMO u. Ernst Wurdack
Cover: Jacek Kaczynski
ISBN-13: 978-3-938065-55-6|
[www.wurdackverlag.de]http://www.wurdackverlag.de