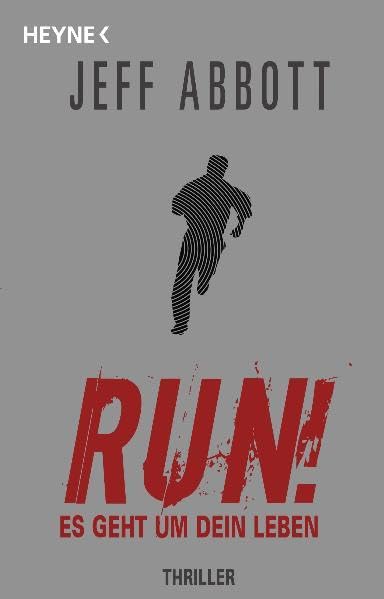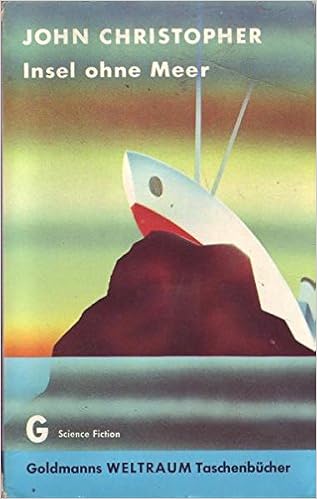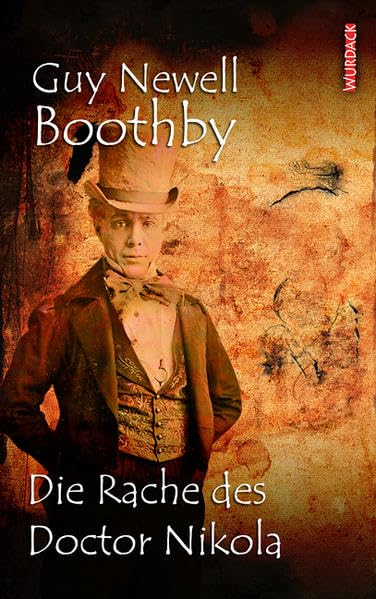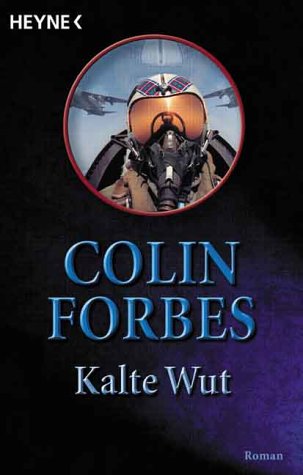
Colin Forbes – Kalte Wut [Tweed 12] weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Harry Carmichael – Notausstieg

Harry Carmichael – Notausstieg weiterlesen
Abbott, Jeff – Run! Es geht um dein Leben
_Das geschieht:_
Seit seine Gattin vor zwei Jahren einem Mordanschlag zum Opfer fiel, vergräbt sich Ben Forsberg in Arbeit. Er berät private Sicherheitsfirmen, die von der US-Regierung angeheuert werden, um in Krisengebieten das Militär zu entlasten – ein einträgliches Geschäft, bis Forsbergs Visitenkarte in der Tasche eines berüchtigten Auftragskillers gefunden wird. Dieser hatte gerade einen US-Agenten erschossen, bevor ihn selbst die tödliche Kugel des Pilgrims, eines Attentäters im Dienst des „Kellers“ – einer streng geheimen und illegalen, weil außerhalb jedes Gesetzes agierenden Gruppe innerhalb der CIA -, traf.
Nach dem 11. September 2001 wurden die Menschenrechte in den USA stark eingeschränkt. Wer im Verdacht steht, einer terroristischen Organisation anzugehören, darf vom Heimatschutz festgenommen und verhört werden, wobei die Grenzen zur Folter fließend sind. Forsberg gilt als schuldig, seinen Unschuldsbeteuerungen schenkt man weder Gehör noch Glauben. Ausgerechnet vom Pilgrim wird Forsberg gewaltsam befreit. Der Killer musste feststellen, dass man ihn ausschalten will. Die Annahme eines Komplotts liegt nahe. Pilgrims Nachforschungen ließen ihn auf Ben Forsberg stoßen, der ebenfalls als Sündenbock missbraucht wird.
Gemeinsam sollte es einfacher sein, die Intrige aufzudecken, denkt sich Pilgrim. Freilich hat er die Rechnung ohne den entsetzten Forsberg gemacht, der trotz seiner Abneigung gegen den übereifrigen Heimatschutz nicht gedenkt, mit einem Killer gemeinsame Sache zu machen. Die Realität belehrt ihn rasch eines Besseren: Sowohl die US-Behörden als auch gedungene Killer sind hinter ihm und Pilgrim her. So tun die beiden Männer sich zusammen. Während sie vor den allgegenwärtigen Verfolgern flüchten, suchen sie den Drahtzieher, der sie unbedingt tot sehen will …
_Das Leben schlägt (Leber-) Haken_
Ein einfacher Durchschnittsmensch lebt sein gewöhnliches Leben, bis ihn der Zufall in eine Krisensituation wirft, der er eigentlich nicht gewachsen ist. In der Not entdeckt unser profilarmer Zeitgenosse plötzlich den Tiger in sich; er flüchtet nicht mehr, sondern stellt sich den Gegnern, die nun ihr blaues Wunder erleben bzw. tief ins Gras beißen müssen: Diese Konstellation taugt für alle Unterhaltungs-Genres. Besonders gern wird sie im Thriller aufgegriffen, der aufgrund seiner Struktur, die in der Regel weniger auf komplexe Plots als auf Geschwindigkeit und Sachbeschädigung setzt, den Wechsel vom Alltag zum Chaos schnell und reibungslos bewerkstelligen kann.
Jeff Abbott geht auf Nummer Sicher und vergesellschaftet besagten Durchschnittsmann mit einem Berufsmörder. Damit dies die Mehrheit der Leser nicht abschreckt, sondern fesselt, mutiert der Pilgrim zum „guten Mörder“, der nur Strolche austilgt, die ihr Ende weidlich verdient haben. Auf diese Weise entlastet, kann er während regelmäßig in die Handlung eingebauter Verfolgungsjagden beinhart durchgreifen, die Funktionsweise immer neuer Waffen und Kampftechniken demonstrieren sowie bizarre Schlupfwinkel aufsuchen, die Geheimagenten anscheinend ebenso eifrig anlegen wie Eichhörnchen Verstecke für ihre Wintervorräte.
Was den Plot angeht, bildet „Run!“ eine Ausnahme vom reinen Highspeed-Thriller. Die Story ist so verwirrend wie die Realität des 21. Jahrhunderts. Das klingt wie eine Phrase und passt daher gut, da die Auflösung von Fronten typisch für das Genre ist. Nach dem Untergang des Ostblocks sind die politischen Verhältnisse ständig undurchsichtiger geworden. Thriller-Autoren bietet sich die Welt als Schlaraffenland potenzieller Schurken dar. Sie können sogar die ursprünglich ordnenden Kräfte einbeziehen, wie Jeff Abbott es im Vertrauen auf multimedial misstrauisch gestimmte Leser praktiziert: Politik, Geheimdienste und Militär sorgen zuverlässig für Skandale, die in erster Linie zu belegen scheinen, dass sich „Gut“ und „Böse“ in ihren Methoden so stark angenähert haben, bis eine Unterscheidung unmöglich wird.
|Im Gewirr moderner Gewalttäter|
Die genannten Gruppen wurden nicht durch Abbott erstmals in die Rollen von Bösewichten gesteckt. Ihm gelingt eine kleine aber immerhin neue Ergänzung: Das Outsourcing hat längst auch die US-Behörden, die Geheimdienste und das Militär erreicht. In den „Krieg gegen den Terror“ ziehen verstärkt private „Berater“ und „Sicherheitskräfte“. Sie werden von Firmen angestellt und betreut, die sich ihre Dienste fürstlich bezahlen lassen. Dies schont zwar weder das Staats- noch das Militärbudget, aber es schönt die Bilanzen: Kosten und Verluste tauchen nicht in jenen Statistiken auf, die von der lästigen Opposition und den Medien scharf beobachtet und kritisiert werden.
Privatwirtschaft und Krieg fanden erst in den letzten Jahrzehnten so harmonisch zusammen, wie sie heute und (hoffentlich) bei Abbott überspitzt auftreten. Der Pilgrim legt dar, was daran falsch ist: Kriege und der Kampf gegen den Terror sollten idealistisch unterfütterte Maßnahmen sein und ausschließlich geführt werden, um Gewalt zu beenden. Stattdessen hat sich ein Geschäft daraus und darum entwickelt, wobei es im Interesse der privaten Nutznießer liegt, dass die Welt nie wirklich friedlich wird. Der Pilgrim, ein desillusionierter Veteran, bekennt sich hier zu einer altmodisch wirkenden Ethik.
Abbott geht einen Schritt weiter: Die Geister, die sich die Regierung rief, wird sie nicht mehr los. Die böse Sicherheitsfirma infiltriert den US-Geheimdienst, um auf diese Weise sicherzustellen, dass sie zukünftig bei der Vergabe von Aufträgen berücksichtigt wird. Hier ist des Lesers Aufmerksamkeit gefragt, denn Abbott beginnt einen Hexenkessel getarnter, doppelt oder dreifach umgedrehter Agenten zu konstruieren, in dem die Übersicht nicht nur den Romanfiguren schnell verlorengeht.
|Ohne Burnusträger geht es nicht|
Geheime Gruppen innerhalb des Geheimdienstes, die von „außen“ ferngesteuert werden: Abbott treibt das Verwirrspiel auf die Spitze. Gleichzeitig mag er auf bewährte Schurken nicht verzichten. Die kommen in bzw. für die USA bevorzugt aus dem Nahen Osten. Sie werden von fundamentalistischen Mordbrennern, die dort an jeder Straßenecke konspirative Treffen abhalten, zu Attentätern ausgebildet, die anschließend rudelweise in die USA einsickern, um dort im Idealfall weitere Hochhaustürme zum Kippen zu bringen.
Abbott scheint den Drang zu verspüren, dieses Bild zu relativieren. Dabei begeht er eine verständliche aber dennoch unerfreuliche Sünde: Als Autor, der einen Unterhaltungsroman schreibt, beginnt er zu predigen. Jene eingeschobenen Kapitel, in denen der libanesische Ich-Erzähler Khaled seine Geschichte erzählt, sind für die Handlung absolut überflüssig. Khaled wurde vom jugendlichen Lebemann zum Agenten, nachdem seine Brüder bei einem Bombenanschlag umkamen. Dafür waren allerdings fanatische Landsleute verantwortlich, weshalb sich Khaled von der CIA (!) anwerben lässt: „Gute“ Araber kämpfen nicht gegen die USA, sondern treten in deren Dienste, um die wahren Strolche zu züchtigen. Hier kann Abbott offenbar nicht aus seiner US-amerikanischen Autoren-Haut.
|Tempo & Spannung mit einigen Tupfen|
Dabei ist dieses plumpe Bemühen um Völkerverständigung unnötig. „Run!“ ist vor allem und nichts anderes als eine spannende Geschichte. Abbott hat ein Gespür für Tempo und Timing, das er effektvoll für einen zwar überkomplizierten Plot aber eine rasante Handlung einsetzt. Geschickt orientiert er sich für seine Pilgrim-Figur am derzeit aktuellen Jason-Bourne-Vorbild, während er Ben Forsberg auf der Suche nach Gerechtigkeit nicht zum Amateur-Hulk ausarten lässt. Wenn die ungleichen Partner von Erinnerungen an vergangene Tragödien gebeutelt werden, übertreibt es der Verfasser nicht mit entsprechenden Klagegesängen, sondern schafft es in der Regel tatsächlich, ein paar tragische Zwischentöne ins Geschehen zu mischen.
Pläne gehen den Guten wie den Bösen schief, Fehler können korrigiert oder wenigstens überlebt werden. Zwar ahnt der Leser nicht nur, wie die Geschichte ausgehen wird, aber Abbott sorgt dafür, dass ihr Verlauf spannend ungewiss bleibt. Das Finale ist dramatisch sowie tragisch; beidem angemessen findet es in den Ruinen der 2005 durch den Hurrikan „Katrina“ verheerten Stadt New Orleans statt. Abbott hat hier ein Sinnbild für eine in Aufruhr und außer Kontrolle geratene Ordnung gefunden.
Ohne Zuckerstückchen für allzu aus dem seelischen Gleichgewicht gebrachte Leser kommt Abbott freilich nicht aus. Am Ende wird alles gut. Die Bösen sind tot oder werden zur Rechenschaft gezogen, die faulen Stellen innerhalb des Geheimdienstes sind ausgebrannt, die Agenten spitzeln nur mehr offiziell und unter Einhaltung gewisser Regeln den Feinden der Demokratie hinterher. Dafür, dass damit ein nicht gerade realistischer Zustand erreicht ist, versöhnen mehr als 350 Zuvor-Seiten mit spannender Unterhaltung.
_Autor:_
Jeff Abbott wurde 1963 im US-Staat Texas geboren. An der Rice University in Houston studierte er Geschichte und Englisch. Nach seinem Abschluss ging er in die Werbung und arbeitete in einer Agentur.
1994 erschien „Do Unto Others“, Abbotts Romandebüt. Dieser erste Band einer vierbändigen Serie um den Privatdetektiv Jordan Poteet war ein klassischer Krimi. Dies traf ebenso auf die zwischen 2001 und 2003 veröffentlichte Whit-Mosley-Trilogie zu.
Mit „Total Panic“ wechselte 2005 Abbott ins Thriller-Genre. Er spezialisierte sich hier und in den folgenden Romanen auf Durchschnittsmenschen, die unter Druck geraten und in der Krise unerwartete Widerstandskräfte entwickeln.
Mit seiner Familie lebt und arbeitet Jeff Abbott in Austin, Texas. Über sein Werk informiert er auf dieser Website: [Autorenhomepage]http://jeffabbott.com
|Taschenbuch: 480 Seiten
Originaltitel: Collision (New York : Dutton/The Pinguin Group USA 2008)/Run (London : Sphere Books 2008)
Übersetzung: Bea Reiter
Deutsche Erstausgabe: September 2009 (Wilhelm Heyne Verlag/TB Nr. 43440)
ISBN-13: 978-3-453-43440-0
eBook: Oktober 2009 (Wilhelm Heyne Verlag)
ISBN-13: 978-3-641-02792-6|
[www.heyne-verlag.de]http://www.heyne-verlag.de
Ed McBain – Fahr langsam übers Massengrab

Shatner, William/Fisher, David – William Shatner: Durch das Universum bis hierher. Die Autobiographie
_Von der Pike abwärts: Karriere mit Fehlzündungen_
Obwohl Shatner – gewollt oder unwillkürlich, weil es seine Art ist oder sein soll – in seiner autobiografischen Darstellung sprunghaft ist, gern zwischen Zeiten und Themen „springt“ und ein Faible für unterhaltsame aber ablenkende Anekdoten an den Tag legt, folgen seine Erinnerungen insgesamt einem chronologischen Faden. Sowohl der berühmte Kirk als auch der berüchtigte Shatner wurden 1931 in Kanada als Sohn eines jüdischen Billig-Schneiders geboren („Ein kleiner jüdischer Junge aus Montreal“). Die Herkunft und die Erinnerung an ständige Geldnot erwiesen sich als prägend. Immer wieder kommt Shatner auf seine Existenz-Ängste zurück, die ihn zwingen, praktisch jede Rolle anzunehmen, weil er fürchtet, ansonsten aus dem Geschäft zu sein.
William Shatner gehört zu einer Generation junger Nordamerikaner, die nicht mehr in den Zweiten Weltkrieg und in keinen der späteren US-Kriege ziehen musste. Nachdem er seine Liebe zu den darstellenden Künsten entdeckt hatte, konnte er sich ihnen deshalb kompromisslos widmen. Nach 1945 boomte die Unterhaltungsindustrie in Radio, Theater und Film. Hinzu kam wenig später das Fernsehen. Junge Darsteller fanden hier zwar keine hohen Gagen aber ein breites Betätigungsfeld („Anfänge im Radio und Fernsehen“, „Mr. Broadway erobert die Stadt“). Shatner schildert die Möglichkeiten, die freilich mit hartem Konkurrenzdruck einhergingen. Der junge Schauspieler musste seinen Job auf die harte Tour lernen. Er beging Fehler, traf falsche Entscheidungen, wurde hereingelegt – und arbeitete praktisch rund um die Uhr.
Ersten Erfolgen am Theater und im Fernsehen („Ein Star wird geboren“) folgten immer wieder Durststrecken und Routinerollen. Shatner gehörte zum Fußvolk seiner Zunft. Er spielte Gastrollen in beinahe sämtlichen Serien der 1950er und 60er Jahre, ohne dabei ein Profil zu entwickeln, das sein Wiedererkennen garantierte. Shatners „Karriere“ drohte deshalb zu versanden; 1966 war nach anderthalb Jahrzehnten harter Arbeit der Durchbruch weiterhin fern – und die Zeit lief gegen den nicht mehr ganz jungen Schauspieler.
_Der lange Weg zum Shatman_
Dies änderte sich auch nicht, als Shatner im genannten Jahr als Captain Kirk auf der Enterprise anheuerte („Der Weltraum – unendliche Weiten“). Für ihn war dies ein Job wie viele andere, weshalb es ihn weder überraschte noch erschütterte, als „Star Trek“ schon nach drei Jahren abgesetzt wurde. Shatner machte weiter wie bisher und registrierte nur nebenbei und ganz allmählich das Aufkommen des „Star-Trek“-Kultes. Währenddessen zog der Schauspieler geschieden und pleite per Wohnmobil von Drehort zu Drehort und nahm erst recht jeden möglichen und unmöglichen Job an („Shiva“).
In den 1970er Jahren erlebte Shatner privat und beruflich schwierige Zeiten. Die Erinnerung daran kann auch der betont humorvolle Ton nicht überdecken („I’m a rocket man!“). Erst die Neuauflage der klassischen „Star-Trek“-Serie im Kino brachte ihn endlich auf die Gewinnerseite. Shatner startete durch, nutzte den Ruhm und den Kult-Status der Kirk-Rolle, wurde Regisseur, Drehbuchautor und Produzent („Cop, Regisseur & Comedian“).
Anfang der 1990er Jahre heiratete Shatner zum dritten Mal. Der Ehe mit Nerine Kidd und ihrem tragischen, von den Medien gierig aufgegriffenen Ende widmet Shatner ein eigenes Kapitel („Notruf“). Dies gilt auch für den Tod seines Alter Egos („Kirks Ende“), dem zuzustimmen Shatner inzwischen als eine der zahlreichen Fehlentscheidungen seiner turbulenten Karriere betrachtet.
Die Autobiografie klingt in der Gegenwart aus, die William Shatner abermals verheiratet und beruflich erfolgreicher denn je erlebt. An den Ruhestand kann und will das rüstige aber bald 80-jährige Multi-Talent weiterhin nicht denken.
_Ein real phantastisches Leben_
Dass William Shatner seinem Erstaunen über das Erlebte und Überstandene immer wieder Ausdruck verleiht, können seine Leser nach der Lektüre dieser Autobiografie problemlos verstehen. Unabhängig von der (ohnehin aus der Ferne nicht zu beantwortenden) Frage nach seinen oft und gern angeprangerten Schauspiel- oder Charakterschwächen, ist Shatner nicht nur ein Veteran seiner Zunft, sondern ein Zeitzeuge, dessen Erfahrungen in Film, Fernsehen, Theater u. a. Darstellungsformen sechs Jahrzehnte umfassen. Shatner hat alles gemacht, er arbeitete als Schauspieler, Regisseur, Autor, Sänger oder Moderator.
Die Rolle als James T. Kirk erwies sich als Glücksfall seines Lebens. Oft wird Shatner auf den unternehmungslustigen Captain des Raumschiffs Enterprise reduziert und seine Privatperson mit ihm gleichgesetzt. Schaut man sich die unglaubliche Zahl von Figuren an, in die er schlüpfte, wird deutlich, dass Shatner mehr ist als der eitle, übertrieben agierende, viel zu jungen Frauen hinterherjagende Toupet-Träger, als den ihn jüngere Generationen kennengelernt zu haben glauben: Auf diese Weise bleibt man nicht 60 Jahre in einem äußerst schnelllebigen Geschäft aktiv oder gar erfolgreich.
Gleichzeitig ist Shatner ein cleverer Selbstvermarkter, der selbst die negativen Seiten seines Images für sich umzumünzen weiß. „Seine“ Autobiografie ist dafür ein perfektes Beispiel. Shatner firmiert als Autor; mit der Lupe muss man den Namen David Fisher suchen, der die Vorgaben des „Shatman“ in einen lesbaren Text verwandelt hat. Artig dankt ihm Shatner in seinem Vorwort für die „Mitarbeit“, entlarvt sich aber später als „Verfasser“ zahlreicher Romane mit der Information, stets nur Ideen für das grobe Gerüst einer Geschichte in den Raum zu werfen, aus denen anschließend „Co-Autoren“ ein weiteres Buch machen, das Shatner in „seine“ Literaturliste aufnimmt.
_Autobiografie mit Botschaft_
Selbstbewusst und sensibel, rücksichtslos und freundlich, gerissen aber nicht klug: So möchte sich Shatner dargestellt wissen. Er gibt vor, die Rolle des „Shatman“ nur zu spielen, was seine Kritiker im Gegensatz zu seinen echten Fans angeblich nicht begreifen. Shatner unterlegt seine Äußerungen und Aktionen gern mit einem Kontext, den er nachträglich erläutert. Eingestreute Geständnisse charakterlicher Schwächen sollen entwaffnend wirken. Nicht nur einmal gibt Shatner zu, dass Wahrheit für ihn auch ein Stoff ist, den er verformt und verdreht, um ihn für seine Zwecke zu nutzen. Gleichzeitig gibt er sich als Autobiograf betont offen und ehrlich, was er durch eine einfache, kumpelhafte, man könnte auch sagen: anbiedernde Sprache unterstreicht. Mit der Diskrepanz muss sich der Leser auseinandersetzen. Zur stetigen Verunsicherung tragen Shatners Abschweifungen bei, die oft in Hinweise auf die Verkaufsangebote auf seiner Website münden; der geschäftstüchtige Autor bedient sich hier jener Nachrede, er sei geizig und geldgierig.
Auf diese Weise spricht Shatner Vorwürfe selbst an, um sie dann zu „erklären“ und Stück für Stück zu entkräften. Als Biograf hält er auf diese Weise die Fäden auch dann noch fest in der Hand, wenn es in Lebensabschnitte geht, in denen Shatner keine gute Figur macht. Das schließt auch die Jahre der „Star-Trek“-Fernsehserie ein. Shatner räumt dieser Phase verständlicherweise breiten Raum ein. Dabei verhehlt er die Schwierigkeiten mit seinen Schauspielerkollegen oder mit dem Fernsehstudio nicht, übernimmt ein wenig Verantwortung, um anschließend die Dinge so zurechtzurücken, bis man ihn beinahe als Opfer übler Nachrede betrachten möchte.
Das Gedächtnis ist ein subjektiv arbeitendes Funktionselement des Hirns. Shatner hat früher einmal behauptet, ihm seien die „Star-Trek“-Jahre längst entfallen. Dafür wartet er in seiner Biografie mit erstaunlichen Details auf. Shatner hat Rollen in dreistelliger Zahl gespielt. Trotzdem scheint ihm jede Figur präsent zu sein. Ist dies „echtes“ Erinnern oder das Ergebnis nachträglicher Recherche, die als Erinnerung „getarnt“ wurde?
_Autobiografie eines Insiders_
Dieser Verdacht keimt während der Lektüre oft auf. Er mindert die positiven Seiten einer Autobiografie, deren Verfasser (nennen wir ihn der Einfachheit halber weiterhin so) Zeitzeuge einer Film- und Fernsehgeschichte „von unten“ ist. Vor allem der Fan des phantastischen Genres wird immer wieder über Shatner stolpern, der sowohl in der SF als auch im Horror zahlreiche und manchmal sogar tiefe Spuren hinterlassen hat. Shatner war und ist beileibe nicht nur Captain Kirk, sondern auch Bob Wilson in der klassischen „Twilight-Zone“-Episode „Terror at 20.000 Feet“ (1963), Mark Preston im Grusel-Heuler „The Devil’s Rain“ (1975; dt. angemessen dümmlich „Nachts, wenn die Leichen schreien“) oder Walter H. Bascom in der SF-Serie „TekWar“ (1995-96).
Ganz unten und ganz oben: Shatner ist seit sechs Jahrzehnten ein Teil der modernen US-Unterhaltungsindustrie. Selbst wenn er sich vor allem an und in Anekdoten erinnert, bliebt übergreifend Interessantes haften. Shatner kennt den Alltag vor und hinter der Kamera. Auf dieser Ebene liest sich seine Autobiografie nicht nur unterhaltsam, sondern liefert Hintergrundwissen aus einer Branche, die längst nicht so glanzvoll ist wie sie sich selbst gern gibt.
Unterm Strich offenbart sich der „Shatman“ so, wie er sich zu offenbaren gedenkt, während er völlige Ehrlichkeit suggeriert, um dies gleichzeitig zu relativieren. Dies sollte der Leser bedenken, der sich gleichzeitig auf eine oft interessante, unterhaltsame und dabei im positiven Sinn „leichte“ Lektüre einstellen kann.
_Autor_
William Shatner wurde am 22. März 1931 in der kanadischen Großstadt Montreal geboren. Er wurde schon in jungen Jahren Schauspieler und trat zunächst im Theater auf. 1956 ging Shatner in die USA und zum Broadway. Parallel dazu spielte er in zahlreichen TV-Dramen, die damals noch live gesendet wurden. Zwei Jahre später tauchte Shatner in „The Brothers Karamazov“/“Die Brüder Karamasow“ an der Seite von Yul Brunner und Maria Schell im Kino auf.
Der echte Durchbruch blieb aus. Viele Jahre spielte Shatner in Kinofilmen und TV-Shows der B- und C-Kategorie. Darin lieferte er trotz seiner theatralischen bis pathetischen Darstellungsweise durchaus achtbare Leistungen ab. 1966 bis 1969 folgte die Hauptrolle in der „Star-Trek“-Serie, die von einer weiteren Durststrecke und den für Shatner typischen Rollen in billigen Filmen und Fernsehserien gefolgt wurde. Erst die Rückkehr als Captain Kirk in den „Star-Trek“-Kinofilmen brachte ihm endlich Erfolg. Er nutzte ihn geschickt, um eine Karriere als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent in Gang zu bringen. Seine Aktivitäten als Schauspieler schränkte Shatner gleichzeitig keineswegs ein, versuchte sich als Sänger, wurde Pferdezüchter, gründete eine Firma für Spezialeffekte („Core Digital Effects“) und entwickelte schriftstellerische Ambitionen.
Auch im Alter denkt Shatner nicht an den Ruhestand. Er legt sich ein Arbeitspensum auf, das einen halb so alten Mann schrecken könnte (s. [www.williamshatner.com]http://www.williamshatner.com). In seiner Rolle als unwürdiger Greis besetzt er im Kulturleben der USA etwa dieselbe Nische wie hierzulande Dieter Bohlen oder früher Verona Feldbusch und hat sich als Trash-Ikone und Amerikas liebster Toupet-Träger eine solide Alterskarriere aufgebaut. William Shatner ist in vierter Ehe verheiratet und lebt heute in Südkalifornien und Kentucky.
|Gebundene Ausgabe:
Originaltitel: Up Till Now. The Autobiography (New York : Thomas Dunne Books/St. Martin’s Press 2008)
Übersetzung: Thorsten Wortmann
Deutsche Erstausgabe (geb.): Juli 2009 (Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag)
ISBN-13: 978-3-89602-879-2|
[www.schwarzkopf-schwarzkopf.de]http://www.schwarzkopf-schwarzkopf.de
_William Shatner bei |Buchwurm.info|:_
[„Sternendämmerung“ (Star Trek) 673
[„Sternennacht“ (Star Trek) 688
Goulart, Ron – Als alles auseinanderfiel
_Das geschieht:_
In diesen fiktiven letzten Jahren des 20. Jahrhunderts sind die USA schon vor etwa drei Jahrzehnten auseinandergebrochen. Unzählige Stadtstaaten sowie kleine und kleinste Territorien haben sie mehr oder weniger ersetzt. Sie werden von ideologisch oft extremen Splittergruppen beherrscht, die einander bekämpfen, Bündnisse schließen, in neue Fraktionen zerfallen und insgesamt für eine Gegenwart ohne übergeordnete Strukturen sorgen.
Im ehemaligen Großraum San Francisco genießt das „Private Inquiry Office“ eine gewisse Neutralität als vermittelnde Instanz, die von den meisten Gruppen akzeptiert wird. Die Mitarbeiter des PIO können gerufen werden, wenn das fragile Gleichgewicht der unterschiedlichen Kräfte gar zu sehr in Gefahr gerät. Aktuell sorgt eine Gruppe namens „Männermord“ für Unruhe. Unter der Führerschaft der mysteriösen „Lady Day“ überfallen, entführen und töten radikale Feministinnen Männer in einflussreichen Positionen.
Jim Haley begibt sich im Auftrag des PIO auf einen riskanten Außeneinsatz. Er soll Lady Day identifizieren und ihr Hauptquartier lokalisieren. Seine Mission verwandelt sich in eine irrwitzige Odyssee durch ein Land, das durch Anarchie und Chaos gekennzeichnet wird. Wo die „echte“ Mafia gegen die „Amateur-Mafia“ kämpft, Neo-Trapper sich Musketen-Gefechte mit afro-amerikanischen Klassenkämpfern liefern oder Überlebende des FBI ein Hotel nach geheimdienstlichen Vorschriften führen, bleibt Haley, der sich zwischenzeitlich in die schöne aber undurchsichtige Janey verliebt hat, hartnäckig auf seiner Spur, um schließlich die allgemeine Verwirrung auf einen neuen Höhepunkt zu treiben …
_Das Ende als neuer Anfang vom Ende_
Nach dem II. Weltkrieg schien in den USA nur der Himmel die Grenze des Machbaren darzustellen – und dies nur vorläufig, denn Anfang der 1960er Jahre verkündete Präsident Kennedy, es würden spätestens am Ende des Jahrzehnts Amerikaner auf dem Mond stehen; ein Vorhaben, das bekanntlich glückte. Ohne die Kommunisten wäre das Leben – zumindest für die Fleißigen, Angepassten & nicht Ausgegrenzten – mit Jobs im Überfluss, ökonomischer Weltherrschaft und Automobilen, die mehr als 20 Liter Sprit pro 100 km verbrauchen durften, das Paradies auf Erden gewesen.
Aber in diesen 1960er Jahren begann das scheinbar selbstzufrieden in sich selbst ruhende US-Imperium Risse zu zeigen. Alte Probleme waren nie gelöst, sondern nur verdrängt worden, neue kamen hinzu. Vor allem die Jugend ließ sich nicht mehr disziplinieren bzw. drangsalieren. Rassendiskriminierung, Krieg in Vietnam, bürgerkriegsähnliche Unruhen in zahlreichen Städten: Es gärte in den USA, während gleichzeitig alternative Lebensmodelle entstanden. Die Hippie-Bewegung fand das Interesse der Medien, aber das Aufbrechen als überkommen empfundener Alltagsmodelle wurde nicht nur von den Blumenkindern exerziert. Konservativ und progressiv, friedlich und paramilitärisch, anarchistisch und faschistoid: Diese Gruppen deckten das gesamte politische und soziale Spektrum ab.
Dass es nicht mehr so weitergehen konnte wie bisher, dämmerte auch jenen, die Angst vor Veränderung hatten. Spätestens die Ölkrise des Jahres 1973 kündigte das Ende des immerwährenden Aufschwungs an. Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung blieben keine Schlagwörter leicht zu ignorierender Öko-Freaks mehr, sondern wurden bittere Realität.
|Die Zukunft im Mixer der Gegenwart|
In einer so in Bewegung geratenen Gegenwart schuf Ron Goulart 1970 die „Fragmented-America“-Serie, deren erster Band „Als alles auseinanderfiel“ wurde. Goulart griff die herrschenden Verhältnisse und Umbrüche auf, mischte und extrapolierte sie. Es entstand ein „moderner“ Science-Fiction-Roman, der nicht mehr den menschlichen Triumphzug durch das Weltall feierte, sondern sich auf die alltäglichen Probleme des Heimatplaneten konzentrierte.
Um 1970 schien der Zusammenbruch der „alten“ Ordnung durchaus möglich. Was geschähe, sinnierte Goulart, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte? Wie könnte das Leben aussehen, würden die neuen, idealistischen Gruppen die Macht übernehmen? Als ernsthafter Visionär sah der Verfasser sich dabei nicht; diese Rolle überließ er anderen Schriftstellern. Goulart betrachtete sich als Satiriker, der die mögliche Zukunft überspitzt darstellen wollte. Auf diese Weise konnte er einerseits Grenzen ignorieren, während er andererseits ein größeres Publikum erreichte: Kritik wird problemloser zur Kenntnis genommen, wenn man sich dabei amüsieren kann. Ohnehin verschmäht Goulart auch den einfach „nur“ witzigen Effekt nicht, wenn er von Nudisten-Rabatten, an die Presse verkauften Aufständen oder widerspenstigen Robotern fabuliert.
|Die Schlange beißt sich in den Schwanz|
Goulart kommt in „Als alles auseinanderfiel“ zu dem Schluss, dass der Mensch nichts dazulernt. Die neue Welt ist trotz ihrer seltsamen Auswüchse grundsätzlich die alte geblieben. Faktisch treten höchstens Wesenszüge wie Hab- und Machtgier, Inkompetenz, Fanatismus oder Verblendung stärker hervor. Der Staat ist ein Kompromiss, der die gröbsten Spitzen politischer, juristischer oder kultureller Seitenwege nivelliert. Das „fragmentierte Amerika“ ist demgegenüber ein Konglomerat eigenbrötlerischer Splittergruppen, deren Handeln demonstriert, dass sie vor allem die eigenen Vorstellungen verwirklichen wollen. Sie haben keine Probleme damit, dies auf Kosten anderen und außenstehender Menschen zu tun. Das einende Element scheint dem Verfasser die allgegenwärtige Bestechlichkeit zu sein.
Als Autor vertritt Goulart eine zumindest latent konservative Haltung. Ohne zentrale Ordnungsmacht oder -kraft bricht das Chaos aus. Auf die Idealisten oder gar die selbst ernannten Retter darf man nicht zählen. Stattdessen bekommen alte Krisengewinnler wieder Oberwasser. Jim Haley führt uns durch diese aus den Fugen geratene Welt wie einst Alice durchs Wunderland. Der Plot ist Nebensache, die Suche nach der „Lady-Day“-Bewegung hält die Handlung nur in Gang. Haley soll mit möglichst vielen Gruppen Kontakt aufnehmen, um dem Leser die Heterogenität dieser Zukunft vor Augen zu führen.
Das in der SF oft dominierende technische Moment dient Goulart höchstens als Verstärker in der Darstellung des allgemeinen Durcheinanders. Von Hightech ist in diesem Amerika keine Rede mehr. Goulart liebt Geräte und Roboter, die ihre Funktionalitäten quasi ins Gegenteil verkehrten und dem Menschen nicht Diener, aber auch nicht Herren, sondern in erster Linie lästig sind. Sie unterstreichen das Chaos, in das sie sich so problemlos fügen, dass man sie – zumindest im Fall der Roboter – von den Menschen kaum noch unterscheiden kann.
|Chaos endet – vorläufig|
„Als alles auseinanderfiel“ unterhält heute primär als oft altmodische aber grundsätzlich noch funktionierende Geschichte. Der Humor ist hauptsächlich trocken und konnte sich ebenfalls erhalten. Viele der von Goulart karikierten Missstände haben im Kern ihre Daseinsberechtigung bewahren. Was von der Zeit eingeholt wurde, amüsiert als Gruß einer vergangenen Zukunft. Der historisch bewanderte Leser freut sich darüber hinaus über das geistreiche oder wenigstens gelungene Spiel mit historischen Realitäten.
Das politische und kulturelle Tauwetter währte in den USA keine zehn Jahre. Es endete spätestens 1981 mit der Präsidentschaft Ronald Reagans, der perfekt die Rückkehr zu den „alten Werten“ symbolisierte. In genau diesem Jahr schloss Ron Goulart seine „Fragmented-America“-Serie mit ihrem fünften Band ab. Zu diesem neuen Amerika fiel ihm offenbar nichts Komisches mehr ein.
_Autor:_
Ron Goulart wurde am 13. Januar 1931 in Berkeley im US-Staat Kalifornien geboren. Der Sohn eines Fabrikarbeiters studierte an der Universität ebendort und ging anschließend in die Werbung, was für seine spätere Aktivität als Schriftsteller prägend wurde. Schon 1952 erschien mit „Letters to the Editor“ eine erste Science-Fiction-Story, doch es dauerte bis 1960, bevor Goulart Vollzeit-Autor wurde.
Als solcher beschränkte er sich keineswegs auf die Phantastik, sondern veröffentlichte auch zahlreiche Kriminalromane. Goulart textete außerdem für Comics wie „Vampirella“ und „Star Hawks“. Unter diversen Pseudonymen schrieb er darüber hinaus für Serien wie „Avenger“ (als Kenneth Robeson), „Flash Gordon“ (als Con Steffanson), „Phantom“ (als Frank S. Shawn) oder „Kampfstern Galactica“ und griff William Shatner hilfreich beim ersten Band der „TekWar“-Serie unter die Arme.
In denjenigen SF-Romanen und Kurzgeschichten, die unter seinem eigenen Namen erschienen, gab Goulart sich gern satirisch oder wenigstens humorvoll. Vor allem Maschinen mit Fehlfunktionen haben es ihm angetan, doch Goulart vermag auch den Wahnsinn im „Menschen“ heraufzubeschwören, wie er mit seiner sehr beliebten Serie um das Chamäleonkorps bewies, dessen Mitglieder ihre Gestalten verändern können, was ihnen ermöglicht, auch und gerade bizarre Missionen zu übernehmen.
|Taschenbuch: 160 Seiten
Originaltitel: After Things Fell Apart (New York : Ace Books 1970)
Deutsche Erstausgabe: 1973 (Wilhelm Goldmann Verlag/Goldmann SF 0180)
Übersetzung: Jürgen Saupe
Cover: Ron Kirby
ISBN-13: 978-3-442-23180-5|
[www.randomhouse.de/goldmann]http://www.randomhouse.de/goldmann
Sterling Noel – Die Fünfte Eiszeit
_Das geschieht:_
Ein kalter, verregneter Frühling hat es schon angekündigt, aber dennoch erwischt es die Republik Nordamerika buchstäblich kalt, als im Spätsommer 2203 eine neue Eiszeit einsetzt. Schneefälle und Minustemperaturen jenseits aller Erträglichkeit lähmen die gesamte Erdzivilisation und bringen sie schließlich zum Zusammenbruch. Kaum eine Million Nordamerikaner überleben das Fiasko. Ihre einzige Chance bedeutet der Zug in die schmalen Landstriche, die am Erdäquator vom Eis und von der schlimmsten Kälte verschont blieben. Doch der Weg dorthin ist weit, gefährlich und strapaziös.
Dr. Gabriel Harrow, Meteorologe und Nobelpreisträger, muss die Erfahrung machen, von seiner Regierung ignoriert zu werden, als er ein baldiges Ende der Eiszeit für unmöglich erklärt. So beschließt er, kluge Köpfe, Freunde und einige Arbeiter fürs Grobe um sich zu scharen, eine fahrbare Miniatur-Arche zu bauen und wohl ausgerüstet gen Süden zu reisen. Victor Savage, ein ehemaliger Soldat und Harrows Schüler, übernimmt das Kommando.
Über bald kilometerdickes Eis und durch Schneestürme kämpft sich die kleine Gruppe voran. Hin und wieder treffen sie auf andere Überlebende, von denen sich jedoch kaum jemand anschließen mag. Die Strapazen der Reise werden geschürt durch interne Querelen. Geile Töchter, dumme Kerls, überschnappende Ausländer und Meuterer sorgen dafür, dass sich die Harrow-Gruppe stetig dezimiert. Aber man schlägt sich bis an die Atlantikküste durch, wo man hofft, ein Schiff zu bemannen und Brasilien ansteuern zu können …
_Apokalypse in Abschnitten_
Zur Abwechslung lösen also nicht die bösen Sowjets erst den Dritten Weltkrieg (atomar) und dann den Untergang der Erde aus. (Tatsächlich hat man bereits WK Nummer IV hinter sich; die Chinesen warens!) Das Wetter ist es, das verrücktspielt. Als dieser Roman entstand, war noch nicht Umweltverschmutzung mit nachfolgender Global-Erwärmung der Auslöser; dies waren damals nur Themen für Eierköpfe und Konsum-Spielverderber. Stattdessen muss die Erde durch ein kosmisches Staubfeld sausen, das für die dramaturgisch erwünschte Abkühlung sorgt.
Verfasser Sterling Noel holt aus der Kulisse der in Eis und Schnee erstarrenden Erde viel heraus, wobei er sich ungeschickt auf einen Ausschnitt des Geschehens beschränkt. Von den Tragödien, die der Zusammenbruch mit sich bringt, erfahren die Personen der Handlung ebenso wie die Leser nur zufällig und indirekt durch TV-Sendungen und Funksprüche, später durch den Besuch von Orten, an denen sich Schauerliches meist schon abgespielt hat.
Obwohl die Erde friedlich einfriert, ist „Die Fünfte Eiszeit“ (Nr. 1-4 sind übrigens die uns bekannten Eiszeiten der Vergangenheit) eine „Post Doomsday“-Geschichte, wie sie genau in die Zeit des Kalten Krieges zwischen den Supermächten USA und UdSSR (plus andere rote Schurkenstaaten) passt, zu der bereits den Schulkindern das Verhalten bei einem Atomschlag eingeübt wurde. Insofern stellt „Die Fünfte Eiszeit“ eine weitere Lektion dar. Wenns tatsächlich mal schiefgehen sollte mit dem Gleichgewicht des Schreckens, musste das nicht das Ende bedeuten; einige starke Männer & Frauen konnten durchaus überleben. Tröstlich, nicht wahr?
|Sie streiten viel und lernen wenig|
Die Figurenzeichnung kann mit der fast dokumentarisch präsentierten Handlung nicht mithalten. Noel präsentiert uns eine denkbar unsympathische Gruppe. Harrow und die Seinen klinken sich aus der Rettung dieser Welt aus, weil die dumme Regierung nicht auf sie hören will. Stattdessen bunkern sie sich an einem zunächst sicheren Ort ein, nutzen ihren Informationsvorsprung, um sich mit Technik und Lebensmitteln einzudecken, sorgen ausschließlich für ihr eigenes Wohl und entdecken ihre Nächstenliebe erst wieder, als das Kind in den Brunnen gefallen ist bzw. die meisten Menschen tot sind.
Das ist vermutlich realistisch. Auch die Auseinandersetzungen innerhalb der Gruppe wirken überzeugend. Angst und Dauerkrisen locken einerseits die guten Eigenschaften des Menschen hervor. Andererseits aber auch nicht, was Noel zum Teil anschaulich in fast unwirklichen Szenen zu schildern weiß. Sie zeigen immer wieder Menschen, die über die Katastrophe zu triumphieren versuchen, indem sie diese schlicht ignorieren.
Positiv fällt weiterhin der grimmig-realistische Tenor dieser Geschichte auf. Sicherheit gibt es weder für die Protagonisten noch für die Leser. Immer wieder müssen wir uns überraschend von (halbwegs) lieb gewonnenen Charakteren verabschieden: Die Apokalypse verschont nicht einmal jene, die sich an die neuen Spielregeln halten.
|Expedition der Klischee-Exemplare|
Andererseits stellt sich Noel allzu oft selbst ein Bein, indem er sich auf die bekannten Klischees des Katastrophen-Romans verlässt. Seine Darsteller bilden einen schematischen Querschnitt durch die Bevölkerung. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass jede gesellschaftliche Schicht (oder wenigstens die relevanten Kasten) ihre Identifikationsfigur bekommt, was dem Erfolg des Werkes nur zuträglich sein kann.
Also treten auf: Schwächlinge und Verräter. Hier bilden u. a. eine liebestolle Farmerstochter, ein disziplinloser Mechaniker oder ein amoklaufender Araber (ja, ja, die Ausländer …) die Gegner der hart für das Überleben der Gruppe schuftender Militärs und Wissenschaftler. Zum Wohle der Gemeinschaft ist hart durchzugreifen, was es manchmal auch erforderlich macht, einen ganz üblen Schurken mit der Strahlenkanone hinzurichten. Es muss sein – und stellt Euch schon einmal darauf ein, liebe Leser, dann seid auch Ihr bereit, sollten Euch ähnliche Katastrophen heimsuchen!
So wird jedenfalls im Zeitalter des Kalten Krieges sacht mit dem Schlimmsten gerechnet. Wenn es ganz dick kommt, werden und dürfen nur die Besten überleben: entschlossene Führergestalten und junge, starke Männer, die ihnen folgen; dazu noch jüngere Frauen, die treu zu ihnen halten und zukünftige Generationen von Pionieren (und Soldaten) gebären …
_Autor:_
Es gibt kaum Informationen über Noel Sterling (1903-1984) im Internet. Ein typischer Magazin- und Taschenbuch-Autor der ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg ist er wohl gewesen, der alle Sparten der Unterhaltungsliteratur bediente und neben weiteren Science-Fiction-Romanen u. a. Krimis schrieb. Gemeinsam ist seinen Werken die inhaltliche Anlehnung an wirklich originelle oder doch wenigstens beliebte Vorbilder. Dass er diese zwar handwerklich kompetent, aber eher mechanisch kopiert, trug sicherlich entscheidend dazu bei, ihn zu einem vergessenen Autor werden zu lassen.
|Taschenbuch: 154 Seiten
Originaltitel: We Who Survived (New York: Avon Books 1959)
Übersetzung: Fritz Moeglich
Deutsche Erstausgabe: 1962 (Wilhelm Heyne Verlag/Allgemeine Reihe Nr. 267, neu aufgelegt als Heyne Science Fiction Nr. 06/3022)
ASIN: B0000BM0ZE|
[www.randomhouse.de/heyne]http://www.randomhouse.de/heyne
Hill, Susan – Gemälde, Das. Eine Geistergeschichte
_Das geschieht:_
Dr. Theo Parmitter, in der englischen Elite-Universität Cambridge als Kunsthistoriker berühmt und inzwischen alt geworden, erzählt seinem ehemaligen Studenten und Freund Oliver von einem rätselhaften Bildnis, das er vor Jahrzehnten erwarb und welches seitdem sein Leben beeinflusst und beeinträchtigt. Es entstand 1797 und zeigt eine venezianische Karnevalsgesellschaft. Verkleidete Personen tummeln sich in und vor Palästen und Kanälen – ein eigentlich unverfängliches, ja triviales Motiv, das hier jedoch eine unheimliche Sogwirkung auf den Betrachter ausübt.
Parmitter kennt die Geschichte des Gemäldes, seit ihn die Gräfin von Hawdon darüber in Kenntnis setzte. Sie hatte in ihrer Jugend Lawrence, den Grafen, kennen und lieben gelernt. Doch der Edelmann hatte bereits der schönen Clarissa Vilgo die Ehe versprochen. Von ihrem Bräutigam sitzen gelassen, schwor sie bittere Rache. Zur Hochzeit schickte sie dem Paar besagtes Bild, das die Gräfin sofort in Angst und Schrecken versetzte. Als sie mit ihrem Gatten wenig später eine Italienreise unternahm, verschwand dieser in Venedig unter mysteriösen Umständen. Kurz darauf musste die Gräfin entsetzt feststellen, dass sich das Gemälde selbstständig um eine Szene ergänzt hatte, die ihren Ehemann als hilfloses Opfer einer Entführung zeigte.
Die böse Clarissa ist längst tot, aber ihr Geist scheint das Bildnis weiterhin zu beleben. Parmitter spürt seinen unheilvollen Einfluss, und auch Oliver ist nicht immun. Obwohl Clarissas Rache vollendet wurde, blieb ihr Zorn ungebrochen. Er richtet sich nunmehr gegen die Besitzer des Gemäldes, wie Parmitter und später Oliver zu ihrem Leidwesen erfahren müssen …
_Schaurig schöner Grusel ist zeitlos_
Die „gotische“ Geistergeschichte ist ein Kind des 18. Jahrhunderts. Mit ihrer Vorliebe für offensiv schaurige Schauplätze wie Burgruinen, Friedhöfe oder verwunschene Landhäuser konnte sie nicht nur die zeitgenössischen Leser fesseln. Formal und inhaltlich einer angenehm schauerlichen Vergangenheit zugewandt, fand sie ihr Publikum auch im 19. und frühen 20. Jahrhundert, zumal sich wahre Meister der Phantastik ihrer annahmen.
Einer der größten Geisterbeschwörer der Schriftsteller-Zunft war Montague Rhodes James (1862-1936). Seine gleichzeitig schnörkellosen und wunderbar ziselierten, auf den größtmöglichen Effekt hinarbeitenden, nie rührseligen oder abschweifenden und vor allem von durchweg bösartigen Gespenstern bevölkerten Geschichten haben bis heute nichts von ihrer Wirkung verloren. Ihr Alter ließ sie nicht verstauben, sondern nostalgisch glänzen.
M. R. James fand bereits zu seinen Lebzeiten zahlreiche Bewunderer und Nachahmer. Es bildete sich eine regelrechte „James-Gang“, die Geistergeschichten seines Stils verfassten. Auch nach dem Tod des Meisters entstanden und entstehen solche Storys. Dass James‘ Einfluss noch heute stark ist, belegt jetzt Susan Hill mit ihrem Kurzroman „Das Gemälde“. Es ist nicht ihr erster Versuch, den Grusel à la James aufleben zu lassen. Zuvor erschienen bereits „The Woman in Black“ (1982; dt. „Die Frau in Schwarz“) und „The Mist in the Mirror“ (1992; dt. „Das Gesicht im Spiegel“).
|Das Böse überlebt seinen Wirt|
Das Wissen um James‘ Definition des Gespenstes als durchweg böse Kreatur ist wichtig zum Verständnis von „Das Gemälde“. Ansonsten irritiert das Konzept eines Geistes, der Verderben sät, obwohl der Grund seines Zorns längst nicht mehr existiert. Clarissa Vigo hat jene erwischt, die sie hasste. Entweder wurde sie darüber so verrückt, dass ihr Hass alle Menschen einschloss, oder sie musste ihren Preis zahlen: Das Instrument ihrer Vergeltung – das titelgebende Gemälde – hat sich ihrer bemächtigt. Nun muss Clarissa ihm auf ewig neue Opfer zutreiben.
Dieses gnadenlose Prinzip hat James mit großem Geschick und gleichzeitig voller Witz immer wieder variiert. Susan Hill belegt, wie gut er darin war, wobei dies garantiert unfreiwillig geschieht: „Das Gemälde“ bedient sich der typischen Elemente einer James-Geistergeschichte, ohne jedoch deren Geschlossenheit und vor allem Wirkung jemals zu erreichen.
Hauptsächlich verursacht dies ein Plot, der höchstens eine Kurzgeschichte tragen könnte. Selbst ein Kurzroman wiegt zu schwer für die Grundidee, die Hill deshalb doppelt erzählt: Hat Theo Parmitter gerade von seinen Erlebnissen mit dem Gemälde berichtet, schließt sich die sehr ähnliche Geschichte der Gräfin von Hawdon an. Hill fabuliert über Personen und Ereignisse, die dem zentralen Element – dem Gemälde – nichts Wesentliches beizutragen haben. Der Bericht der Gräfin ließe sich problemlos mit der Erzählung Parmitters verschmelzen. Dann könnte die Autorin allerdings keinen Text vorlegen, der sich zu einem eigenen Buch binden ließe.
|Stimmung ist nicht alles|
Keinem kurzen Roman bekommt es, wenn die Handlung im Mittelteil auf der Stelle tritt. „Das Gemälde“ ist auch sonst keine Geschichte, die fesseln oder gar erschrecken kann. Als Leser bewundert man Hills handwerkliches Geschick, mit der sie eine klassische Erzählform aufleben lässt. Die Autorin lässt Feuer prasseln, während vor dem Fenster Herbststürme heulen; es knarrt und wispert in alten, großen, nur scheinbar leeren Häusern. Wenn das Böse zuschlägt, geschieht dies stets ein wenig außerhalb des Blickfelds, sodass grausige Wahrheit und Täuschung eine trübe, die Unsicherheit fördernde Mischung eingehen.
Was nützt jedoch alle Atmosphäre, wenn ihr keine angemessene Handlung zu Grunde liegt? Das Grauen eines Gemäldes, das seine Opfer abbildet, teilt sich dem Leser nur bedingt mit. Die mehrfache Wiederholung dieses Effektes wirkt zusätzlich kontraproduktiv. Hinzu kommt der Verlauf einer Handlung, die jeglicher Überraschung abhold ist. Es kommt in dieser Geschichte, wie es kommen muss aber nicht müsste, würde Hill mit eigenen Einfällen vom Weg abweichen. James konnte dies, und er tat es gern. Vor allem verkniff er sich jene Sentimentalitäten, die Hill einfließen lässt, die hier ihrem zweiten Vorbild Reverenz erweisen möchte: Daphne du Maurier (1907-1989), deren mit Gefühlen und Gefühlsduseligkeiten prall gestopftes Hauptwerk „Rebecca“ (1938) Hill 1993 mit „Mrs. de Winter“ (dt. „Rebeccas Vermächtnis“) fortsetzte.
Doch James und du Maurier passen nicht zusammen. „Das Gemälde“ ist eine formal gelungene und (auch in der Übersetzung) gut lesbare Fingerübung, die inhaltlich keinen Eindruck hinterlässt. Was bleibt, ist ein gebundenes Bändchen, das wohl (schon in seiner englischen Ausgabe) vor allem als hübsches aber kostengünstiges Geschenk – das Buch zum Tee-Service? – konzipiert wurde.
_Autorin:_
Susan Hill wurde 1942 im englischen Scarborough, North Yorkshire, geboren. Die Familie zog Ende der 1950er Jahre nach Coventry um. Hill studierte am King’s College in London Englisch. Noch bevor sie 1963 ihren Abschluss machte, veröffentlichte sie 1961 ihren Roman-Erstling „The Enclosure“, der aufgrund seiner sexuellen Offenheit großes Aufsehen erregte.
Hill arbeitete ab 1963 als Journalistin. In den 1970er Jahren heiratete sie, gründete eine Familie und etablierte sich als Autorin. Ihr mehrfach preisgekröntes Werk schließt „hohe“ Literatur ebenso ein wie Kriminalromane (darunter eine mehrbändige, auch in Deutschland erfolgreiche Serie um den Polizeibeamten Simon Serailler), Geistergeschichten, Kinderbücher oder Autobiografien.
Jährlich erscheint durchschnittlich ein neuer Titel, den Hill seit 1998 meist in ihrem eigenen Verlag „Long Barn Books“ herausbringt. Die Autorin lebt und arbeitet heute in Cotswold, einem Distrikt der englischen Grafschaft Gloucestershire.
|Hardcover: 158 Seiten
Originaltitel: The Man in the Picture. A Ghost Story (London : Profile Books 2007)
Übersetzung: Susanne Aeckerle
Deutsche Erstausgabe (geb.): Oktober 2009 (Knaur Verlag/Nr. 66350)
ISBN-13: 978-3-426-66350-9|
[www.droemer-knaur.de]http://www.droemer-knaur.de
[www.susan-hill.com]http://www.susan-hill.com
_Susan Hill bei |Buchwurm.info|:_
[„Der Menschen dunkles Sehnen“ 1698
[„Des Abends eisige Stille“ 3889
[„Der Seele schwarzer Abgrund“ 5348
[„Der Kampf um Gullywith“ 5954
Bass, Bill / Jefferson, Jon – Eine Hand voll Asche
_Das geschieht:_
Viel Arbeit und Aufregung warten auf Dr. Bill Brockton, Leiter des Anthropologischen Instituts der University of Knoxville im US-Staat Tennessee, der außerdem oft von der Polizei oder den Justizbehörden zu Rate gezogen wird, wenn es gilt, einer durch Verwesung oder anderweitig den normalen Untersuchungsmethoden der Kriminologie entzogenen Leiche das Geheimnis ihres Todes zu entlocken. Als Gründer der berühmt-berüchtigten „Body Farm“, auf deren Gelände das Verrotten von Menschenkörpern studiert wird, ist er darin zum Meister avanciert.
Dr. Edelberto Garcia, der Medical Examiner von Knox County, bittet ihn um Rat in einem möglichen Mordfall. In einem ausgebrannten Autowrack wurde die Leiche von Mary Latham gefunden. Sie wurde womöglich von ihrem Gatten ermordet, doch das Feuer hat offenbar sämtliche Indizien vernichtet. Brockton entdeckt, dass die Frau schon Tage tot war, bevor sie verbrannte, was die Ermittlungsarbeit noch kompliziert, denn der Gatte hat für den in Frage kommenden Zeitraum ein ausgezeichnetes Alibi.
Zunächst als Gefallen beginnt Brockton Nachforschungen für den Strafverteidiger Burt DeVries. Er wurde von seinem Onkel alarmiert, nachdem dieser in der Asche seiner feuerbestatteten Gattin deren künstlichen Kniegelenke vermisste. Brockton soll klären, was in dem Bestattungsinstitut falsch gelaufen ist. Stattdessen kommt er einem anrüchigen aber lukrativen Betrug auf die Spur.
Schließlich wird Brockton von der Vergangenheit eingeholt. Im Vorjahr hatte ein alter Widersacher, der Gerichtsmediziner Garland Hamilton, erst seine Lebensgefährtin umgebracht und dann versucht, Brockton als Mörder zu diskreditieren (s. „Bis auf die Knochen“). Hamilton wurde gefasst und wartete im Untersuchungsgefängnis von Knox County auf seinen Prozess. Jetzt ist er entkommen und spurlos verschwunden; man muss damit rechnen, dass er seine noch offene Rechnung mit Brockton endgültig zu begleichen versucht …
_Scheußlich genug gibts gar nicht_
|O tempora, o mores| … Viele Jahre haben sie ihre wichtige und verantwortungsreife Arbeit im Schutze abgelegener Labors geleistet. Zum Vorschein oder gar ans Licht der Öffentlichkeit gerieten sie höchstens, wenn sie als Sachverständige vor Gericht geladen wurden, wo sie sich so lange mit komplizierten Fachausdrücken artikulierten, bis den Geschworenen die Köpfe schwirrten. Kaum zu glauben, dass ausgerechnet die Zunft der Gerichtsmediziner heutzutage regelrechte Medienstars hervorbringt.
Wie so oft verdanken sie ihren Aufstieg den Medien. In den 1990er Jahren wurde die ehemalige Polizeireporterin Patricia Cornwell mit ihrer Serie um die Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta zur Bestseller-Autorin und folgerichtig zur Wegbereiterin unzähliger vom Erfolg des Themas „inspirierter“ Schriftsteller. Bald wurden Film und vor allem Fernsehen aufmerksam. Spätestens der phänomenale Siegeszug der „CSI“-Serien und ihrer Nachzügler schufen dem jungen Sub-Genre ein solide zementiertes Fundament, auf dem – der Kreis schließt sich – auch die Sachbücher ruhten, mit denen mancher alte Forensiker-Kämpe sich seinen Teil vom Kuchen sicherte.
|Leichen sind sexy|
Zu ihnen gesellte sich 2004 William M. Bass, der zwei Jahre nach einer (ersten) Autobiografie mit seinem Co-Autor Jon Jefferson die Erfahrungen seiner langen Karriere lukrativ trivialisierte. Die Realität dient den Romanen um Dr. Bill Brockton als Vorlage. Sie wird primär dort variiert bzw. vereinfacht, wo es der Handlung dienlich ist. Da das Leben selbst bekanntlich die besten Ideen liefert, werden Bass die Einfälle für weitere Bände der erfolgreich gewordenen Serie sicher nicht ausgehen – für ihn ist quasi Alltag, was den lesenden Laien aus sicherer Entfernung angenehm gruselt.
Denn Leichen faszinieren, wenn man ihrem Anblick gefiltert durch bedrucktes Papier oder die Mattscheibe ausgesetzt wird. Das Interesse am toten Körper ist durchaus verständlich, da der Mensch neugierig ist und wissen möchte, was nach dem unausweichlichen Ende mit ihm geschehen wird. Die Begeisterung über die Leiche als Archiv aus Fleisch, Knochen & Blut, das Informationen über Leben und Tod buchstäblich speichert, wird noch gesteigert, wenn letzterer durch ein Verbrechen verursacht wird. Was Polizei und Justiz verborgen bleibt und den Mörder entkommen lässt, kann der Gerichtsmediziner womöglich dechiffrieren, weil er über die notwendigen Schlüsselkenntnisse verfügt.
Die realiter langwierige und langweilige Routinearbeit im Labor wird dabei gerafft bzw. unterhaltsam aufbereitet. Was eigentlich lange währt, bricht deshalb gern in Gestalt plötzlicher Geistesblitze über einen ohnehin latent genialen Dr. Brockton herein, der sich außerdem auf einen Stab ihm verbundener bis höriger Mitarbeiter und Zuträger stützt, die Recherche- und Laufarbeiten für ihn erledigen, der sich – zum Vorteil der Leserschaft – auf die zentralen Ereignisse konzentrieren kann.
|Heißer Sommer in Tennessee|
Für diejenigen Leser, die von einem Kriminalroman mehr als das Stochern in Leichen und Knochenresten erwarten, zeigt sich genau darin der Schwachpunkt. „Eine Hand voll Asche“ ist ein Thriller ohne straff gespannten roten Faden. Gleich drei Plots sollen für Spannung sorgen, zwischen denen Hauptdarsteller Brockton ruhelos hin und her mäandert. Die Handlung zerfällt in Episoden, die nie wirklich zueinander finden. Sie werden durch die Figur des Dr. Brockton verklammert, der zwar in Gefahr gerät aber niemals den Boden unter den Füßen verliert. Seine inneren und äußeren Konflikte wirken aufgesetzt; sie berühren die recht langweilige Figur kaum. Die dramatischen Ereignisse folgen einschlägigen Klischees und sind niemals wirklich überraschend. Besonders missglückt ist die Wiederkehr des Garland Hamilton, der in einem plump inszenierten Finale wie eine literarische Altlast verklappt wird.
Die Lücken zwischen dem, was eigentlich eine stringente Handlung bilden sollte, füllt Autor Bass mit wissenschaftlich abgespeckten Vorträgen über sein Fachgebiet (s. o.) oder Auszügen aus dem Handbuch für den modernen Feuerbestatter. Im Anhang werden Zeichnungen des menschlichen Skeletts abgebildet, die wohl vor allem dem Leser die Lektüre eines Romans vorgaukeln sollen, aus dem er (oder sie) etwas lernen können. Stattdessen setzt Bass unverhohlen auf den Grusel- und Ekel-Effekt dieser Szenen und hofft, das Durchhängen der Handlung auf diese Weise zu übertünchen.
Wenn alle Stricke reißen, schiebt Bass einen Besuch auf Brocktons „Body Farm“ ein. Die gibt es tatsächlich, und dort verrotten Leichen zum Nutzen von Forschung und Kriminologie unter freiem Himmel, in Tümpeln, Kofferräumen sowie überall dort, wo ihr Studium Rückschlüsse auf reale Todesfälle gestattet. Vor allem die Medien haben den Geisterbahn-Faktor dieses Ortes gierig aufgegriffen und ausgeschlachtet, aber auch William M. Bass, ihr Gründer, nutzt ihn, um die Werbetrommel für die Forensik zu rühren.
|Sie mögen ihn trotzdem|
Was macht die mittelmäßigen Brockton-Krimis so erfolgreich? Wahrscheinlich genau das: Sie erfüllen ihren Unterhaltungszweck ohne Ecken und Kanten, ohne Widerhaken, an denen ein auf feierabendliches Lektürevergnügen geeichter Leser hängenbleiben kann. Freundlich und flüssig spult der Verfasser seine Handlung ab, würzt sie mit gar erschröcklichen aber nie schockierenden Gruseleien und schmeckt das Ergebnis mit freundlich-unverbindlicher „buddy“-Atmosphäre ab, für die Büro-Inventar Miranda, Kumpel Art Bohanan oder Sohn Jeff zuständig sind. Auf diese bewährte Weise kann Jefferson Bass sein Garn geruhsam und vor allem noch lange weiterspinnen!
|Anmerkung|
Wer übrigens meint, Bass habe es übertrieben mit der Schilderung eines Bestatters, der seine tote „Kundschaft“ wie Abfall in seinem Hinterhof stapelt, irrt gewaltig. Die Realität schlägt weiterhin jede Fiktion: Bass erzählt quasi nach, was die schockierte Polizei 2002 auf dem Gelände des Tri-State-Krematoriums im US-Staat Georgia entdeckte – ein Fall, der inzwischen u. a. für die TV-Serie „CSI Las Vegas“ aufgegriffen wurde.
_Autor/en:_
William M. Bass (III.) wurde 1928 in Staunton (US-Staat Virginia) geboren. Er studierte Psychologie an der University of Virginia. Nach seinem Abschluss 1951 leistete Bass seinen Wehrdienst bei der US Army. 1953 ging er an die University of Kentucky und studierte Anthropologie; den Doktortitel in diesem Fach verlieh ihm 1961 die University of Pennsylvania. Bass wechselte ins Lehrfach. Zwischen 1960 und 1971 lehrte er an der University of Kansas, bevor ihn die University of Tennessee die Leitung des Anthropologischen Fachbereichs übertrug. Bis zu seiner Emeritierung (1995) hatte Bass diese Position inne; darüber hinaus war er von 1992 bis 1994 Direktor des „Forensic Anthropology Center“.
Seine einschlägigen Kenntnisse ließen Bass zum oft frequentierten Berater des FBI avancieren, der an der Lösung zahlreicher Kriminalfälle beteiligt war. Vor allem dieser Aspekt seiner Forschertätigkeit (sowie natürlich sein Amt als Leiter der Body Farm) machten Bass für die Medien interessant. Das verstärkte sich 2003, nachdem Bass unter dem Titel „Death’s Acre“ erfolgreich seine Memoiren (dt. „Der Knochenleser“) veröffentlichte. Er hatte sie gemeinsam mit dem Journalisten und Schriftsteller Jon Jefferson geschrieben. (Eine „Fortsetzung“ erschien 2007.)
Mit Jefferson als Co-Autor (aber wohl unter dessen Federführung) verfasste Bass ab 2006 als „Jefferson Bass“ eine Serie von Kriminalromanen um den forensischen Anthropologen Dr. Bill Brockton – die Verfasser machen keinen Hehl daraus, an welches reale Vorbild sich diese Figur anlehnt -, der unter Einsatz jenes Leichenlabor-Ambientes, welches sich dank Patricia Cornwell, Kathy Reichs und „CSI“ großer Publikumsbeliebtheit erfreut, eigentlich unmögliche Fälle löst.
Über „Jefferson Bass“ informiert diese Website: [www.jeffersonbass.com]http://www.jeffersonbass.com.
|Taschenbuch: 349 Seiten
Originaltitel: The Devil’s Bones (New York : William Morrow/HarperCollins 2008)
Übersetzung: Elvira Willems
Deutsche Erstausgabe: Juni 2009: (Goldmann Verlag/TB Nr. 45920)
ISBN-13: 978-3-442-45920-9|
[www.goldmann-verlag.de]http://www.goldmann-verlag.de
_Jefferson und Bass bei |Buchwurm.info|:_
[„Der Knochenleser“ 465
John Dwight Carr – Das Tagebuch eines Mörders
_Das geschieht:_
Obwohl er sich dank einer Erbschaft schon vor Jahren zur Ruhe setzen konnte, verfolgt der Polizeiarzt Bruce Lightoller noch immer die Arbeit der ehemaligen Kollegen. Zu seinen Freunden gehört Sergeant Herbert McCracken, ein im Kampf gegen das Verbrechen gereifter Haudegen, der nach einer Schießerei mit Gangstern verletzungsbedingt ins beschauliche Princeton nahe San Francisco versetzt wurde.
Aktuell wünscht ihn Lightoller freilich an einen möglichst weit entfernten Ort. Er, der sich einen Namen als Frauenheld gemacht hat, fand in seiner Wohnung die Leiche einer nicht mehr ganz aktuellen Begleiterin: Constance Willard wurde erdrosselt. Panisch hatte Lightoller den Körper aus dem Haus geschafft und auf einer weit entfernten Kohlenhalde vergraben.
Ausgerechnet an diesem Tatort soll Lightoller den Polizistenfreund nun begleiten. Der Arzt ist ratlos: Spielt der erfahrene Kriminalist mit ihm? Fast scheint es so, als McCracken genüsslich die Indizien auflistet, die der „Mörder“ am Fundort der Leiche hinterließ. Dennoch spielt Lightoller das böse Spiel wohl oder übel mit.
Eine Spur führt in die übel beleumundete Spelunke „Walfisch“. Hier residiert der Ganove Cristovao Pulido. Nie konnte man ihm etwas nachweisen und auch dieses Mal muss McCracken das Feld räumen. Er lässt nun durchblicken, dass er Lightoller für verdächtig hält. Dieser steckt in der Falle, als ihm die mysteriöse Schönheit Katrin Vale ein Alibi verschafft, um dessen Falschheit Lightoller genau weiß.
Wieso hilft ihm Katrin? Wer schickt ihm anonyme Drohbriefe, die zur Flucht aus Kalifornien auffordern? Wer war Constance Willard, die offensichtlich ein Doppelleben führte? Gibt McCracken jetzt Ruhe? Als die Antworten endlich kommen, steht zwischen Leben und Tod nur noch Lightollers Tabaksdose …
_Der „doppelte“ John D. Carr_
Vor Überraschungen ist auch der erfahrene Krimileser, zu denen Ihr Rezensent sich zählen darf, nicht gefeit: „Das Tagebuch eines Mörders“ ist ein Roman, der in einer obskuren, längst eingegangenen und in allgemeine Vergessenheit geratenen deutschen Taschenbuch-Reihe erschienen ist. Bereits das Titelbild erweckt wenig Vertrauen; lieblos und ohne Zusammenhang zum Text wurden diverse Klischee-Bildchen minderer Zeichenqualität vereint.
Der Verfassername lässt aufmerken: „John D. Carr“ steht dort. Verständlicherweise setzt man ihn mit |dem| Carr, John Dickson Carr (1906-1977) nämlich, gleich. Allerdings sorgt die Lektüre schon nach wenigen Seiten für Stirnrunzeln. Weder Plot noch Stil gleichen dem, was man von diesem Carr kennt. Auch die inhaltliche Qualität des durchaus unterhaltsamen Werkes lässt in dieser Hinsicht zu wünschen übrig.
Das Internet sorgt für Aufklärung: Hinter diesem John D. Carr verbirgt sich ein Autor namens John Dwight Carr, und der wiederum heißt eigentlich Robert Grün und wurde 1909 in Österreich geboren. Ein Schelm, der Böses dabei denkt …
Grün gehörte zum Heer der meist namenlosen aber aliasreichen Schreiber, die für den Leihbuch- und Groschenheftmarkt der 1950er und 60er Jahre arbeiteten. Für miserable Honorare strickten sie in Windeseile Garne, die oft entsprechend fadenscheinig waren aber ihre Leser fanden. Um seinen Marktwert zu steigern, dachte sich Grün einen Trick aus. Schon damals galt der Prophet im eigenen Land wenig. Spielte eine Geschichte in den USA, gaben Verlag und Leser einem amerikanischen Verfasser den Vorrang. Also gab Grün vor, nur der Übersetzer von Romanen zu sein, die er selbst produzierte; er dachte sich sogar „Originaltitel“ aus. (Absoluter und aus den Fingern gesogener Unsinn ist deshalb der marktschreierische Cover-Aufdruck, dass dieser Roman „mit dem 1. Preis in Amerika ausgezeichnet“ worden sei. Welcher Preis ist damit gemeint? Darüber wird wohlweislich kein Wort verloren …)
|Abenteuer im Krimi-Märchenland|
Nachdem dieser Trick erkannt ist, stellt sich „Das Tagebuch eines Mörders“ als erstaunlich lesbares Werk heraus. Das Kalifornien der späten 1950er Jahre wird zwar aus angelesenen Fakten und USA-Klischees zusammengebastelt, doch genau das trägt zum Reiz der Lektüre bei. Carr kreiert eine zeitlose Kulisse, in die er entsprechend unbekümmert seine turbulente Story platziert.
Die ist definitiv eine Kopie von 1001 „hard-boiled“-Krimis im Geiste Raymond Chandlers und Dashiell Hammetts. Carr verzichtet auf kritische Anmerkungen und Anspielungen, was aufgrund der geografischen Entfernung zwischen Autor und Schauplatz eine kluge Entscheidung ist. Er übernimmt nur die lakonischen Sarkasmen, für die der „harte“ Krimi bekannt geworden ist. Dabei zeigt er echten Sinn für Humor. Sein Witz ist nicht subtil aber trocken, was ihn selbst heute noch funktionieren lässt, wie beispielsweise Carrs eigenwillige Charakterisierung der Gäste des „Walfisch“ zeigt: |“Die Dekolletés aneinandergereiht würden, schätze ich, von Frisco bis Los Angeles reichen … Das männliche Geschlecht ist hauptsächlich durch Typen vertreten, die beweisen, dass Darwin kein Phantast war.“| (S. 29) Vor dem geistigen Auge entsteht umgehend das entsprechende Bild.
|Alles nur geklaut – aber das immerhin gut|
Der eigentliche Plot vom Mörder, der keiner ist, aber sich zu seinem Schrecken an prominenter Position inmitten der Ermittlung wiederfindet, ist ebenfalls nicht neu. Geschickt adaptiert bzw. variiert wie hier funktioniert er auch im Billig-Krimi vorzüglich. Carr versteht es, die Antwort auf die Frage nach Lightollers Schuld so lange wie möglich hinauszuzögern. Ist der zwar leichtfertige aber sympathische Held ein Mörder? Wir können es nicht glauben, weil wir es nicht glauben wollen, doch was sollen wir glauben, nachdem Lightoller die Leiche von Constance Willard verschwinden lassen wollte?
Ebenfalls geschickt in Szene gesetzt ist das Duell zwischen Lightoller und McCracken. Selbstverständlich ist der Kriminalbeamte Klischee pur – schon der Name charakterisiert den eisenharten Gangsterschreck. Gleichzeitig ist er ein aufmerksamer Beobachter. Wenn er Lightoller an der langen Leine zappeln lässt, kann er die Verdachtsmomente jederzeit auflisten. Carr plottet sauber: Unabhängig davon, dass er keine Ahnung vom Arbeitsalltag der US-Polizei hat, schildert er McCracken als akribischen Detektiv, dessen Anschuldigungen stets plausibel sind.
Das abgehobene Geschehen betont eindringlich die schöne aber mysteriöse Katrin Vale. Eine weibliche Figur, die so selbstständig und selbstbewusst ist, erwartet man nicht in einem Routine-Krimi aus chauvinistischer Vergangenheit. Vale ist zwar dem flatterhaften Lightoller nicht abgeneigt. Dennoch ist sie aus deutlich härterem Holz als dieser geschnitzt: wieder eine Überraschung, mit der Carr punkten kann. Kein Wunder, dass Vale sich auch in anderen Carr-Krimis ein Stelldichein gibt!
Langer Rede kurzer Sinn: Sollte „Das Tagebuch eines Mörders“ dem geneigten Leser dieser Zeilen irgendwie, irgendwann in die Finger geraten, kann zur Anschaffung & Lektüre geraten werden.
Taschenbuch: 143 Seiten
Deutsche Erstveröffentlichung: 1959 (Moewig Verlag/Der Moewig-Kriminal-Roman, So. Bd. 37), 111 Seiten, keine ISBN
Diese Ausgabe: 1978 (Martin Kelter Verlag/Kelter TB Nr. 1055)
ASIN: B0028ILL3C
www.kelter.de
Jon Christopher – Insel ohne Meer
_Das geschieht:_
Guernsey ist die zweitgrößte jener Inseln, die als Besitz der britischen Krone vor der englischen Küste und schon in Sichtweite Frankreichs im Kanal liegen. Hier hat sich Matthew Cotter eine Existenz als Gärtner aufgebaut. Sein ruhiges Leben wird eines Nachts beendet, als ein gewaltiges Erdbeben die Insel erschüttert. Nicht nur Guernsey ist betroffen. Als Cotter sich aus den Trümmern seines Hauses befreit hat, muss er feststellen, dass sich das Meer zurückgezogen hat und das Festland zu Fuß erreicht werden könnte.
Die meisten Inselbewohner sind umgekommen. Hilfe von außen ist nicht zu erwarten; offensichtlich wurde die gesamte Erde durch die Naturkatastrophe verheert. Die wenigen Überlebenden auf Guernsey versammeln sich um Joe Miller, der rücksichtslos das Kommando an sich reißt und schon für eine Zukunft nach dem großen Knall plant. Wie ein vorzeitlicher Häuptling organisiert Miller seinen „Stamm“, teilt die gebärfähigen Frauen kräftigen Männern zu und duldet keinen Widerstand.
Cotter, der zunächst froh darüber war, nicht allein dazustehen, beginnt Miller zu verabscheuen. Zusammen mit dem 10-jährigen Billy Tullis, der bei dem Erdbeben seine Familie verlor und von Miller gerettet wurde, will er den Marsch aufs Festland wagen, seine Tochter suchen und dem Despoten Miller entkommen. Die Flucht gelingt, aber die bizarren und grausamen Erlebnissen auf dieser Reise in ein in die Barbarei zurückgefallenes England lassen Cotter bald wünschen, den zweifelhaften Schutz von Guernsey niemals aufgegeben zu haben …
_Die Welt geht immer wieder unter_
Die Briten sind ein Volk, das stolz auf seine Eigenheiten ist. Dazu gehören ein besonders trockener bis schwarzer Humor und die Liebe zu Untergangs-Szenarien. Seit H. G. Wells die Marsianer über England herfallen ließ, wiederholte sich die Apokalypse quasi regelmäßig. Mal fiel der Mond in den Ozean, der daraufhin die Zivilisation von den britischen Inseln spülte (R. C. Sheriffs, „The Hopkins Manuscript“, dt. „Der Mond fällt auf Europa“), dann wuselten genmutierte Mordpflanzen durch ehrwürdige Grafschaften (John Wyndham, „The Day of the Triffids“, dt. „Die Triffids“), oder Außerirdische kletterten mit finsteren Absichten aus den Tiefen des Atlantiks (noch einmal John Wyndham, „The Kraken Wakes“, dt. „Kolonie im Meer“/“Der Krake erwacht“).
John Christopher versuchte gleich mehrfach und mit einer Getreidepest („The Death of Grass“, dt. „Das Tal des Lebens“), einer neuen Eiszeit („The World in Winter“) oder – im vorliegenden Roman – mit einem monströsen Erdbeben seinen Landsleuten den Garaus zu machen. In der Tradition dessen, was Brian W. Aldiss als „gemütliche Katastrophengeschichte“ bezeichnete, bricht das Verderben erstens plötzlich und zweitens über ganz normale Durchschnittsmenschen herein. Zwar lebendig aber praktisch mit leeren Händen stehen sie nun da und müssen die Krise meistern.
Wobei Christopher das „gemütlich“ aus seinen apokalyptischen Visionen energisch streicht. Wie er, der Weltwirtschaftskrise, Zweiten Weltkrieg und Kalten Krieg als Zeitgenosse und teilweise hautnah miterlebte, das Lern- und Anpassungsverhalten des Menschen beurteilt, wirft ein düsteres Licht auf unsere Spezies.
|Radikales Weltende ohne Lehreffekt|
Dass England in der Realität jemals von Erdbeben der vom Verfasser beschriebenen Stärke heimgesucht wird, ist denkbar unwahrscheinlich. Dies war in den 1960er Jahren längst, und auch Christopher bei der Niederschrift seines Romans, bekannt – ein Indiz dafür, dass für ihn die eigentliche Katastrophe Nebensache ist. Dafür spricht ebenfalls, dass Christopher sich eine Beschreibung der wohl weltweiten Verwüstungen spart und sich auf einen kleinen Ausschnitt beschränkt. (Guernsey wählte der Autor übrigens als Handlungsort, weil er viele Jahre auf dieser Insel gelebt hat.) Der Untergang ist ihm MacGuffin im hitchcockschen Sinn – ein Vorwand, der den Rahmen für die Darstellung dessen schafft, was den Autoren eigentlich interessiert.
Christopher geht es um das Verhalten von Menschen. Er nimmt sich die Zeit, das Leben vor dem Ende zu beschreiben. Im Wissen um den Untergang wirken die Rituale des modernen Alltagslebens ebenso nichtig wie liebenswert. Matthew Cotter ist kein „Macher“, sondern ein kleiner Gärtner, den seine Nachbar gern mit einer alleinstehenden Witwe verkuppeln mochten. Auf sein Überleben nach dem Zusammenbruch würde man nicht unbedingt wetten.
Aber Cotter verfügt über eine Eigenschaft – oder besser: Nicht-Eigenschaft -, die ihn retten wird: Er hängt nicht allzu sehr an den Werten der „alten“ Welt, die er deshalb abschütteln kann, wo andere Menschen erstarren, der Vergangenheit nachtrauen und auf Hilfe von außen warten, bis es zu spät ist. Nur seine Liebe zur verschollenen Tochter kann Cotter nicht aufgeben, und exakt dies wird ihn mit einem Grauen konfrontieren, das er sich durch den endgültigen Schnitt hätte ersparen können.
|Anpassen – herrschen – unterwerfen|
Das Überleben folgt nach Christopher archaischen Regeln. Der Mensch ist unter einer dünnen zivilisatorischen Tünche immer noch das Produkt einer Vorzeit, in der das Wort und die Waffe des Stärkeren die Primär-Geltung hatte. Ohne Kultur und Technik bricht die Bestie auf breiter Front wieder durch.
Während Cotter auch in der Krise menschliche Werte hochhält, schlägt nach der Tag X die Stunde der Despoten. Christopher unterscheidet zwischen brutalen Egoisten, die sich mit Gewalt nehmen, was sie wollen, und dabei schwächere Personen unter ihre Gewalt bringen, und wohlwollenden Tyrannen, die einen „Stamm“ um sich scharen und das Weiterleben nach ihren Vorstellungen organisieren.
Cotter steht zwischen Herrschern und Untertanen. Obwohl er die Zügel in die Hand nehmen könnte, weigert er sich, ein Lager zu wählen. Durch Intelligenz und ein Einfühlungsvermögen, in das sich eine hohe Dosis Opportunismus mischt, kann Cotter sich die neuen Häuptlinge und Warlords eine Weile vom Hals halten. Die Entscheidung wird dadurch nur aufgeschoben – irgendwann muss Cotter Farbe bekennen.
|Ein nicht goldener aber möglicher Mittelweg|
Dieser Lernprozess wird ihn zeichnen. Christopher stellt Cotter nie als klassischen Helden dar. In eindeutiger Kenntnis des Zwangs, mit dem „König Miller I.“, wie er ihn ironisch nennt, über „seine“ Untertanen herrscht, verweigert Cotter die Konfrontation. Stattdessen setzt er sich in der Nacht heimlich ab und nimmt darüber hinaus ein Kind mit auf eine gefährliche Odyssee mit ungewissem Ausgang.
Billy ist nicht nur Identifikationsfigur für jüngere Leser. Er begleitet und verkörpert Cotters Weg zur Erkenntnis. Auf seiner von Anfang an sinnlosen Suche nach der Tochter setzt er das Leben eines buchstäblich greifbaren Menschen, der auf seine Solidarität angewiesen ist, aufs Spiel. In der ultimativen Krise sind keine Visionäre, sondern Realisten gefragt, die sich mit den Gegebenheiten arrangieren. Am Ende hat Cotter seine Lektion gelernt und seinen eigenen Weg in die Zukunft gefunden. Er wird der Not gehorchen, sich ihr jedoch nicht beugen. Auf diese Weise verbindet er Realitätssinn mit Zivilisation, schafft sich eine Lebensperspektive und erspart dem Leser ein unrealistisches Happy-End, sondern schließt eine trotz des Themas „stille“ aber spannende Geschichte zufriedenstellend ab.
_Autor:_
Christopher Samuel Youd wurde am 12. Februar 1922 in der englischen Grafschaft Lancashire geboren. Nach mehrjährigem Kriegsdienst (1941-1946) wurde Youd dank eines Stipendiums der |Rockefeller Foundation| für literarische Nachwuchstalente ein „richtiger“ Schriftsteller. Die erste professionelle Veröffentlichung wurde 1949 die Kurzgeschichte „Christmas Tree“. Ebenfalls 1949 erschien, „The Winter Swan“, Youds erster Roman.
Da Erfolg und Einkünfte zunächst ausblieben, arbeitete Youd für ein Unternehmen, das mit Industriediamanten handelte, und schrieb abends und an den Wochenenden. In den nächsten Jahren verfasste er unter einer Vielzahl von Pseudonymen für wenig Geld zahlreiche Krimis, aber auch Liebesromane oder Arztdramen. 1955 kehrte er als John Christopher mit „The Year of the Comet“ zu seinem Lieblings-Genre, der Science-Fiction, zurück. Im folgenden Jahr gelang ihm der Durchbruch mit „The Death of Grass (dt. „Das Tal des Lebens“), einer Katastrophen-Geschichte der typisch englischen Art. Christopher hatte „seine“ Nische gefunden. Er konnte seinen Brotjob aufgeben und ließ in den folgenden Jahren weitere Katastrophen über die Erde hereinbrechen.
Mitte der 1960er Jahre gab Christopher seiner Karriere eine neue Richtung: Er schrieb nun SF gezielt für jugendliche Leser. Gleich sein erster Roman wurde ein Bestseller und Start einer Serie um die „Tripoden“ oder „dreibeinigen Monster“, Außerirdische in stählernen Kampfmaschinen, die sich die Erde untertan gemacht haben und die Menschen in feudalzeitlicher Rückständigkeit halten. Christopher stellt eine junge, rebellische Generation in den Mittelpunkt der spannenden Handlung, die den Kampf gegen den zunächst übermächtig scheinenden Gegner aufnimmt. Mit zwei Trilogien („The Prince in Waiting“ und „Fireball“) und einigen Einzel-Romanen war Christopher ebenfalls erfolgreich, doch vor allem die Serie um die dreibeinigen Monster – die 1984 eine zehnteilige TV-Verfilmung erfuhr – wird seit Jahrzehnten auch in Deutschland immer wieder aufgelegt.
In den 1980er Jahren begann Christophers Produktivität nachzulassen. Neue Romane erscheinen nur noch selten, etwa 70 Bücher hat der Autor insgesamt veröffentlicht.
Taschenbuch: 192 Seiten
Originaltitel: A Wrinkle in the Skin (London : Hodder & Stoughton 1965)/The Ragged Edge (New York : Simon & Schuster 1966)
Deutsche Erstausgabe: 1966 (Wilhelm Goldmann Verlag/Goldmann-Zukunftsromane Z 70 u. Goldmanns Weltraum Taschenbücher 072)
Übersetzung: Hans-Ulrich Nichau
Cover: Eyke Volkmer
ASIN: B0000BQDKT
www.goldmann-verlage.de
Boothby, Guy Nevell – Rache des Doctor Nikola, Die
_Das geschieht:_
Er ist das kriminelle Superhirn seiner Zeit: Auf der ganzen Welt spinnt der mysteriöse Dr. Nikola seine Intrigen, die in der Regel damit enden, dass reiche Männer und große Firmen viel Geld verlieren. Doch vor einiger Zeit hat sich jemand Nikola in den Weg gestellt, wodurch dem Schurken diverse Pläne zunichte gemacht wurden. Nun ist es genug, aber Nikola wäre nicht Nikola, wollte er sich den Rivalen nur vom Hals schaffen. Dem Frechling soll eine Lektion erteilt, er soll ruiniert und gedemütigt werden. Um dies zu gewährleisten, entwirft Nikola einen komplizierten Racheplan. Für die Realisierung heuert er drei skrupellose Schurken an und schickt sie mit genauen Anweisungen aus.
Buchstäblich am anderen Ende des Globus“ – in Australien – stolpert Richard Hatteras in das Abenteuer seines Lebens. Als er eine Reise nach England antritt, um die Heimat seines Vaters kennenzulernen, verliebt er sich in die junge Phyllis Wetherell. Sie ist in Begleitung ihres Vaters, des Kolonialsekretärs Sylvester Wetherall, der sich als Nikolas „Zielperson“ entpuppt. Davon ahnt Hatteras natürlich zu diesem Zeitpunkt nichts, weshalb er nicht einschätzen kann, wieso der alte Wetherell, der Nikolas Schergen entdeckt hat, voller Schrecken und in Begleitung seiner Tochter in Australien untertaucht.
Hatteras beginnt eine intensive Suche nach seiner Braut und gerät dabei Nikola in die Quere. Obwohl vom Doktor eindringlich gewarnt, macht er sich auf den Weg nach Australien. In Begleitung eines jungen englischen Adligen gerät Hatteras in diverse Fallen und Ablenkungsmanöver des tückischen Dr. Nikola. Unerschrocken bleibt er diesem auf den Fersen. Auf einer einsamen Südsee-Insel kommt es zum finalen Duell, doch das Schurkengenie hält auch dieses Mal die Fäden fest in der Hand …
_Vom Archetyp zum Klischee_
An ihren prägnanten Eigenheiten lassen sie sich erkennen: Die großen, klassisch gewordenen Schurken definierten sich niemals allein über ihre Taten. Sie drücken ihre böse Intelligenz bereits optisch und akustisch aus, präsentieren sich flamboyant, extravagant, aufregend. Auf keinen Fall sind sie gewöhnliche Verbrecher, verwenden auf Stilfragen mindestens soviel Energie wie auf den Entwurf unerhört komplizierter Pläne, deren Aufgehen sie eher gleichgültig lässt. Viel wichtiger ist ihnen die Intrige, das Düpieren übermächtiger Gegner sowie die Demütigung von Rivalen. Nie können sie der Versuchung widerstehen, sich vor diesen zu spreizen, wenn sie endlich in ihre Gewalt geraten sind, statt sie endgültig auszuschalten und sich auf die Durchführung ihrer genialen Projekte zu konzentrieren, die folgerichtig meist in letzter Sekunde scheitern.
Im 21. Jahrhundert sind die besten Macken längst vergeben. Die genialischen Bösewichter wiederholen sich und sind vom Archetyp zum Klischee herabgesunken. Nur selten fällt einem Schuft noch etwas Originelles ein. Da hatten es die kriminellen Ahnen einfacher. Dr. Nikola ist hier für manche echte Überraschung gut: Er beherrscht die Kunst der Hypnose und zwingt seine Gegner buchstäblich in seinen Bann, ist ein begnadeter Wissenschaftler (und Alchemist), der in seinem Labor betäubende Wundermittel und exotische Gifte mischt, sowie ein Meister der Maske, der zudem überall auf Verstecke und Helfershelfer zurückgreifen kann.
|Auf die Details kommt es an!|
Außerdem benutzt er eine schwarze Katze als Accessoire (und entlarvt damit die James-Bond-Nemesis Blofeld als schnöden Nachahmer). Guy Nevell Boothby hat einen gut entwickelten Sinn für die Inszenierung seines Schurken. In einem feinen Lokal in London lässt der Doktor drei gefährliche Männer zusammenkommen. Zu seinen Anweisungen gehört die Bereitstellung einer Schale mit Milch. Was bedeutet dieses Detail? Noch bevor Boothby seinen Lesern Nikola vorstellt, hat er sie neugierig auf diese Figur gemacht, die er später so überhöhen wird: |“Nun, er ist Nikola, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Wenn Sie ein kluger Mann sind, werden Sie nicht mehr wissen wollen. Fragen sie die chinesischen Mütter, … wer er ist, fragen sie die Japaner, die Malaien, die Hindus, die Burmesen, die Kohlenträger in Port Said, die buddhistischen Priester auf Ceylon; fragen Sie den König von Korea, die Menschen oben in Tibet, die spanischen Priester in Manila oder den Sultan von Borneo, den Minister von Siam oder die Franzosen in Saigon, sie alle kennen Dr. Nikola und seine Katze; und glauben Sie mir, sie fürchten ihn.“| (S. 210)
Nikola scheint nicht nur für Blofeld, sondern auch für andere klassische Finsterlinge Pate gestanden zu haben: Sein betont mysteriöses Auftreten und sein Faible für schwarzmagisch anmutende Tricks verweisen auf Dr. Fu-Manchu, den Sax Rohmer (1883-1959) ab 1913 auf ahnungslose Abendländler losließ. Freilich war der Osten als Hort einer „gelben Gefahr“ für brave und vorsichtshalber stets wachsame Abendländer bereits um 1900 ein politischer, kultureller und eben auch literarischer Topos. Zwei Jahrzehnte später bescherte Norbert Jacques seinen Lesern mit Dr. Mabuse einen „europäischen“ Super-Verbrecher, der nichtsdestotrotz Dr. Nikola in Auftritt und Handlung sehr ähnlich war. Dass Dr. Nikola echte übernatürliche Kräfte besitzt, deutet Boothby zwar an, lässt es aber offen; als kluger Autor, der an die Zukunft denkt, lässt er diese Katze im ersten Band seiner Serie im Sack.
|Der Inhalt verdeckt die Form|
Starke Figuren können dem Verfasser, der sie zu schaffen versteht, viel Arbeit ersparen. In unserem Fall überstrahlt Dr. Nikola mit einer Persönlichkeit, die selbst in seiner Abwesenheit über der Handlung schwebt, die im Grunde simple Struktur dieses Romans. Hinter dem Gewirr eines überkompliziert eingefädelten und selbst im 19. Jahrhundert unrealistischen Intrigengespinstes kommt viel heiße Luft zum Vorschein. Boothby konnte nie viel Zeit auf originelle Plots verwenden. Sie waren in seinem Metier – der Unterhaltungsliteratur – auch nicht wichtig. Hier griff man auf bewährte Geschichten und Figuren zurück, die variiert und der jeweiligen Handlung angepasst wurden.
In der Tat funktionieren Elemente wie Verfolgungsjagden, Todesfallen oder dramatische Rettungsaktionen, selbst wenn das dabei zum Einsatz kommende Instrumentarium inzwischen altmodisch wirkt. Auch die Rollenverteilung hat sich konserviert. Das Dreieck Schurke – Maid in Not – junger Held ist zeitlos, selbst die damit einhergehenden Klischees fallen mehr als 100 Jahre später kaum irritierend ins Gewicht.
Das wahre Alter der Geschichte wird dort zum Problem, wo sich der Alltag grundlegend gewandelt hat. Die Liebesgeschichte von Richard und Phyllis wirkt heute steif und in die Länge gezogen, während den zeitgenössischen Lesern die diffizilen Regeln im Umgang zwischen Mann und Frau bekannt und vertraut waren. Natürlich – so muss man beinahe sagen – erweist sich Hatteras nicht nur als Ehren- sondern zufällig auch als Edelmann, wodurch sämtliche Vorbehalte, die man gegen ihn hegen könnte, mit einem Schlag ausgeräumt sind: Auch dies ist ein einst gern eingesetzter Knalleffekt.
Weniger erfreulich ist Boothbys Hang zu Wiederholungen und abschweifenden Nebenhandlungen, die mit der zentralen Handlung wenig bis gar nichts zu tun haben. Hierin erkennt man den Vielschreiber, der die Hatz auf Nikola und damit seinen Roman auf möglichst einfache, d. h. ideenarme Weise zu verlängern sucht. Immerhin lesen sich diese Schlenker oft unterhaltsam, da Boothby Land und Leute, über die er schreibt, selbst bereist hat und deshalb kennt.
|Gute Bücher und schöne Bücher|
Dass sich „Die Rache des Doctor Nikola“ mehr als ein Jahrhundert nach der Entstehung insgesamt immer noch flüssig und spannend liest, spricht für den Verfasser (sowie für einen Übersetzer, der das künstlich Altmodische vermeidet, ohne das Alter der Vorlage zu verleugnen). Nicht nur die bloße Tatsache, dass ein Verlag das Risiko eingeht, eine mehr als 100 Jahre alte Reihe neu übersetzt auf den Buchmarkt zu bringen, ist positiv zu registrieren. Mit Bestseller-Auflagen ist hier kaum zu rechnen, weshalb die „großen“ Häuser Dr. Nikola keines Blickes würdigen würden. Wie heute üblich, springt ein kleiner, aber engagierter und wohl auch mutiger Verlag in die Bresche. Dem Käufer und neugierigen Leser, der über den Tellerrand der üblichen Verbrauchsliteratur schauen möchte, wird für einen moderaten Preis darüber hinaus ein Vorwort des Übersetzers geboten, der knapp aber umfassend Auskunft über Leben und Werk des Verfassers gibt.
„Die Rache des Doctor Nikola“ erscheint als Paperback in Klappenbroschur. Das Buch ist schön gebunden, lässt sich aufschlagen, ohne dass dabei der Rücken krachend bersten würde, und dank ihres guten, dicken Papiers verkraften die Seiten auch energisches Umblättern ohne eselsohriges Nachgeben. Wer seine Bücher nicht nur liest, sondern auch liebt und sammelt, wird mit diesem Exemplar auf seine Kosten kommen!
Es bleibt noch die Frage, wieso die Abkürzung „Dr.“ in dieser neuen deutschen Ausgabe hartnäckig als „Doctor“ aufgelöst wird …
_Autor:_
Am 13. Oktober 1867 wurde Guy Newell Boothby im australischen Glen Osmond, einer Vorstadt von Adelaide, geboren. Die Boothbys gehörten zur Oberschicht, Guys Vater saß im Parlament von Südaustralien. Der Sohn besuchte von 1874 bis 1883 die Schule im englischen Salisbury, dem Geburtsort seiner Mutter.
Nach Australien zurückgekehrt, versuchte sich Boothby als Theaterautor. Sein Geld verdiente er allerdings als Sekretär des Bürgermeisters von Adelaide. Beide Tätigkeiten wurden nicht von Erfolg gekrönt. Boothbys Lehr- und Wanderjahre führten ihn 1891/92 kreuz und quer durch Australien sowie den südasiatischen Inselraum. Sein 1894 veröffentlichter Reisebericht wurde zum Start einer außergewöhnlichen Schriftstellerkarriere.
1895 siedelte Boothby nach England um, heiratete und gründete eine Familie. Er schrieb nun Romane, wobei er sämtliche Genres der Unterhaltungsliteratur bediente und lieferte, was ein möglichst breites Publikum wünschte. Boothby war ein findiger und fleißiger Autor, der überaus ökonomisch arbeitete, indem er seine Worte nicht niederschrieb, sondern in eine Phonographen diktierte und die so besprochenen Wachswalzen von einer Sekretärin in Reinschrift bringen ließ. Jährlich konnten auf diese Weise durchschnittlich fünf Titel erscheinen. Boothbys Einkünfte ermöglichten ihm den Kauf eines Herrenhauses an der Südküste Englands, in dem er mit seiner Familie lebte, bis er am 26. Februar 1905 im Alter von nur 37 Jahren an einer Lungenentzündung starb.
_Die „Dr. Nikola“-Reihe:_
(1895) Die Rache des Doctor Nikola (|A Bid for Fortune, or: Dr. Nikola’s Vendetta| / |Enter Dr. Nikola!|)
(1896) Die Expedition des Doctor Nikola (|Dr. Nikola|)
(1898) |The Lust of Hate|
(1899) |Dr. Nikola’s Experiment|
(1901) |Farewell, Nikola|
Band 3 – |The Lust of Hate| – wird keine Neuauflage erfahren; Dr. Nikola tritt nur als „Gaststar“ in einer Geschichte auf, die ansonsten mit „seiner“ Serie nichts zu tun hat.
|Broschiert: 232 Seiten
Originaltitel: A Bid for Fortune, or: Dr. Nikola’s Vendetta (London : Ward, Lock & Co. 1895) / Enter Dr. Nikola! (Hollywood/Californien : Newcastle Pub. Co. 1975)
Deutsche Erstausgabe: März 2010 (Wurdack Verlag)
Übersetzung: Michael Böhnhardt
ISBN-13: 978-3-938065-61-7|
[www.wurdackverlag.de]http://www.wurdackverlag.de
[Verlagsblog – doctornikola.blogspot.com]http://doctornikola.blogspot.com
_Guy Newell Boothby bei |Buchwurm.info|:_
[„Pharos der Ägypter“ 297
Keith Roberts – Der Neptun-Test

Keith Roberts – Der Neptun-Test weiterlesen
Birkin, Charles – So bleich, so kalt, so tot
_Das geschieht:_
In acht Geschichten lässt der Verfasser nackten Horror in trügerische Idyllen einfallen.
|So bleich, so kalt, so tot| („So Pale, So Cold, So Fair“), S. 7-26: In Athen lässt sich alles zu Geld machen, aber manchen Handel überlebt der Verkäufer nicht …?
|Das Gottesgeschenk| („The Godsend“), S. 27-43: Sie erscheint im goldrichtigen Moment, um auf das Kleinkind aufzupassen, weshalb die gestressten Eltern die Herkunft dieses Babysitters nicht so gründlich wie nötig überprüfen …
|Bello| („Rover“), S. 44-49: Er ersetzte seiner blinden Gattin Zeit seines Lebens die Augen, und zumindest auf die will sie nach seinem Tod nicht verzichten …
|Das Kinderfest| („Circle of Children“), S. 50-62: Ein gewaltiges Freudenfeuer und der Auftritt einer sehr überzeugenden Hexe – was kann damit bei einem Kinderfest schon schiefgehen …?
|Lots Weib| („Lot’s Wife“), S. 63-71: Sie machte ihrem Ehemann das Leben zur Hölle, weshalb seine Rache teuflisch ausfällt …
|Gideon| („Gideon“), S. 72-82: Die betrogene Gattin ist Notärztin und wartet geduldig, bis ein Unfall ihr die Nebenbuhlerin ausliefert …
|Eine faszinierende Schönheit| („A Hunting Beauty“), S. 83-103: Als selbst der Mord an der Rivalin ihr den Geliebten nicht zurückbringt, zieht die erzürnte Jacqueline die Terror-Schraube ein wenig zu fest an …
|Der Gott der Zuflucht| („Lords of the Refugee“), S. 104-126: Dieser Missionar legt auf einer Pazifik-Insel nach Ansicht der Bewohner zu viel Pflichtbewusstsein an den Tag und übersieht gleichzeitig, wie abgelegen dieser Ort ist …
_Die Lust am elegant servierten Schrecken_
Die „conte cruel“ oder „Schauergeschichte“ bezeichnet eigentlich ein Literaturgenre des 19. Jahrhunderts. Formal und inhaltlich wiegt der Verfasser seine Leser durch die Schilderung scheinbarer Alltäglich- und Nebensächlichkeiten in trügerischem Frieden. Naht das Ende, geschieht plötzlich Schreckliches, das gern plakativ, d. h. blutig und grausig ausfallen darf. Wenn dies gelingt und der Autor seinem Publikum einen (unterhaltsamen) Schrecken einjagen konnte, hat er das angestrebte Genre-Ziel erreicht, wobei Zurückhaltung oder die Einhaltung des sog. „guten Geschmacks“ zwar ausgeklammert blieben, der Verfasser das Grauen jedoch durch (schwarzen) Humor konterkarierte und ihm auf diese Weise ein Ventil schuf.
Da der Schock-Effekt auch einer modernen Leserschaft genehm ist, starb die Schauergeschichte nicht aus. Sie wandelte sich und passte sich den geänderten Zeitläufen an, was erwartungsgemäß vor allem bedeutete, dass der Schock an Intensität und Härte zunahm. Das finale ironische oder humoristische Element blieb ebenfalls erhalten.
Zu den modernen Meisters der Schauergeschichte gehören u. a. Robert Bloch (1917-1994), Roald Dahl (1916-1990) und Charles Birkin (1907-1986). Während Bloch und Dahl auch hierzulande mit ihren bösen Stories bekannt wurden, blieb Birkin, der ihnen durchaus gewachsen ist, in Deutschland fast gänzlich unbekannt. Nur zwei schmale Bände mit Erzählungen erschienen Anfang der 1970er Jahre. Sie sind immerhin repräsentativ und verdeutlichen, wieso Birkin in Großbritannien als Klassiker gilt und seine Werke präsent blieben.
|Der Alltag als Brutstätte des Todes|
Grausame Überraschungen auch in der modernen Gegenwart zwar nicht alltägliche aber doch mögliche Zwischenfälle. Birkin verwurzelt seine Geschichten sorgfältig in der meist idyllischen Welt der (englischen) Mittelklasse. Er nimmt sich viel Zeit, sie ausführlich zu schildern, und verliert sich dabei in Details, die mit der Handlung nur wenig zu tun haben – scheinbar, denn sie komplettieren das Bild des Friedens, das dem Verfasser wichtig ist: Der Leser lernt den Ort der Handlung ihre Figuren kennen und wird gleichzeitig ein wenig eingelullt.
Plötzlich kippt die Stimmung um. Nachträglich ist es möglich, diesen Moment im Text wiederzufinden: Birkin zieht die Samthandschuhe aus. Misstöne ziehen in das harmonische Geschehen ein, und sie werden stetig schriller. Unbehaglich verfolgt der Leser die Entstehung einer Situation, die nicht nur unerwartet, sondern auch unaufhaltsam ist. Die Normalität entpuppt sich als Fassade, hinter der sich höllische Abgründe auftun.
Der Höhepunkt ist fast schon identisch mit dem Finale. Birkin kennt nun keine Zurückhaltung mehr, er schont um des Effektes wegen weder Babys noch schwangere Frauen, schändet Leichen oder pumpt allzu vertrauensselige Touristen blutleer. Es wird brutal, blutig und oft schlicht widerlich. Der Kontrast zur Vorgeschichte könnte – und soll – nicht größer sein. Macht Birkin es richtig, fühlt sich der Leser nicht nur unterhalten. Geschichten wie „Das Gottesgeschenk“, „Bello“ und vor allem „Das Kinderfest“ hinterlassen zudem ein deutliches Gefühl des Unbehagens.
Ein solcher Doppel-Erfolg gelingt naturgemäß selten, zumal Birkin nicht nur oder immer erschrecken will. „Lot’s Weib“ oder „Der Gott der Zuflucht“ sind „nur“ Geschichten mit böser aber lustiger Auflösung. Mit „So bleich, so kalt, so tot“ oder „Eine faszinierende Schönheit“ schafft Birkin den Spagat zwischen Vorbereitung und Final-Effekt nicht; der eine ist in seiner Absurdität zu unglaubhaft, und der andere lässt das Intrigen-Opfer dem Wahnsinn verfallen, was zu vielen schlechten Autoren als billiger Ausweg dient.
|Andere Zeiten, andere (Un-) Sitten|
Vielleicht sollte man besser von „politisch unkorrekten“ Untaten sprechen, denn zu den Exzessen des Splatterpunks späterer Horror-Jahre klafft doch eine deutliche Lücke. Bekanntlich gibt es einen angelsächsischen, d. h. gleichzeitig schwarzen und trockenen Humor. Berühmt sind die Briten auch für ihr Talent, selbst Schreckliches deutlich aber trotzdem zurückhaltend darzustellen. Als „So bleich, so kalt, so tot“ 1970 erschien, war Charles Birkin seit vier Jahrzehnten im Literaturgeschäft. Obwohl er sich sichtlich bemüht, die Gegenwart in seine Geschichten einfließen zu lassen, wirken kurze Momente sexueller Offenherzigkeit etwas bemüht und aufgesetzt. Auf diese Art zu schockieren ist Birkins Ding eindeutig nicht.
Auch sonst stammt er nicht aus dem „Swinging London“ der späten 1960er Jahre. In Birkins literarischer Welt ist ein uneheliches Kind noch ein gesellschaftliches Todesurteil. Dies muss man verstehen, um die Verbissenheit zu begreifen, mit der sich die beiden weiblichen Protagonisten in (und um) „Gideon“ streiten oder Jacqueline in „Eine faszinierende Schönheit“ notfalls durch Mord Hindernisse auf dem Weg zur „ehrbaren“ Ehefrau ausräumt.
Ohnehin mögen feministisch engagierte Leser/innen über manche Geschichte die Stirne runzeln. Um 1970 steckte die Gleichberechtigung noch in den Kinderschuhen, wofür der Verfasser (sicherlich unfreiwillig) zahlreiche Belege liefert. Dies ist aber nur ein Indiz dafür, dass die Schauergeschichte à la Charles Birkin veraltet ist. Sie hat im 21. Jahrhundert ihre Relevanz verloren und an Schockwirkung eingebüßt. Nichtsdestotrotz gefällt Birkin durch die Kunstfertigkeit, mit der er die Worte zu setzen weiß, mit denen er sein Publikum erst einlädt, um es schließlich in Angst & Schrecken zu versetzen!
_Autor:_
Sir Charles Lloyd Birkin (geb. 1907), ab 1942 „5th Baronet of Ruddington Grange in the County of Nottingham“, studierte als Spross eines (allerdings nicht sehr alten) Adelsgeschlechtes standesgemäß in Eton und kämpfte mit seinem Regiment – den „Sherwood Forresters“ – im Zweiten Weltkrieg.
In den frühen 1930er Jahren gab Birkin für den Verlag Philip Allan zahlreiche Anthologie-Bände der berühmten „Creeps Library“ heraus. Unter dem Pseudonym „Charles Lloyd“ schrieb er selbst für diese Reihe. Seine Geschichten stehen den „contes cruels“ („Schauergeschichten“) des 19. Jahrhunderts näher als dem „richtigen“ Horror und setzen auf einen sorgfältig vorbereiteten, drastischen Schlusseffekt.
In den 1960er und 70er Jahren wurde Birkin erneut schriftstellerisch und als Herausgeber aktiv. Inzwischen verheiratet, verbrachte er seine späteren Lebensjahre in Sulby auf der Insel Man. Dort ist er 1985 gestorben.
|Taschenbuch: 126 Seiten
Originaltitel: So Pale, So Cold, So Fair (London : Tandem 1970)
Übersetzung: Jutta von Sonnenberg
Deutsche Erstausgabe: 1972 (Wilhelm Heyne Verlag/Heyne Allgemeine Reihe 01/947)
ASIN: B0027TPE1C|
[www.heyne.de]http://www.heyne.de
John Dickson Carr – Der blinde Barbier

Seldon Truss – Frauen reden zuviel
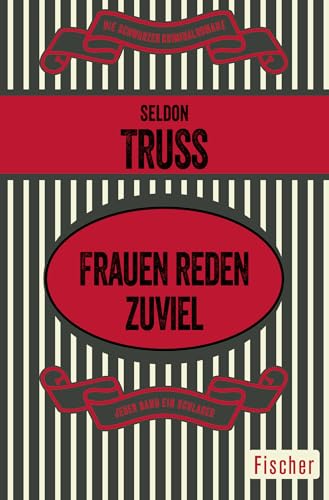
Seldon Truss – Frauen reden zuviel weiterlesen
Timothy R. O‘Neill – Das Grau der Hölle

Timothy R. O‘Neill – Das Grau der Hölle weiterlesen
Michael Innes – Appleby’s End

Michael Innes – Appleby’s End weiterlesen
Jean Ray – Das Storchenhaus
Diese zwölf Geschichten präsentieren Phantastik in formaler und sprachlicher Vollendung. Auf oft nur wenigen Seiten verfremdet der flämische Verfasser die Realität und kreiert ebenso spannende wie erschreckende Zwischenwelten, die trotz ihrer Drastik der Imagination des Lesers viel Raum lassen: eine wunderbare & wundersame Herausforderung!
|Das Storchenhaus| („Storchhaus ou la maison des cigognes“, 1961), S. 7-21: Das uralte Haus nimmt seine Bewohner gern – und buchstäblich – in sich auf …
|Die Nacht von Camberwell| („La nuit de Camberwell“, 1925), S. 22-25: Nur knapp entkam er mörderischen Einbrechern, doch in welchem Haus fand das nächtliche Feuergefecht eigentlich statt …?
|Die Geschichte des Wûlkh| („L’histoire du Wûlkh“, 1943), S. 26-37: Der berühmte Jäger überhört auf der Spur seiner größten Beute die Stimme der Vernunft …
|Die seltsamen Studien des Dr. Paukenschlaeger| („Les étranges études du Dr. Paukenschlaeger“, 1925), S. 38-44: Als dem Forscher der Durchbruch in eine fremde Dimension gelingt, hat man dort schon sehnlich – und hungrig – auf ihn gewartet …
|Mondköpfe| („Têtes-de-lune“, 1961), S. 45-53: An einem seltsamen Kindheitstag blieb das Leben des Kapitäns „hängen“ und erschöpft sich in ewiger und grotesker Wiederholung …
|Die Bank und das Tor| („Le banc et la porte“, 1964), S. 54-56: Die Schrecken der Kindheit kehren zurück und holen einen Mörder, der das Gesetz täuschen konnte …
|Smith, wie die meisten Leute| („Smith, comme tout le monde“, 1964), S. 57-60: Zu seinem Pech durchdenkt Mr. Smith die Konsequenzen nicht, als er entdeckt, wie böse Gedanken sich materialisieren können …
|Der „Tesseract“| („Le ‚Tesseract'“, 1964), S. 61-69: Das Ding aus der vierten Dimension erfüllt seinen Findern Wünsche, wobei es allerdings Wunschträume nicht von Albträumen unterscheiden kann …
|Der schwarze Spiegel| („Le miroir noir“, 1943), S. 70-88: Der Zauberspiegel sorgt für Reichtum und Schutz, bis das, was in ihm wohnt, die Rechnung stellt …
|Der letzte Reisende| („Le dernier voyageur“, 1932), S. 89-99: In der Nacht holt der Tod sein aktuelles Opfer; einen erschrockenen Zeugen will er gleich mitnehmen …
|Das große Notturno| („Le grand nocturne“, 1942), S. 100-134: Zwischen dem Hier und dem Nichts existiert das Reich des großen Notturno, der sehnliche Wünsche wahr werden lässt, wofür er aber einen hohen Preis verlangt …
|Die Straße des verlorenen Kopfes| („La rue de la Tête-Perdue“, 1938), S. 135-187: Als in einer englischen Kleinstadt biedere Bürger erst verschwinden, um später weit entfernt grässlich entstellt und tot wieder aufzutauchen, ruft dies den berühmten Detektiv Harry Dickson auf den Plan, der einen wahrhaft dämonischen Täter stellt …
_Die Faszination des schwer Verständlichen_
Normalerweise ist dieser Rezensent kein Freund der gänzlich realitätsfernen Phantastik. Natürlich verblüfft diese Aussage erst einmal, sind doch das Jenseits und seine spukhaften Bewohner generell alles andere als alltäglich. Aber die meisten Gruselgeschichten bedienen sich einer recht stringenten, chronologisch korrekten und „logischen“ Handlung. Die Medaille hat ohnehin zwei Seiten, wie eine zweite Frage belegt: Wie kann der Mensch in Worte fassen, was sich seinem Verständnis entziehen müsste? Und gerade dies ist eine Herausforderung, der sich Jean Ray einfallsreich stellt.
Es gibt verschiedene Möglichkeit, das Übernatürliche fremd wirken zu lassen und doch den Kontakt zum Leser zu schließen. Rays moderne „contes fantastiques“ wurzeln in der Realität, aber dort bleiben sie (wie in „Der schwarze Spiegel“ oder „Der letzte Reisende“) kurz und selten. Meist behält die Wirklichkeit nur wenige Zeilen die Oberhand. Nach und nach schleicht sich das Irreale ein, sorgt für erste Irritationen, hebelt die Erfahrung des Lesers, die ihm gleichzeitig Sicherheit gibt, heimlich (und herrlich heimtückisch) aus und stürzt ihn gemeinsam mit dem oder den Protagonisten in eine seltsame, nicht einmal klassisch gefährliche, sondern vor allem unbekannte und angsteinflößende Welt.
|Im Konflikt mit verdrängten Ängsten|
Dieser Übergang gelingt Ray sicherlich am elegantesten in „Das große Notturno“. In dieser längeren Erzählung wird außerdem deutlich, wie der Verfasser mit dem schwer verständlichen Geschehen die aus den Fugen geratene Seelenwelt der Hauptfigur spiegelt. Mit jenen Grundängsten, die dem Protagonisten oft nur dunkel oder gar nicht bewusst sind, beschäftigt sich Ray immer wieder.
Manchmal ist die Verbindung unmittelbar. In „Die Bank und das Tor“ nehmen Kindheitserinnerung Gestalt an und ziehen einen Mörder zur Verantwortung. „Der schwarze Spiegel“ des Dr. Dee ist nicht nur das Instrument, mit dem sich sein Besitzer ein neues Leben erzwingt, sondern wird auch zum Schlüssel, mit dem man sich Zugang zu einer Handlung verschaffen kann, die vergleichsweise genrekonform verläuft aber dennoch für Ray typisch nie eine echte Erklärung für das Geschehen bietet: Die Interpretation bleibt dem Leser überlassen.
Oft ist der Weg zum Verständnis steiniger. Über eine nur kurze Geschichte wie „Smith, wie die meisten Leute“ muss der Leser schon einige Zeit nachdenken, bis sie sich ihm erschließt. Ähnlich komplex sind „Die Geschichte des Wûlkh“ oder „Mondköpfe“. Hier wird Rays Konzept einer zeitlosen, traumähnlichen und regelfreien Zwischenwelt besonders deutlich. Sie existiert neben oder sogar in der Realität. Die meisten Menschen nehmen sie niemals wahr. Zufälle („Die Nacht von Camberwell“), ungute Neugier („Die seltsamen Studien des Dr. Paukenschlaeger“, „Der ‚Tesseract'“) und vor allem geistig-seelische Ausnahmezustände und Krisen lassen die Barriere aufweichen und zusammenbrechen, Welten oder Dimensionen vermischen sich: Es treffen sich „schlimme Zeiten, böse Orte“, wie Stephan Berg 1991 sehr prägnant seine gleichnamige Untersuchung über „Zeit- und Raumstrukturen in der phantastischen Literatur des 20. Jahrhunderts“ betitelte.
|Klare Worte für das Unaussprechliche|
Die Konfrontation mit dem Unbekannten wirkt umso dramatischer, weil Ray sie in vergleichsweise klarer Sprache quasi wie ein Dokumentarist schildert; „unerklärte, unheimliche Vorgänge, meist von einer sehr grotesken und skurrilen Natur, werden nüchtern als Tatsachen geschildert“, fasst es Franz Rottensteiner im Klappentext zur „Storchenhaus“-Sammlung zusammen.
Diese Nüchternheit wird nicht nur durch das Bizarre des Geschehens verstärkt, sondern von Ray durch eine an Charles Dickens erinnernde, ungemein humorvolle Gemütlichkeit in seinen idyllischen, von der Zeit übersehenen, wie aus einem früheren Jahrhundert stammenden Schauplätzen und Figuren konterkariert. Hinzu kommt Rays Hang zum Grellen und Drastischen („Der Eisenstab war … pfeifend wie ein Geschoss durch die Luft gesaust und hatte getroffen. Baxter-Brown hatte sich noch immer nicht geregt, als der andere bereits zusammengebrochen war und sein Blut in großen Wellen aus dem Kopf strömte …“, in: „Der schwarze Spiegel“, S. 81) und oft an die Splatter-Effekte moderner Horrorfilme erinnert („Er verschwand in einer Flut von Speichel und Säure“, in: „Das Storchenhaus“, S. 18).
|Zwischen Sherlock Holmes und Fox Mulder|
Eine gewisse Ausnahmestellung nimmt in dieser Sammlung die Novelle „Die Straße des verlorenen Kopfes“ ein. Sie erschien ursprünglich als Nr. 176 von insgesamt 178 Heft-Romanen, die zwischen 1929 und 1938 die Abenteuer des Sherlock-Holmes-Klons Harry Dickson erzählten. Ray übersetzte die ursprünglich in Deutschland entstandenen und bereits vorliegenden Hefte für den belgischen und französischen Markt. Unzufrieden mit der Qualität dieser Vorlagen, ging Ray schon 1930 dazu über, sie zu bearbeiten. Zwei Jahre später verfasste er eigene Dickson-Abenteuer und hielt die Serie allein bis 1938 in Gang.
„Die Straße des verlorenen Kopfes“ ist gleichzeitig reines Unterhaltungsprodukt und echter Jean Ray. Harry Dickson lebt und ermittelt in einer irrealen Welt. Eher oberflächlich bedient er sich der bekannten kriminologischen Methoden; er ermittelt in Fällen, die das gesamte Spektrum der trivialen Phantastik umfassen. Die Umtriebe verrückter Wissenschaftler, Außerirdischer oder wie hier reinkarnierter Dämonen sind völlig normal in Dicksons Welt. Ray kreiert keine große Literatur, aber er spielt hemmungslos mit den Genres und spinnt ein logisch oft schwer nachzuvollziehendes aber unterhaltsames Garn, das die Liebe des Verfassers zu einer Arbeit, die ihm nicht nur Job war, deutlich ahnen lässt und wohl auch deshalb heute noch fasziniert.
Deshalb ist es nicht nur doppelt, sondern dreifach schade, dass Jean Ray zumindest in Deutschland nie aus seiner Nischenposition entkommen konnte. Nur ein verschwindend geringer Teil seines Werkes ist hierzulande erschienen. Für „Das Storchenhaus“ hat Herausgeber Kalju Kirde (1923-2008) Geschichten herausgesucht, die repräsentativ für Rays Werk sind. Er hat klug gewählt, denn davon wünscht sich der Leser mehr!
_Autor:_
Nach eigener Auskunft war Raymundus Johannes Maria Kremer ein Abenteurer, Weltreisender, Schmuggler, Pirat, was man ihm nach der Lektüre seiner farbenprächtigen, schnurrigen, quicklebendigen Geschichten gern glauben möchte. Allerdings stimmt kein Wort davon; der vermeintliche Tausendsassa hat seine belgische Heimatstadt Gent, in welcher er am 8. Juli 1887 ins kleinbürgerliche Milieu geboren wurde, kaum verlassen. Nach gescheitertem Studium arbeitete er ab 1910 für die Stadtverwaltung, 1919 wurde er Journalist.
Als Schriftsteller entwickelte sich Kremer zu einem ungemein fleißigen Autor. Sein Œvre lässt sich dreiteilen. Da gab es Jean Ray, den Autoren unzähliger (französischsprachiger) Kurzgeschichten, die sich dem phantastischen Genre zuordnen lassen. Als „John Flanders“ oder unter einem anderen seiner zahlreichen Pseudonyme schrieb Kremer – in flämischer Sprache – Abenteuerromane für eher jugendliche Leser, aber auch etwa 300 Storys mit starken Science-Fiction- und Fantasy-Elementen. Schließlich war Kremer noch der ungekrönte, wenn auch anonyme König des belgischen Heftromans, für den er die unglaublichen Abenteuer des Detektivs Harry Dickson in Serie spann.
Trotz seines gewaltigen literarischen Ausstoßes gilt Raymundus de Kremer als einer der Großen der europäischen Phantastik. Vor allem die in den 1940er Jahren entstandenen Geschichten und Romane werden von der Kritik gelobt. In den 1950er kehrte Kremer in die Minen der Trivial-Unterhaltung zurück. Vor dem endgültigen Versinken in obskure Anonymität bewahrte ihn die Neuveröffentlichung seiner Hauptwerke, doch das breite Publikum registrierte es nicht, als Kremer am 17. September 1964 im Alter von 77 Jahren starb.
Über Kremers Leben und Werk informiert ausführlich diese (französischsprachige) Website: www.noosfere.com/heberg/jeanray
Taschenbuch:. 188 Seiten
Originalzusammenstellung (ausgewählt von Kalju Kirde)
Übersetzung: Hilde Linnert u. Willy Thaler
Dt. Erstveröffentlichung: Januar 1986 (Suhrkamp Verlag/TB Nr. 1299 = Phantastische Bibliothek Nr. 182)
ISBN-13: 978-3-518-37799-4
www.suhrkamp.de
J. S. Fletcher – Verbrechen in Mannersley

J. S. Fletcher – Verbrechen in Mannersley weiterlesen