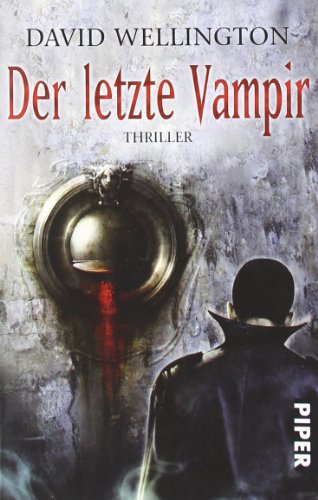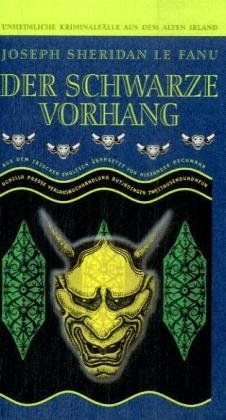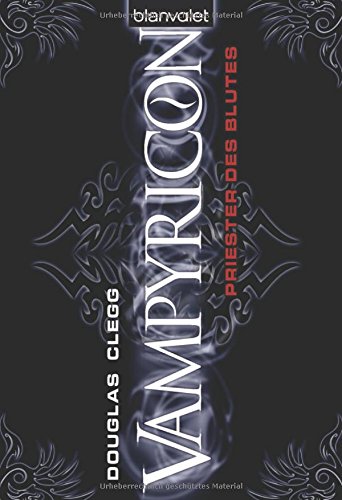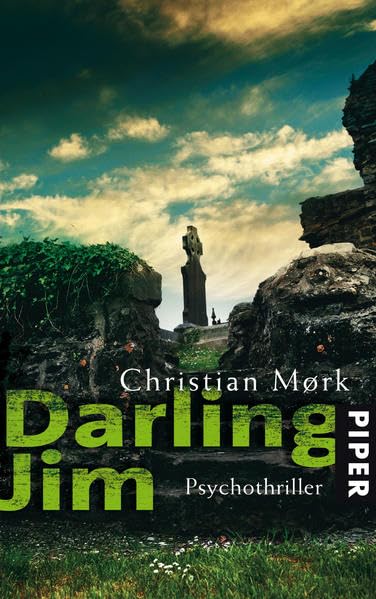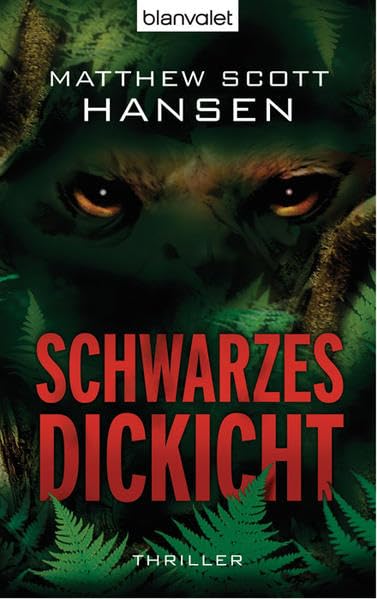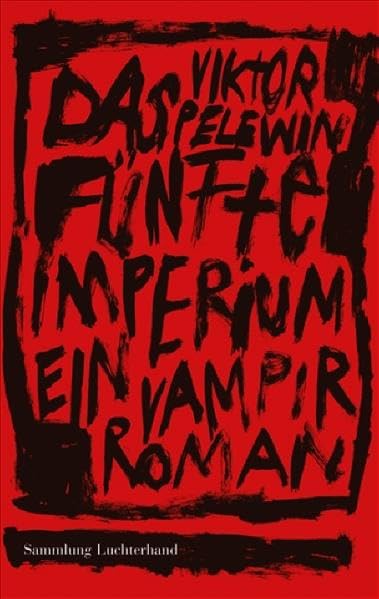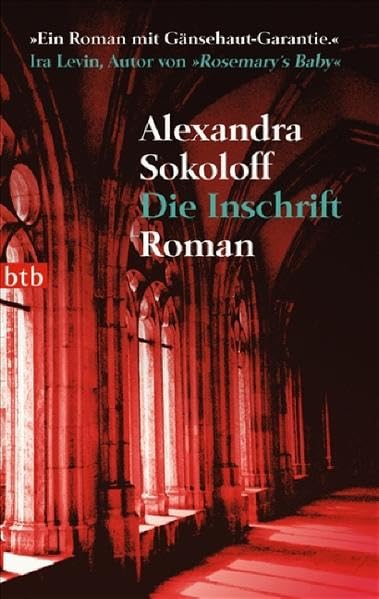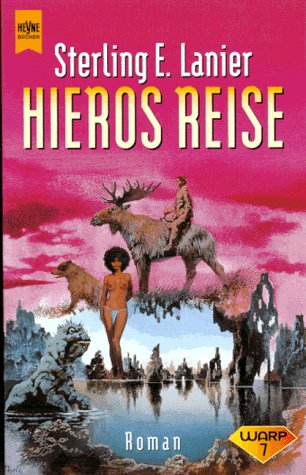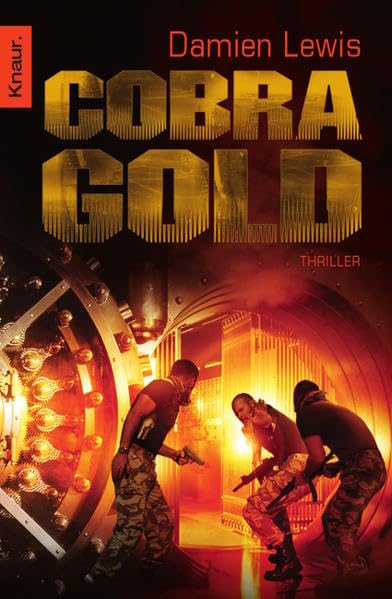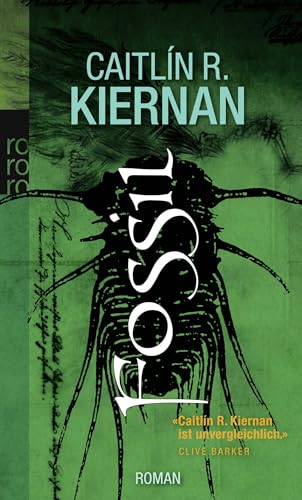_Das geschieht:_
Der Krieg zwischen Mensch und Vampir schien 1983 mit dem Sieg der Lebenden über die lebendigen Toten beendet zu sein, als Special Deputy Jameson Arkeley den Schlupfwinkel des Vampirfürsten Piter Byron Lares aushob und diesen mitsamt seinen letzten Getreuen dem Feuertod überantwortete. Es ‚überlebte‘ nur die Vampirfrau Justinia Malvern, die seitdem in einer geheimen Forschungsstation gefangen gehalten wird.
Zwei Jahrzehnte später ruft man im US-Staat Pennsylvania State Trooper Laura Caxton an den Schauplatz einer spektakulären Fahrerflucht: Zurück blieb nur ein Arm, der vom Körper getrennt eindeutige Lebenszeichen zeigt. Das ruft Arkeley auf den Plan, der vampirisches Wirken erkennt und den Fall im Namen des FBI an sich zieht; Caxton ernennt er kurzerhand zu seiner Assistentin.
Offensichtlich flammt der Krieg mit den Untoten wieder auf. Es ist Malvinias Brut, die im Untergrund neue Kräfte geschöpft und sich mit Zombie-Sklaven umgeben hat. Nun sind die Vampire bereit für eine blutige Rückkehr. Arkeley haben sie dabei nie vergessen; sie fürchten, bewundern und hassen ihn nicht grundlos, denn ihr alter Feind reagiert nicht nur auf ihre Attacken, sondern trägt den Kampf unverzüglich in die Reihen der Blutsauger, um deren Aufstand möglichst im Keim zu ersticken. Dabei ist Arkeley jedes Mittel recht.
Wohl oder übel folgt ihm Caxton in immer neue Vampir-Schlupfwinkel, in denen das Grauen auf sie lauert. Gnadenlos formt Arkeley sie zu einer Kriegerin in ’seinem‘ Kampf. Schwäche und Widerspruch duldet er nicht, denn je näher Arkeley und Caxton den Vampiren kommen, desto härter schlagen diese zu, um sich endlich ihrem eigentlichen Ziel widmen zu können: Die Erde soll von ihnen beherrscht und die Menschheit als Schlachtvieh unterdrückt werden …
_Die Freiheiten des lebendigen Todes_
„Subtil“ ist zweifellos das falsche Attribut für dieses wahrlich monströse Vampir-Spektakel! Schon der (Original-)Titel gleicht einer Breitseite: 13 Kugeln fasst das Magazin der Pistole Marke Glock, die Vampirjäger Arkeley ausgiebig zückt. David Wellington scheint den Entschluss gefasst zu haben, möglichst das Gegenteil der derzeit so erfolgreichen und beliebten Schmuse-Vampir-Schmonzetten zu verfassen. Dabei schießt er zwar mehrfach über das Ziel hinaus, leistet aber insgesamt gute und gründliche Arbeit.
Vampire sind zwiespältige Gestalten. Das betrifft nicht nur ihren Status als lebende Tote bzw. Untote. In der Literatur stehen sie bereits im 19. Jahrhundert (und viele Jahre vor „Dracula“) für die Befreiung des Menschen von den Regeln und Zwängen, denen er sich im (lebendigen) Alltag ausgesetzt sieht. Der Vampir hat sich ihrer entledigt. Er muss sich nicht mehr vom Gesetz, vom schnöseligen Chef und von der Schwiegermutter gängeln lassen. Auch an Vorschriften in Liebesdingen hält er sich nicht mehr. Vampire greifen sich je nach Geschlecht Frauen und Männer, wenn es sie nach ihnen gelüstet.
Diese Freiheit geht nach dem Willen derer, die Vampir-Geschichten schreiben, mit Disziplinlosigkeit einher: Die Untoten bedienen sich ihrer besonderen Talente eigennützig. Bis zur Beanspruchung der Weltherrschaft ist es anschließend offensichtlich nur noch ein kurzer Schritt, den alle großen Vampire zu gehen pflegen; die Entwicklung eines psychotischen Cäsarenwahns scheint sogar integrales Element der Vampir-Werdung zu sein. Der Mensch ist dem Vampir nur Vieh, das ihm sein Blut bietet bzw. zu bieten hat. Dass dieses Verhältnis im Detail doch sehr viel fragiler und nuancenreicher ist, wird von zahlreichen Schriftstellern thematisiert und letztlich übertrieben: Der Vampir wird zum platonisch-skrupulösen Liebhaber zögerlicher Jung-Maiden, die ihm sogar den Blutgenuss verleiden.
_Hart aber herzlos_
Zu dieser zahnschwachen Vampir-Kategorie gehören die Blutsauger des David Wellington ganz sicher nicht. Sie verlieren mit dem Tod die Bedürfnisse und Bedenken ihrer menschlichen Erst-Existenz und verwandeln sich mit Haut und Haar in kluge, gierige, bösartige Nachtmahre. Man muss ihr Herz zerstören, um sie umzubringen; ansonsten kann man sie mit Kugeln spicken, ohne sie dadurch aufzuhalten. Silber, Kreuze, Knoblauch und andere tradierte Instrumente des Vampir-Tötens sind nutzlos, Licht schwächt die Blutsauger höchstens. Wer von ihnen getötet wird, kann von ihnen – eine Hommage an Pennsylvanias Horror-Großmeister George A. Romero? – in einen Zombie-Sklaven verwandelt werden. Der Kampf gegen diese Kreaturen wird zu einem Hauen, Stechen und Schlachten, wobei die daraus resultierenden Begleiterscheinungen vom Verfasser mit großer Liebe zum Detail beschrieben werden.
Ein solcher Gegner benötigt einen Verfolger, der sogar aus noch härterem Holz geschnitzt ist. Jameson Arkeley erfüllt diesen Anspruch. Er hat sein Leben der Jagd auf Vampire geweiht und sich darüber in einen Zeitgenossen verwandelt, der sich zumindest psychisch seinen Todfeinden stärker angenähert hat als ihm lieb sein kann oder von ihm zugegeben würde. Wie weit Arkeley auf diesem Weg bereits gegangen ist, verdeutlicht sein Umgang mit der neuen Partnerin Laura Caxton, für die das Hetzen von Vampiren Neuland bedeutet. Caxton sorgt nicht nur für das ‚menschliche‘ Element, indem sie Unsicherheit, Furcht, Verzweiflung und ähnliche Gefühle signalisiert. Sie repräsentiert außerdem den Leser, der sich Fragen zum Geschehen stellt, die Caxton an Arkeley weiterleitet.
_Ein Krieg im Zeitraffer-Tempo_
Der Kampf gegen die Blutsauger findet offensichtlich unter Zeitdruck statt. Wellington baut dies geschickt ein: Vampire gilt es rasch zu erwischen, bevor sie sich allzu stark vermehren. Tempo wird außerdem vorgelegt, weil sich die Vampire und ihre Verbündeten sehr nachdrücklich PS-starker Automobile und Motorräder bedienen. Zudem steht Arkeley auf dem Standpunkt, dass man sich in eine offensichtliche Falle stürzen muss, bevor diese sich planmäßig schließt. Diese aggressive Taktik ist erwartungsgemäß unsicher, was für neuerliche Stakkato-Gefechte und ein weiteres Emporschnellen des ohnehin eindrucksvollen Bodycount-Quotienten sorgt.
„Der letzte Vampir“ ist kein raffiniert gestricktes Garn. Stilistisch bleibt der Verfasser denkbar schnörkellos, wobei dies ein freundliches Urteil ist. Voran, voran, so lautet die Devise Wellingtons, der auf diese Weise den Ursprung seiner in Fortsetzungen entstandenen Romane als „serials“ enthüllt. Die dünne Charakterisierung erinnert an die „Underworld“-Filme, in denen ebenfalls der mit Action-Episoden gespickte Weg das Ziel ist. Trivial bis trashig setzt Wellington seine Mär in Szene. Auch deshalb ist „Der letzte Vampir“ ein Antipode zum aktuellen Romantik-Vampir, wie ihn u. a. Stephanie Meyer kreierte.
Während dieser vor allem als sexfreie Projektions-Figur über eine Schar pubertierender Jungmädchen kommt, liefert Wellington Alternativ-Stoff für die harten Jungs. Der Schrecken, der blutig wirkt, aber nicht ist, bleibt stets oberflächlich. Wellingtons Vampire weisen keine besondere Intelligenz auf, die allein sie wirklich einschüchternd machen könnte. Exakte Vorstellungen über eine untote Weltherrschaft scheinen sie nicht zu haben. Ihre Bösartigkeit ist vordergründig, ihre düsteren Drohungen wirken eher komisch, und ihre Zombie-Knechte sind es mit Sicherheit.
„Der letzte Vampir“ ist eine jederzeit leichte Lektüre. Autor Wellington hat sie so konzipiert und umgesetzt. Das wird durch die Geschwindigkeit bestätigt, mit der diesem ersten Roman zwei Anschlussbände folgen konnten, die das Konzept des Radau- und Action-Horrors aufnahmen, ohne ihm Anregungen geben zu können oder zu wollen. Wie Meyer & Co. findet Wellington ein bzw. ’sein‘ Publikum, das genau solche anspruchsarmen, aber unterhaltsamen Spektakel goutiert.
_Der Autor_
David Wellington wurde 1971 in Pittsburgh (US-Staat Pennsylvania) geboren. Er studierte an der Syracuse University (US-Staat New York) und an der Pennsylvania State University und arbeitete als Archivar in der Bibliothek der Vereinten Nationen.
Seine Schriftsteller-Karriere startete Wellington abseits der üblichen Verlagsschiene. Er postete erste Romane im Rahmen seines Blogs, setzte sie auf diese Weise dem Urteil seiner Leser aus und berücksichtigte Kritik für die letztlich erfolgende Drucklegung seiner Werke, die aufgrund des enormen Publikumsechos nicht lange auf sich warten ließ. Dieses Prozedere garantierte ihm den gewünschten Zugriff auf seine Stoffe, die ungleich rabiater und kompromissloser daherkommen als das Gros des modernen Mainstream-Horrors. Dabei sind Wellingtons Protagonisten eigentlich klassisch: Er schreibt über Vampire, Zombies und Werwölfe, die er indes einer radikalen Neugestaltung unterzieht und jeglicher Romantisierung entkleidet.
Wellington hat die Online-Veröffentlichung als Lockmittel und Testversion beibehalten. Auch „Thirteen Bullets“ lässt sich gratis lesen. Solche Großzügigkeit kann sich der Verfasser inzwischen leisten, da seine Romane im Buch nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen Ländern der Welt veröffentlicht werden.
Websites:
– http://www.brokentype.com/davidwellington
– http://www.thirteenbullets.com
Die „Vampir“-Trilogie von David Wellington erscheint im |Piper|-Verlag:
(2007) Der letzte Vampir („Thirteen Bullets) – TB Nr. 6643
(2007) Krieg der Vampire („99 Coffins“) – TB Nr. 6645
(2008) Vampirfeuer („Vampire Zero“) – TB Nr. 6721
_Impressum_
Originaltitel: Thirteen Bullets (New York : Three Rivers Press/Random House 2007)
Übersetzung: Andreas Decker
Deutsche Erstausgabe: November 2007 (Piper Verlag/Piper Fantasy 6643)
381 Seiten
EUR 8,95
ISBN-13: 978-3-492-26643-7
http://www.piper-verlag.de