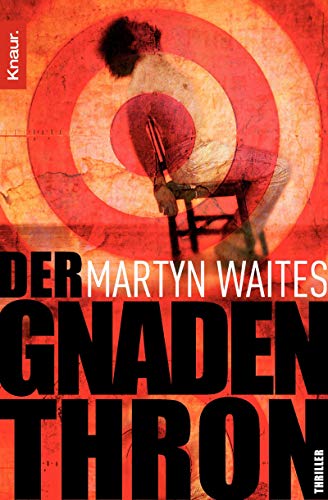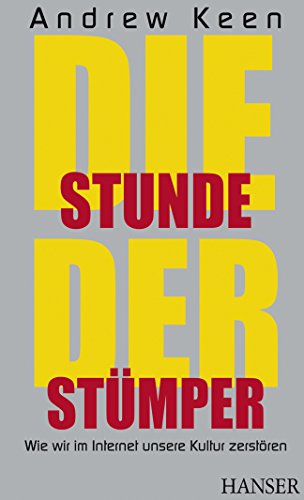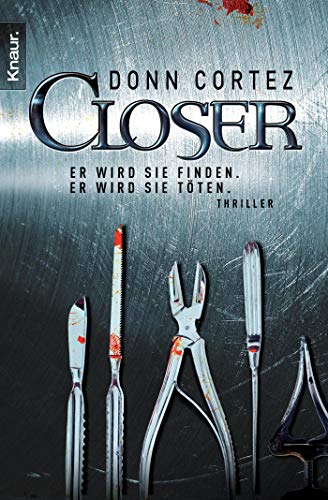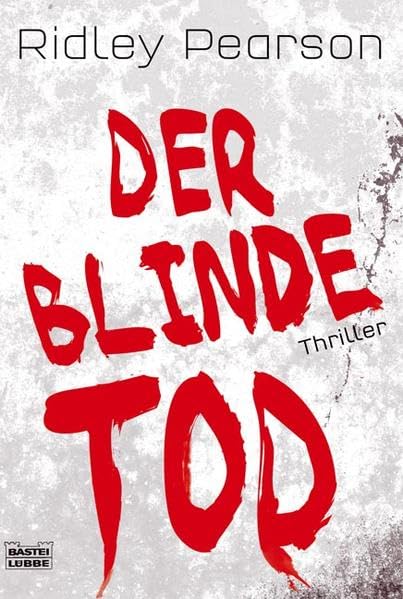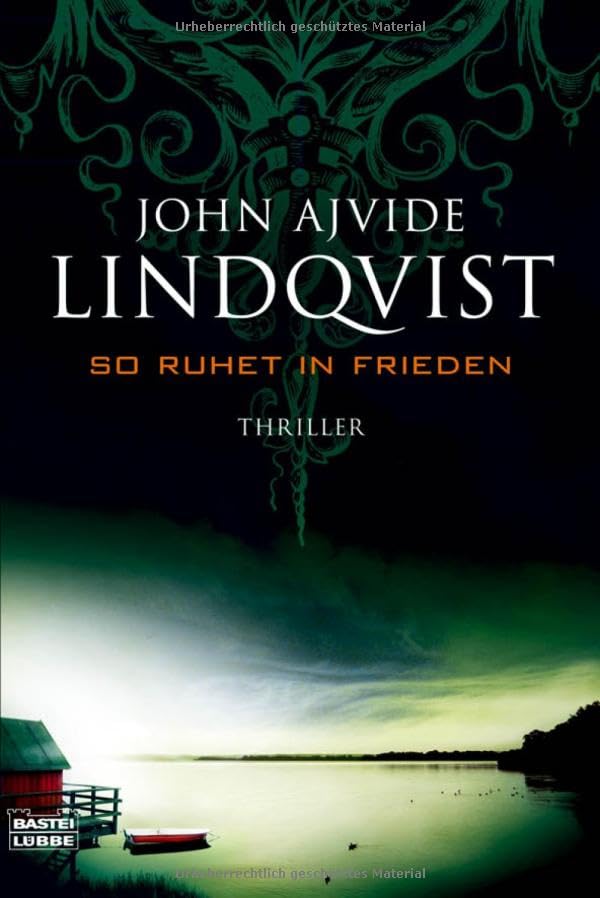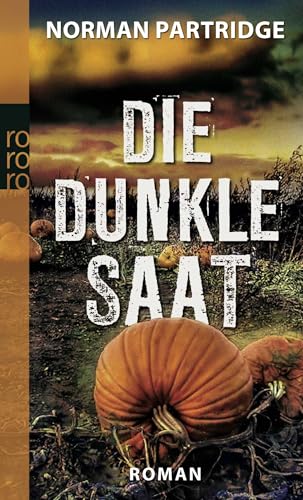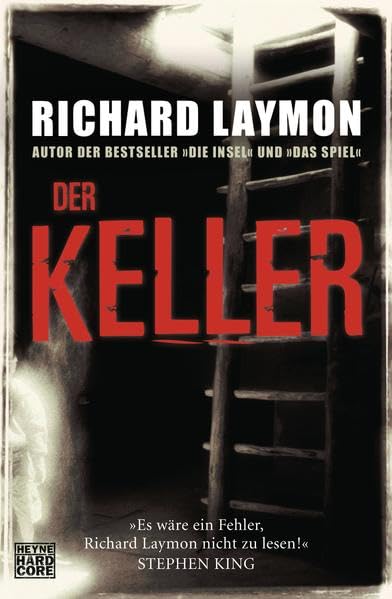Sax Rohmer – Die Feuerzunge weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Christa Faust – Hardcore Angel

Christa Faust – Hardcore Angel weiterlesen
Dennis Shryack/Michael Butler – Der Teufel auf Rädern

Dennis Shryack/Michael Butler – Der Teufel auf Rädern weiterlesen
Waites, Martyn – Gnadenthron, Der
_Das geschieht:_
Keine 15 Jahre ist Jamal alt, aber schon lange familien- und heimatlos. Als Strichjunge schlägt er sich in London durch. Sein Pech bleibt ihm treu: Aus einem Hotelzimmer lässt er einen Mini-Disc-Player mitgehen, der ausgerechnet dem „Hammer“ gehört, einem in der Unterwelt gefürchteten Killer mit saphirblauem Schneidezahn, der seine Opfer auf dem „Gnadenstuhl“ zu Tode zu foltern pflegt. Seine letzte ‚Sitzung‘ hat er auf eine Mini-Disc aufgezeichnet, die Jamal mit besagtem Player in die Hände fiel.
Der Dieb weiß, was seine Beute im 21. Jahrhundert wert ist: Er wendet sich nicht an die Polizei, sondern an die Medien und verlangt viel Geld für die Disc. Als Kontaktperson fordert Jamal den Starreporter Joe Donovan. Der ist allerdings ein ausgebrannter und selbstmordgefährdeter Säufer, seit sein Sohn vor zwei Jahren spurlos verschwand. Erst das Angebot, die Ressourcen der Zeitung für eine ausgedehnte Suchaktion einzusetzen, lässt ihn wieder einsteigen.
Jamal hat sich inzwischen nach Newcastle abgesetzt. Er weiß, dass ihm Hammer auf den Fersen ist. Untergetaucht ist er ausgerechnet bei „Father Jack“, einem sadistischen Mafioso, der von Jamals Coup Wind bekommen hat. Auch Donovan gerät in Schwierigkeiten. Der Journalist Gary Myers, der einen Korruptionsskandal recherchierte, wurde von Hammer gekidnappt. Unter der Folter hat Myers auch Donovans Namen genannt, und als dieser Verbindung mit Jamal aufnimmt, setzt er sich selbst auf Hammers Liste.
Gemeinsam nehmen Donovan und Jamal den ungleichen Kampf auf, in den sich zwei schlagkräftige Privatdetektive einmischen. Als Donovan in Erfahrung bringt, dass Hammer einen Auftraggeber hat und er dessen Namen zu enthüllen droht, ist sein Leben endgültig keinen Pfifferling mehr wert. Hammer ist ihm und Jamal ganz nah, und der Gnadenstuhl steht bereit …
_Krimi aus der britischen Mitte = mittelmäßiger Krimi?_
Newcastle-upon-Thyne ist eine Stadt im Norden Englands, gelegen etwa zwischen London und Edinburgh. Als Schauplatz kriminalliterarischer Aktivitäten ist sie bisher nicht bekannt geworden, eine Tatsache, der Martyn Waites offenbar ohne weitere Verzögerung abhelfen möchte. Intensiv bemüht er dafür jene modernen Ingredienzen, die – geschickt eingesetzt – Gesellschaftskritik suggerieren und als solche wohlwollend zur Kenntnis genommen werden.
Hier sind Reizthemen wie soziale Ausgrenzung, moralische Verrohung und globalisierte Menschenverachtung die Pfunde, mit denen Autor Waites wuchern möchte. Er mischt sicherheitshalber Folter, Pädophilie und „Spurlos-verschwunden“-Melancholie hinzu. Die daraus resultierende Übertreibung ist eine trittsichere Brücke zur Lächerlichkeit. Das Böse ist für Waites darüber hinaus nicht nur Wesenszug, sondern auch prägend für das Äußere. Diese Ansicht führt zu Figuren wie „Father Jack“ und dem „Hammer“: Was jeweils als Kreatur aus der Hölle namens „Menschheit“ geplant ist, wirkt eher wie eine Karikatur.
_Das Böse wirkt blöde_
Waites gibt sich erfolgreich große Mühe mit dem Ausdenken scheußlicher und detailreich geschilderter Brutalitäten. Weil er sie durch horrorfilmkompatible Klischee-Gestalten (Satanist mit blauem Zahn, Kinderschänder mit Mastschwein-Korpus) zum Einsatz bringt, verlieren sie an Intensität und verkommen zur Masche: Folter-Thriller à la „Hostel“ oder „Saw“ sind just erfolgreich, also rankt sich diese Geschichte um den „Gnadenstuhl“, der im ersten Drittel zum Einsatz kommt und später keine Rolle mehr spielt.
Die Weißkragen-Bösewichte scheinen zunächst nicht in dieses Bild zu passen. Bei näherer Betrachtung dominiert auch hier das Klischee: Wenn im Prolog „Mephisto“ als aalglatter Herr & Meister seinen Folterknecht „Hammer“ wüten lässt, begleitet er das mit jenem hochtrabenden Geschwätz, das Quentin Tarantino für seine Film-Gangster kultiviert hat. Die angebliche Ungerührtheit des smalltalkenden Schurken soll besondere Seelenkälte suggerieren. Dieser Kniff ist inzwischen jedoch so häufig zum Einsatz gekommen, dass er seine Wirkung verloren hat. Zumindest Waites kann ihm kein neues Leben einhauchen.
_Zu „böse“ passt „tragisch“?_
Alles Leid der Welt lädt der Verfasser auf Jamals schmale Schultern. Er muss personifizieren, was falsch läuft in der modernen Großstadtwelt. Das wirkt eine gewisse Weile verstörend, weil Waites üble Dinge in klare Worte zu fassen weiß. Allmählich verliert er jedoch entweder die Konzentration oder das Interesse an Jamals Schicksal. Tritt er im letzten Drittel noch auf, wirkt das eher pflichtschuldig: Als Hauptfigur kann ihn sein geistiger Vater schwerlich spurlos verschwinden lassen.
Ins Zentrum rückt nunmehr Joe Donovan. Nicht nur in der Kriminalliteratur ist der angeschlagene Journalist, der im tiefsten Elend sich und seine Berufsehre wiederfindet, eine oft und gern eingesetzte Figur. Einmal mehr geht Waites auf Nummer Narrensicher. Also: Donovan wurde der Sohn entführt, das hat er nie verwunden, seine Ehe zerbrach, er säuft und schleppt einen gewaltigen Colt mit sich herum, den er sich von Zeit zu Zeit dramatisch an die Stirn hält. Wenn diese Charakterskizze sarkastisch klingt, dann liegt es abermals an Waites Hang zur Übertreibung.
Der Schar unserer vom Leben gar sehr gezausten Gutmenschen gesellt sich ein ungleiches Privatdetektiv-Duo hinzu. Er ist schwul und versinkt im Drogennebel, sie schleppt die Erinnerung an eine selbstzerstörerische Liebe mit sich herum. Glücklicherweise erwachen sie stets dann aus ihrem Kummer, wenn es mit brachialer Gewalt Schurkenschädel zu knacken gilt …
Möchte man die Biografie des Verfassers mit diesen grellen Effekten in Einklang bringen, ließe sich als Begründung Waites‘ beruflicher Hintergrund anführen: Er arbeitete als Schauspieler für das Fernsehen, das auch in England auf dem Standpunkt steht, dass es ein Zuviel an knackigen Klischees gar nicht geben kann. Allerdings sollte man mit solchen Verallgemeinerungen Vorsicht walten lassen; möglicherweise hat Martyn Waites einfach verinnerlicht, dass es dem Verkaufserfolg nur nützen kann, wenn seine Werke so viel wie möglich von dem berücksichtigen, was den „Thriller der Woche“ auf den Abgreif-Paletten moderner Buchhandelsketten auszeichnet …
_Autor_
Martyn Waites wurde in der Stadt geboren, in der seine Krimis spielen: Newcastle-upon-Tyne. Hinter ihm liegen jene obligatorischen Lehr- und Wanderjahre, die sich gut in der Biografie eines später erfolgreichen Schriftstellers machen. Waites listet unter anderem Jobs als Straßenverkäufer, Barkeeper und Schauspiellehrer auf. Letzteres ließ ihn die Schauspielschule in Birmingham besuchen, die er nach drei Jahren abschloss. In den nächsten Jahren arbeitete Waites viel fürs Theater. Er trat in TV-Serien und Filmen auf, wobei er über Nebenrollen nie hinauskam.
In den frühen 1990er entstanden (nie veröffentlichte) Theaterstücke und erste Kurzgeschichten. Waites liebt die Werke von US-Autoren wie James Ellroy, James Lee Burke, Andrew Vachss, Eugene Izzi und anderen Vertretern des ‚harten‘, zeitgemäßen, realistischen Krimis, den er in Großbritannien unterrepräsentiert fand. Er verinnerlichte die genannten Vorbilder und siedelte seine eigenen Geschichten in Newcastle an, wo er inzwischen nicht mehr lebte, seine Verbindungen jedoch aufrechterhalten hatte.
1997 erschien „Mary’s Prayer“, der erste Roman einer Serie um den Reporter Stephen Larkin, der mit seinen privaten Problemen mindestens ebenso heftig zu kämpfen hat wie mit seiner Arbeit, die ihn immer wieder auf die Schattenseiten der modernen Wohlstandsgesellschaft führt. Diese Problematik prägte Waites auch dem Journalisten Joe Donovan auf, der 2006 in „The Mercy Chair“ debütierte und Larkin offenbar abgelöst hat.
Über Leben und Werk informiert Martyn Waites auf seiner Website: http://www.martynwaites.com.
_Impressum_
Originaltitel: The Mercy Seat (London : Pocket Books 2006)
Übersetzung: Ulrich Hoffmann
Deutsche Erstausgabe: Juli 2008 (Knaur Taschenbuch Verlag/TB Nr. 63611)
473 Seiten
EUR 8,95
ISBN-13: 978-3-426-63611-4
http://www.knaur.de
Lee Child – Sniper (Jack Reacher 9)
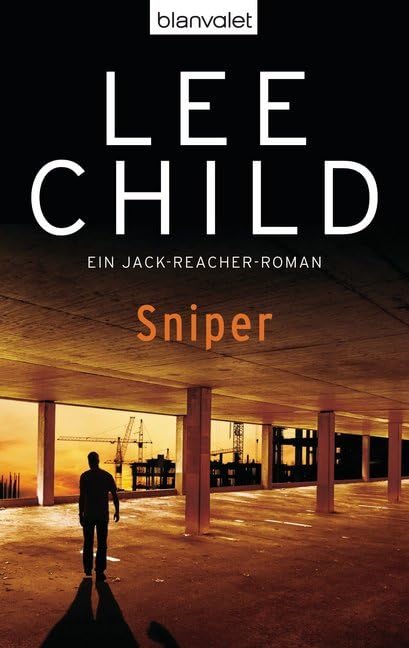
Lee Child – Sniper (Jack Reacher 9) weiterlesen
Donald E. Westlake – Mafiatod

Donald E. Westlake – Mafiatod weiterlesen
Keen, Andrew – Stunde der Stümper, Die
_Eine digitale Höllenfahrt in neun Kapiteln_
Im 21. Jahrhundert scheint ein alter Menschheitstraum endlich Wahrheit geworden zu sein: Die weite Welt ist durch das Internet 2.0 vernetzt, der Informationsprozess bleibt nicht länger einer Elite von Forschenden und Wissenden vorbehalten. Jede Frau und jeder Mann, die oder der sich berufen fühlt, kann einsteigen und öffentlich = global ihre/seine Meinung kundtun. Es wird gebloggt, was die Leitungen hergeben; heute teilt sich eine Menschenschar in unbekannter, aber dreistelliger Millionenzahl regelmäßig über das Internet mit. Sie beschränken sich nicht auf die Ausstellung persönlicher Befindlichkeiten. ‚Wissenschaftliche‘ Artikel aus den Natur- und Geisteswissenschaften stehen neben tagesaktuell vorgestellten & kommentierten Neuigkeiten; Romane, Gedichte, Musik und neuerdings Filme zeugen von der kreativen Ader der Internet-2.0-Gemeinde.
Längst sind Wirtschaft und Politik aufmerksam geworden und nutzen das Web zur Realisierung eigener Vorhaben. Internetportale sind wertvoll geworden. Immer größere Informations- und Unterhaltungsdateien treten ihre digitale Reise an. Die Welt verwandelt sich in einen riesengroßen, kunterbunten Selbstbedienungsladen, in dem alles ständig verfügbar ist.
Oder? Mit einer gewissen Verspätung treten die Kritiker des Internet 2.0 auf den Plan. Sie haben es schwer, denn ihnen zuvor kamen die Befürworter und Profiteure, die von unendlichen Möglichkeiten schwärmten und gewaltige Gewinne ankündigten. Dass noch jede Innovation in der Geschichte der Menschheit ihre Schattenseiten hatte, wurde geflissentlich ausgeblendet. Wieso ausgerechnet das Internet 2.0 so lange nicht kritisch hinterfragt wurde, ist eines der Themen, denen sich Andrew Keen in „Die Stunde der Stümper“ nicht nur mit viel Wissen, sondern auch mit Verve widmet.
_Wird der Planet der Affen Realität?_
In den 1990er Jahren war Autor Keen selbst im berühmt-berüchtigten kalifornischen Silicon Valley tätig und ein eifriger Vertreter der „Neuen Medien“. Er kennt die Materie deshalb gut, und auch wenn er sich allzu kompromisslos vom Saulus zum Paulus gewandelt hat – dazu weiter unten mehr -, beeindrucken und beunruhigen die Fakten, mit denen er seine Thesen untermauert.
Eine endlose Kette aufgedeckter Internet-Sünden bildet den roten Faden in einem ansonsten recht wüst (oder wenig) gegliederten Buch, was Keen in seinem Nachwort gar nicht leugnet. „Wes‘ Herz ist voll, des‘ Mund läuft über“: Diese Haltung verleiht dem Verfasser Schwung und Überzeugungskraft, aber es lässt ihn auch wie eine wütende Gämse von Thema zu Thema springen.
In neun Kapitel presst Keen seine Darstellung. Mit einem Paukenschlag beginnt er: seiner Einleitung, die den angedeuteten Erweckungsprozess schildert, der in diesem Buch gipfelte. Schon auf diesen ersten Seiten legt Keen sich keinerlei Zurückhaltung auf. Ausgehend von einem bekannten Lehrsatz des Evolutionsbiologen Thomas Henry Huxley (1825-1890), nach dem man nur eine unendliche Anzahl von Affen mit Schreibmaschinen ausrüsten müsse, die irgendwann ein literarisches Meisterwerk vom Format eines Dramas von Shakespeares liefern würden, definiert Keen den Alltag des Internet 2.0 so: |“Doch … Millionen und Abermillionen übermütiger Internetnutzer, von denen vielen nicht mehr Talent haben als unsere äffischen Verwandten, produzieren keine Meisterwerke, sondern einen endlosen Dschungel der Mittelmäßigkeit. Diese Amateuraffen von heute können mit ihren vernetzten Computern nämlich alles publizieren: politische Kommentare ohne Informationsgrundlage, ungehörige selbst gedrehte Videos, peinliche Amateurmusik oder unlesbare Gedichte, Rezensionen, Essays und Romane.“| (S. 10)
Mit dem Sturz des „edlen Amateurs“ (der deutsche Titel ‚übersetzt‘ dies marktschreierisch als „Stümper“), der sich dank Internet vor allem selbst auf sein hohes Ross gesetzt hat, beginnt Keen denn auch seine Expedition in ein digitales Land des Grauens, erzählt von selbst ernannten „Bürgerjournalisten“, die ohne jede Vor- oder journalistische Ausbildung das Internet mit Halb- und Null-‚Wissen‘ verstopfen und damit Glauben finden, weil die menschliche Mehrheit lieber glaubt, was sie glauben möchte, und simplifizierte Gedankengänge der oft komplexen Realität vorzieht. Weiter geht es mit „Spammern und Abzockern“, mit Lügnern, Wirrköpfen, Faktenverdrehern und anderen manipulativen Zeitgenossen, die im Internet endlich das Medium gefunden haben, über das sie, die bisher mit Fug und Recht mit Fußtritten davongejagt wurden, ihren Schwachsinn verbreiten können.
Das Kapitel „Wahrheit und Lügen“ räumt mit dem Irrglauben auf, dass Blogs der Welt etwas zu sagen haben. In der Regel ist es reine Nabelschau, die auf diese Weise betrieben wird, was kräftig dazu beiträgt, die wenigen lohnenswerten bzw. künstlerisch relevanten Texte, Musikstücke oder Filme im weißen Hintergrundrauschen des Internet 2.0 untergehen zu lassen.
_Der Autor, der Dieb, seine User und ihre Nutznießer_
„Wikipedia“ und „YouTube“ sind besonders rote Tücher für Keen, was er wiederum mit deprimierend einsichtigen Beweisen belegen kann. Unter dem Titel „The Day the Music Died“ beschäftigt er sich intensiv mit der Frage des geistigen Eigentums. In einer Ära der digitalen Tauschbörsen ist dank der modernen technischen Möglichkeiten nichts mehr vor dem unendlichen Kopieren sicher, was unter anderem die Musikbranche in eine existenzielle Krise stürzte; in einen ähnlichen Abgrund wird wohl auch das kommerzielle Kino stürzen.
Während Keen sich mit seinem Appell an die Wahrung von Eigentumsrechten in der digitalen Welt der Gegenwart eher lächerlich macht, kommt auch der hartgesottenste Downloader an einer Frage ins Grübeln: Wer kreiert zukünftig die originären Inhalte, wenn niemand mehr bereit ist, für Kultur und Kunst zu zahlen? Die Apologeten des Internet 2.0 vertreten den Standpunkt, dass der geistige Input einer nach Milliarden zählenden Schar von Beiträgern einen frei verfügbaren Pool unendlichen Wissens und unglaublich schöpferischer Kunst generieren wird. Keen kontert nüchtern mit einer elementaren Tatsache: |“Talent war schon immer eine begrenzte Ressource, und heute ist es die Nadel im digitalen Heuhaufen. Begabte, gut ausgebildete Menschen wird man nicht im Schlafanzug am Computer finden, wie sie geistlose Blog-Beiträge oder anonyme Filmrezensionen schreiben. Zur Talentförderung sind Arbeit, Geld und Erfahrung nötig.“| (S. 39) Das ist eine heutzutage offenbar unangenehme Wahrheit, die indes Wahrheit bleibt.
Der Aufstieg der Dummbärte und ihre wahlweise parasitäre Aneignung der Leistungen talentierter Mitmenschen bzw. die Ignorierung derselben, wenn diese einem bereits vorgefassten und erschütternd engem Weltbild nicht entsprechen, geht einher mit dem Abbau bewährter Informationsstrukturen. Die klassische Zeitung verliert immer mehr Leser: Wieso für die tägliche oder wöchentliche, von einem geschulten Team fachkundiger Journalisten und Redakteure betreute Ausgabe zahlen, wenn man sich kostenfrei per Internet ‚informieren‘ kann? Wie gut sich hinter professionell gestalteten Layouts Unwissen, Werbung oder politische Manipulation verbergen können, deckt Keen anhand zahlreicher Beispiele auf.
_Schöne, neue, abgründige Welt_
Zu den Gewinnern der Internet-2.0-Ära gehören erwartungsgemäß primär jene, die sich niemals naiv und früh genug der Möglichkeiten der neuen Technik bewusst waren und diese planvoll zu ihrem Nutzen einsetzen oder missbrauchen. Die Zeche zahlen die weniger Dreisten oder Klugen. „Moralische Verwirrung“ überschreibt Keen ein Kapitel, dass sich mit moderner Online-Spiel- oder Sex-Sucht beschäftigt und weiter beschreibt, wie sich von den Bedürfnissen ihres Alltags überforderte oder gelangweilte Menschen in der Traumwelt der „Second Lives“ verlieren.
Eher kurz, aber nichtsdestotrotz deutlich geht Keen auf das Thema Datenschutz ein. Am Beispiel der nichtsahnend genutzten Suchmaschinen weist er nach, wie deren Betreiber nicht nur unkontrolliert Userdaten sammeln, die sie nichts angehen, sondern diese der Werbung zur Verfügung stellen und – der Gipfel der Dreistigkeit – den zusammengerafften Datenbestand nicht nur ungeschützt lassen, sondern ihn nicht selten selbst preisgeben. Die intimsten Geheimnisse des sich anonym wähnenden Internet-Users können mit fatalen Folgen plötzlich öffentlich und dankbare Identitätsdiebe aktiv werden.
In einem abschließenden Kapitel versucht sich Keen an Lösungen für die zuvor aufgeworfenen Probleme. Für ihn läuft es auf die Bewahrung akademischer bzw. intellektueller Eliten hinaus, die nicht umsonst als solche gelten: Sie verfügen über das ‚echte‘ Wissen und benötigen in erster Linie fachkundige Mediatoren, die es dem interessierten Laien zur Verfügung stellen. Damit erteilt Keen den selbst ernannten Fachleuten der „Wikipedia“-Kategorie eine eindeutige Absage, was man ihm objektiv unterschreiben kann: Auf dieser Erde werden unterdrückte oder bisher unentdeckte Superhirne nur im Ausnahmefall durch das Internet 2.0 offenbar!
_Noch ist die Menschheit nicht verloren!_
Nachdem er auf über 200 Seiten ein Szenario des geistigen und moralischen Untergangs zelebriert hat, wird Keen im letzten Teil seines Buches versöhnlich. Am Beispiel der Wahl des US-Präsidenten von 2008 meint er zu erkennen, dass die ‚wichtigen‘ Aspekte des Alltags noch nicht in den Sog des zweiten Internets geraten sind. Obwohl der Wahlkampf durchaus von nutzergenerierten Dümmlich- und Hinterhältigkeiten begleitet wurde, hat sich nach Ansicht von Keen die klassische Demokratie durchgesetzt: Die Präsidentschaft wurde nicht durch das Internet entschieden – eine Furcht, die (nicht nur) Keen durchaus gehegt hatte.
Dieser Nachklapp passt nicht zum Tenor des bisher Gesagten & Beklagten. Es relativiert Keens Äußerungen, die nachträglich überspitzt klingen. Dies sind sie zweifellos, weil sich ihr Verfasser Gehör verschaffen möchte. Das ist ihm gelungen, und seine Polemik ist ein nützliches Instrument, weil in der Regel die Fakten auf Keens Seite sind.
Darüber vergisst der Leser jedoch leicht, dass auch Keen nur eine Stimme in dem Chor ist, der sich über die Vor- und Nachteile des Internets auslässt. Keen muss sich selbst der Kritik stellen, die er zumindest einem entsprechend vorgebildeten Publikum ausdrücklich zugesteht. Bei näherer Betrachtung finden sich dann schnell Positionen, die sich objektiv nicht halten lassen, weil sie übertrieben oder aus dem Zusammenhang gerissen oder – dies vor allem – subjektiv allein auf Keens Mist gewachsen sind.
Aus Saulus wurde wie schon erwähnt Paulus. Dabei ist das Pendel verständlicherweise ein gutes Stück zu weit auf die negativkritische Seite ausgeschlagen. Mehrfach entlarvt sich Keen als Vertreter allzu trivialer ‚Tatsachen‘. Im Rahmen seiner sonst ausgefeilten Ausführungen fallen Banalitäten wie diese unangenehm auf: „13-jährige sollten Fußball spielen oder Fahrrad fahren und nicht im abgeschlossenen Schlafzimmer Hardcore-Pornografie anschauen.“ (S. 173) Das sind exakte jene Verallgemeinerungen, die Keen so gern den „Affen“-Usern nachweist.
„Die Stunde der Stümper“ ist deshalb keine ‚Bibel‘ für den Internet-Skeptiker. Als solche werden sie nur jene betrachten, die bereits vor der Lektüre ‚wussten‘, dass das Internet ‚böse‘ ist. Solche Zeitgenossen sind indes ebenso kontraproduktiv wie die allzu kritiklosen Jünger der digitalen Wunderwelten. Keen besitzt eine Stimme, die sich Gehör verschaffen konnte. Ob oder besser: wie weit ihr zu trauen ist, bleibt den Lesern überlassen. Sie haben Fakten erfahren und vor allem Denkanstöße erhalten. Das ist es, was Keen ursprünglich wollte, bevor er in seinem (Über-)Eifer selbst zu predigen begann. Von dieser Welt muss jeder Mensch sich weiterhin selbst sein Bild machen. Worin man Keen zustimmen muss, ist die Forderung, die Quellen, aus denen man dabei schöpft, sehr sorgfältig und heute sorgfältiger denn je auf ihre Genießbarkeit zu überprüfen. Dabei ist „Die Stunde der Stümper“ auf jeden Fall hilfreich.
_Impressum_
Originaltitel: The Cult of the Amateur: How Today’s Internet Is Killing Our Culture (New York : Doubleday 2007)
Übersetzung: Helmut Dierlamm
Deutsche Erstausgabe (geb.): September 2008 (Carl Hanser Verlag)
247 Seiten
EUR 19,95
ISBN-13: 978-3-446-41566-9
http://www.hanser.de
Harry Carmichael – Geflohen aus Dartmoor

Harry Carmichael – Geflohen aus Dartmoor weiterlesen
Cortez, Donn – Closer
_Das geschieht:_
Vor drei Jahren hat ein Serienkiller die gesamte Familie des Kunstmalers Jack Salter auf grausamste Weise ausgelöscht. Der ist daraufhin zum unerbittlichen Rächer mutiert. Er sucht den Unhold, doch in dem Wissen, dass noch viele andere Mörder ihr Unwesen treiben, hat Jack seinen Rachefeldzug auf alle in den USA und Kanada aktiven Psychopathen ausgeweitet. Er jagt sie systematisch, lockt sie in die Falle und sperrt sie in seinen privaten Folterkeller. Dort müssen sie ihm ihre Untaten gestehen. Mit der Leiche des schließlich getöteten Mörders werden die dabei entstehenden Tonaufnahmen der Polizei zugespielt.
Die Medien, die Gesetzeshüter und die Angehörigen der Mordopfer haben Jack längst ins Herz geschlossen, da er die Monster auslöscht, die man auf legale Weise oft kaum dingfest machen kann. Mann nennt ihn den „Closer“, denn Jack sorgt dafür, dass die Akten der Mörder geschlossen werden können.
Jack ‚arbeitet‘ auch deshalb so effektiv, weil er sich auf die Unterstützung der Prostituierten Nikki verlassen kann, der er einst das Leben rettete. Gemeinsam haben sie bereits diverse Serienkiller gestellt und ausgeschaltet. Jetzt steht Jack vor seiner größten Herausforderung: Er konnte die geheime „Jagdrevier“-Website infiltrieren, die Webmaster „Dschinn-X“ als Netzwerk für Serienmörder eingerichtet hat. Hier können sie als „Rudel“ miteinander kommunizieren, mit ihren Gräueltaten prahlen und ‚Jagdtipps‘ austauschen.
Wenn Jack die Nicknames der Teilnehmer entschlüsselt, kann er auf einen Schlag ein halbes Dutzend äußerst erfolgreicher Killer eliminieren. Darunter ist auch der „Patron“, in dem Jack den Mörder seiner Familie erkennt. Er gibt sich als „Dschinn-X“ aus und versucht seine Gegner zu täuschen und auszuspionieren. Doch die sind misstrauisch und sehr gewieft, wenn es um ihre Sicherheit geht. Nikki macht sich zudem Gedanken über Jacks psychische Verfassung. Die grausamen Folterverhöre haben ihre Spuren hinterlassen. Ist Jack noch der objektive Rächer, oder hat er das Lager gewechselt und ist selbst zum Lustmörder geworden …?
_Wenn schon, denn schon …_
Verkaufsbewährte Namen und grell angepriesene Unbekannte dominieren den deutschen Krimi-Buchmarkt. Gemeinsamer Nenner ist viel zu oft die mittelmäßige Qualität dieser Elaborate. Man muss wirklich entschlossen sein und über die Fähigkeit verfügen, Enttäuschungen gleich im Salventakt an der Leserseele abprallen zu lassen, will man in diesem Einheitsbrei nicht nur rühren, sondern etwas wirklich Lohnendes gleich Lesenswertes finden.
Wobei „lesenswert“ ja nicht unbedingt „neu“ oder gar „originell“ bedeuten muss. Beide Attribute kann Donn Cortez für „Closer“ sicher nicht beanspruchen. Das lässt sich aber selten so gut verschmerzen wie in diesem Fall. „Closer“ ist Handwerk pur und fern jeder klassischen Qualität, wie das diejenigen, die zwischen ‚Schund‘ und ‚Literatur‘ zu differenzieren pflegen, nur zu gern und angewidert bestätigen werden. Aber „Closer“ macht Spaß. Selten liest man einen Thriller, der nicht nur als Pageturner konzipiert wurde, sondern diesen Anspruch auch erfüllen kann. Dabei hat Donn Cortez im Grunde nur zwei bewährte Regeln beherzigt: Beherrsche deinen Job – das Schreiben – und gib dort Gas, wo die Wankelmütigen zaudern.
Der Vigilant mit seinem Drang zur Selbstjustiz gehört nicht nur in den USA zum festen Inventar der Unterhaltungsmedien. Zu verlockend ist der Gedanke, auf dem Weg zum ‚gerechten‘ Urteil eine Abkürzung zu nehmen, das scheinbar notorisch liberale und auch den überführten Übeltäter schützende Gesetz zu umgehen und die Strafe als Rache zu zelebrieren: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Selten wird dieses Prinzip so kompromisslos durchgespielt wie in „Closer“. Cortez arbeitet wie der Regisseur eines Horror-B-Movies mit intensiven Splatter-Einlagen. Zwar schwelgt er nicht in Blut & Gedärmen, doch er beschränkt sich nicht auf Andeutungen: Wenn Jack und das „Rudel“ foltern, dann erfahren wir, was sie ihren Opfern antun.
_Unter Blut und Schweiß kaum auseinanderzuhalten_
Das geschieht nicht (nur) als Service für die Fans des aktuell beliebten Folter-Pornos à la „Saw“ oder „Hostel“. Tatsächlich beschreibt Cortez ’nur‘ den entsetzlichen „Bind-Torture-Kill“-Alltag realer Serienkiller und lässt diese zusätzlich darüber reflektieren. Wenn die plakativen Sitzungen ausführlicher Foltersitzungen auszuufern drohen, ersetzt Cortez sie lieber durch fiktive ‚Essays‘, in denen „Dschinn-X“, „Gourmet“, „Patron“ oder „Road-Rage“ über ihren ‚Job‘ philosophieren. Das Entsetzen speist sich aus dem sachlichen Tonfall, in dem sie über schauerlichste Gräuel diskutieren.
Auf einer zweiten Handlungsebene ist „Closer“ die mindestens ebenso dramatische Höllenfahrt eines Mannes, der dem folgenschweren Irrtum unterliegt, er könne seinen inneren Frieden wiederfinden, indem er die Welt von ihren Dämonen befreit. „Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.“ Dieser berühmte, fast schon zur Plattitüde verkommene Aphorismus Friedrich Nietzsches (Nr. 146; „Jenseits von Gut und Böse“, 1886) trifft den Nagel auf den Kopf. Jack hat die Grenze womöglich überschritten. Diese Frage stellt sich stellvertretend für den Leser Nikki, die nicht nur Jacks Partnerin bei der ‚Jagd‘ ist, sondern auch die Stimme der Vernunft verkörpert, für die Jack taub geworden ist. Wenn er foltert, dann wendet er die Methoden seiner Gegner an. Dabei bedient er sich der gleichen ‚Argumente‘ wie seine Gefangenen, wenn diese ihre Taten rechtfertigen. Kein Wunder, dass Nikki Schwierigkeiten hat, zwischen dem gleichermaßen mit Blut bespritzten Täter und seinem Opfer zu unterscheiden, wenn sie in Jacks Folterkeller schaut.
Die Ambivalenz des Mannes Jack, der im Grunde als Sympathiefigur dargestellt ist, wird von Cortez vorbildlich in den Dienst seiner Geschichte gestellt. Die Sprache ist nüchtern, kein Zeigefinger wird erhoben, keine Kompromisse werden gemacht; es wird erklärt, aber nicht gewertet. Eine literarische Verfremdung der grausigen Fakten findet nicht statt. Dem Leser wird kein Hintertürchen gelassen.
Prompt und vom Verfasser natürlich methodisch geweckt, stellt sich Unbehagen ein. Man wird zum Voyeur gemacht und muss Stellung beziehen: Ist es nicht ‚richtig‘, dass eingefleischte Psychopathen, die dem Gesetz und seinen Hütern viel zu oft durch die Finger schlüpfen, schlicht ausgerottet werden? Cortez verdeutlicht den Preis der Selbstjustiz, und das macht er besser als jeder predigende Gutmensch.
_Mit dem Bleifuß auf dem Spannungspedal_
Im Vordergrund steht für Cortez die Geschichte. Die ist beispielhaft geplottet, weil stringent, rasant und dabei doch voller Überraschungen. Wenn Jack sich gleich mit mehreren Serienkillern anlegt, hat er, den Cortez erfolgreich als extrem organisierten und deshalb so erfolgreichen „Closer“ dargestellt hat, sich eindeutig übernommen. Das Schiefgehen eines ausgeklügelten Racheplans ist Klischee, aber so geschickt, wie hier variiert, beschert er einem Roman zuverlässig zusätzliche Spannungsschübe. Cortez wird im Finale möglicherweise zu theatralisch mit „Patrons“ Rechtfertigung seiner Schandtaten als Katalysator einer monströsen und buchstäblichen „art pour l’art“; hier orientiert sich Cortez unnötig am genialischen Metzel-Vorbild Hannibal Lecter.
Die Idee einer Website für Serienkiller ist so ‚logisch‘, dass sich tatsächlich die Frage stellt, wieso oder ob es so etwas nicht schon gibt. Schon erwähnt wurde, dass Cortez auch hier die ‚richtigen‘, d. h. erschreckenden Worte findet, wenn er seine Psychopathen chatten, über das Für und Wider verschiedener Mordmethoden beraten oder über frustrierende ‚Betriebsunfälle‘ klagen lässt. Dieser Wahnsinn hat Methode. Das lässt ihn sehr real wirken.
„Closer“ ist trotz der Geschwindigkeit, mit der die Ereignisse ablaufen, durchaus keine Hetzjagd von Mord zu Mord. Es gibt Ruhephasen, die vor allem der Erläuterung und Informationsvermittlung dienen. Sie sind sorgfältig in den Erzählfluss eingebettet. Nicht selten sprengen sie dessen Chronologie. Nicht einmal die Einleitung bleibt ohne Zeitsprünge. Was dort geschieht, wer Jack und Nikki sind und wer wen jagt, bleibt zunächst unklar. Nicht nur unsere beiden Hauptfiguren, sondern auch ihre Gegner lernen wir erst ‚bei der Arbeit‘ kennen.
Im letzten Drittel rückt Jacks Erkenntnisprozess in den Vordergrund. Er stellt sich endlich der Frage, ob „Closer“ womöglich der Spitzname eines weiteren Serienkillers geworden ist. Die Antwort fällt erneut anders aus als erwartet. Im Anschluss demonstriert Cortez, wie man den Leser mit einer ganzen Kette infam eingefädelter Schlusstwists von einer Verwirrung in die nächste stürzt: Die wahre Identität des „Patrons“ wird erfolgreich so spät wie möglich gelüftet.
Diese Tour-de-Force leitet gleichzeitig ein Happy End ein, das man nur tragisch, aber nochmals konsequent nennen kann. Es komplettiert einen Thriller, dessen Ökonomie vorbildlich ist. 400 Seiten benötigt Cortez für seine Geschichte. Sie werden mit einer Geschwindigkeit umgeblättert, die sogar den erfahrenen Leser überraschen dürfte …
_Autor_
Donn Cortez ist das Pseudonym des kanadisches Schriftstellers Don H. DeBrandt, der unter seinem Geburtsnamen Science-Fiction und Horror schreibt. „The Quicksilver Screen“, sein Romandebüt von 1992, wurde vom renommierten SF-Magazin |Locus| als Geheimtipp gehandelt. DeBrandt schrieb außerdem für |Marvel Comics|, wo er an Reihen wie „Spiderman 2099“ und „2099 Unlimited“ mitarbeitete.
Seit 2006 verfasst DeBrandt, der im kanadischen Vancouver lebt und arbeitet, Romane zur TV-Serie „CSI: Miami“. Über seine Werke informieren die Websites:
http://www.donncortez.com
http://www.sfwa.org/members/DeBrandt
_Impressum_
Originaltitel: The Closer (New York : Pocket Star Books, a division of Simon & Schuster 2004)
Übersetzung: Friedrich Pflüger
Deutsche Erstausgabe: September 2008 (Knaur Taschenbuch Verlag/TB Nr. 63703)
399 Seiten
EUR 8,95
ISBN-13: 978-3-426-63703-6
http://www.knaur.de
Als Hörbuch: Oktober 2008 (Argon Verlag)
Sprecher: Martin Kessler
5 CDs in Brillantbox (339 min)
EUR 19,95
ISBN-13: 978-3-86610-548-5
http://www.argon-verlag.de
_Mehr von Donn Cortez auf |Buchwurm.info|:_
[„CSI Miami: Der Preis der Freiheit“ 5017
[„CSI Miami: Tödliche Brandung“ 5122
John Dickson Carr – Der vergoldete Uhrzeiger
Im Londoner Kaufhaus Gamridge stiehlt eine Ladendiebin eine kostbare Uhr. Vom Hausdetektiv erwischt, schlitzt sie diesem den Bauch auf und entkommt: ein bizarrer Mordfall so recht nach dem Herzen von Gideon Fell ist, der als Amateur-Ermittler so berühmt ist wie als Wissenschaftler.
Besagte Uhr wurde von Johannus Carver hergestellt, einem Meister seines Fachs, der zurückgezogen in einem großen Haus lebt. Dorthin begibt sich Fell, der den Uhrmacher und seine seltsame ‚Familie‘ gern persönlich kennenlernen möchte. Der Besuch erfolgt unter dramatischen Umständen: Gerade fanden die Bewohner einen Unbekannten tot in einem der Zimmer; der Mann ist offenbar ein Einbrecher. In seinem Nacken steckt der Minutenzeiger einer gewaltigen Turmuhr. John Dickson Carr – Der vergoldete Uhrzeiger weiterlesen
Ridley Pearson – Der blinde Tod
In Sun Valley, US-Staat Idaho, verbringt Generalstaatsanwältin Elizabeth Shalor gern ihre raren Urlaubstage. Das ist bemerkenswert, denn vor acht Jahren versuchte sie genau hier ein mit ihrer Arbeit unzufriedener Staatsbürger umzubringen. Damals entkam Shalor nur, weil der junge Deputy Walter Fleming rechtzeitig auf der Bildfläche erschien und den Strolch ausschaltete.
Seither ist Fleming Shalors Freund, ein Status, der neuerdings mit Privilegien aber auch Pflichten verbunden ist: Elizabeth Shalor gedenkt sich für das US-Präsidentenamt zu bewerben. In Sun Valley möchte sie vorab ausspannen sowie auf einer Tagung ihre Kandidatur bekanntzugeben. Walter Fleming, seit seiner Heldentat Sheriff von Sun Valley, ist für ihre Sicherheit verantwortlich. Das FBI ist wenig erfreut darüber, denn Shalor ist aufgrund ihrer politischen Ziele außerordentlich exponiert. Mit Anschlägen ist zu rechnen. Gern würde das FBI sie isolieren, doch Shalor sperrt sich. Sie vertraut ihrem Lebensretter Fleming.
Lindqvist, John Ajvide – So ruhet in Frieden
_Das geschieht:_
An einem heißen Augusttag legt sich ein mysteriöses elektrisches Feld über die schwedische Hauptstadt Stockholm. Es reizt die Menschen bis zum Wahnsinn, bevor es sich plötzlich auflöst. Die Erleichterung währt nur kurz, denn in der folgenden Nacht erwachen in den Sektionsräumen der Krankenhäuser die Leichen. Sie brechen aus und versuchen ’nach Hause‘ zurückzukehren, was ihnen oft gelingt. Die Wiedersehensfreude der Hinterbliebenen hält sich in Grenzen, denn die ‚Rückkehrer‘ zeigen sämtliche Schäden, die der Tod dem menschlichen Körper zufügt. Außerdem reagieren sie nicht, werden sie angesprochen; das Gehirn ist offenbar geschädigt. Immerhin sind die Zombies harmlos, d. h. weder aggressiv noch hungrig auf Menschenfleisch. Das zu wissen ist wichtig, denn kurz darauf graben sich die ersten Leichen aus ihren Friedhofsgräbern.
Dem Entsetzen folgt wilder Aktionismus. Die „Wiederlebenden“, wie man sie bald politisch korrekt nennt, werden mit Hilfe des Militärs gesammelt und in einer aufgelassenen Wohnsiedlung konzentriert, wo man sie besser untersuchen kann. Das gruselige Phänomen beschränkt sich glücklicherweise auf diejenigen Menschen, die vor höchstens acht Wochen gestorben sind. So sind es letztlich ’nur‘ 2000 Zombies, die leicht unter Kontrolle zu halten sind.
Doch wer sind „Wiederlebenden“? Sind es noch Menschen? Kann man sie ‚heilen‘? Haben sie Bürgerrechte? Die psychischen Folgen sind verheerend, denn wer zunächst um verstorbene Angehörige trauerte, wird nunmehr womöglich mit ihren schrecklichen Zerrbildern konfrontiert. Die Politik reagiert nervös, die Kirchen mauern, die Medien laufen Amok. Der Tod muss neu definiert werden. Die daraus resultierenden Konsequenzen drohen die Gesellschaft zu spalten. Fast geraten die Zombies selbst darüber in Vergessenheit, bis sie sich nachdrücklich in Erinnerung bringen, denn sie haben durchaus ihre eigene Sicht der Dinge …
_Was wäre, wenn sie wiederkehren?_
Die Zombies kommen! Dieses Mal bleiben sie eher friedlich und jagen die Lebenden nicht hungrig durch die Straßen. Das macht es möglich, einige Dinge zu überdenken, die über die Frage nach dem schnellstmöglichen Ausschalten der lästigen Schreckgestalten hinausgehen.
Siehe da, es entsteht eine völlig neue Art der Spannung. Die Toten sind wieder da. Sie bleiben passiv und überlassen den Lebenden die Entscheidung, was mit ihnen zu geschehen hat. Das ist perfide, denn hier gilt es, Grundsätzlichkeiten des Lebens völlig neu zu beurteilen. Tod bedeutete bisher tot. Wer sich nach ein, zwei Tagen nicht mehr rührt und atmet, kann und muss unter die Erde, wird von Angehörigen und Freunden betrauert und schließlich mehr oder weniger vergessen. So läuft es seit jeher, und es funktioniert.
Selbstverständlich taucht in diesem Prozess häufig das Verlangen nach der Wiederkehr des oder der Verstorbenen auf – ein verständlicher Wunsch, der zuverlässig nicht in Erfüllung ging. John Ajvide Lindqvist schaltet dieses Hindernis nun aus. Er ist nicht der erste Schriftsteller, der dies tut und über die Konsequenzen nachdenkt. William Wymark Jacobs (1863-1943) griff bereits 1902 das Thema in einer der berühmtesten Gruselgeschichten überhaupt („The Monkey’s Paw“, 1902; dt. „Die Affenpfote“) auf. Bereits er kam zu dem Schluss, dass eine solche Wiedervereinigung die Lebenden überfordern würde.
Was damit gemeint ist, deutete Jacobs noch vornehm an. Lindqvist hält sich im 21. Jahrhundert in keiner Weise zurück und beschreibt ausführlich und drastisch, wie sich der Körper nach dem Tod aufzulösen beginnt. Er lässt 2000 verwesende, von Krankheiten zerfressene, durch Unfälle zerstörte Leichname durch Stockholm torkeln. Will und kann man sie wirklich wieder in die Gemeinschaft aufnehmen?
_Was machen wir mit ihnen?_
„So ruhet in Frieden“ lautet zwar sinnig aber wie üblich falsch der deutsche Titel dieses Romans. Das Original macht deutlicher, worum es wirklich geht: „Vom Umgang mit den Untoten“, könnte man ihn übersetzen. Wichtig ist dabei, dass die Romerosche Ur-Katastrophe ausbleibt. Es sind nicht die Toten einer ganzen Welt, die sich erheben, sondern gerade 2000 Leichen, denen weiterhin mehr als sechs Milliarden Menschen gegenüberstehen. Was das bedeutet, fasst eine von Lindqvists Figuren mit diesen Worten zusammen: |“Nichts deutete darauf hin, dass die Welt in dieser Nacht aus den Fugen geraten war.“| (S. 155)
Das Konfliktpotenzial entsteht unter den Lebenden. Sie müssen entscheiden, wie sie mit den Wiederkehrern umgehen. Das können und das wollen sie nicht. Die Folgen bilden die eigentliche Handlung dieses Buches. In diesem Punkt stimmt Lindqvist mit George A. Romero überein: Die Uneinigkeit der Lebenden ist der Schlüssel zu ihrem Untergang und zum Sieg der „Wiederlebenden“. Nur weil die Zombies dieses Mal in der Minderzahl sind, wird Schweden nicht zum „Land der Toten“.
Lindqvist gibt den unterschiedlichen Reaktionen Gesichter. „So ruhet in Frieden“ ist ein Roman in Episoden. Das Unfassbare wird aus mehreren Perspektiven durch die Augen verschiedener Figuren betrachtet, die einander erst später oder auch gar nicht begegnen: David fürchtet die Rückkehr seiner fremden, schrecklich veränderten Gattin Eva, während der Journalist Mahler seinen „wiederlebenden“ Enkel als Gelegenheit sieht, alte Fehler als Vater und Großvater wettzumachen. Die religiöse Elvy hält den Tag des Jüngsten Gerichts für gekommen. Ihre agnostische Enkelin Flora wartet auf eine positive Veränderung der Welt.
Sie alle müssen lernen, dass sie vor allem ihre eigenen Wünsche und Ängste auf die Rückkehrer projizieren, was fatale Auswirkungen haben wird. Überfordert zeigen sich auch die Ordnungsmächte. Politiker, Militärs, Gelehrte, Kirchenleute – sie versuchen ein nie gekanntes Phänomen mit alten Methoden zu meistern, zu instrumentalisieren oder zu verdrängen.
_Wer sind sie?_
Ob direkt oder indirekt betroffen: Die Menschen reagieren falsch. Der Wirbel um die Zombies ist wesentlich schädlicher als die „Wiederlebenden“ selbst. Wer oder was sie sind, klärt sich deshalb erst, als es beinahe zu spät ist. Dass sie „sind“ und eigene Pläne haben, kündigt der Autor spannenderweise schon früh an.
Lindqvist hat sich wie für seine Vampire in [„So finster die Nacht“ 5218 für seine Zombies eine ‚logische‘ Existenzerklärung einfallen lassen. Sie verharrt wohlweislich in den Grauzonen der modernen Medizin, die den meisten Laien ohnehin wie Voodoo erscheint.
Letztlich schwenkt Lindqvist doch wieder auf die klassische Horrorgeschichte ein, die zur zwar fesselnden, aber fast ‚literarischen‘ Beschäftigung mit der Rolle der lebenden Toten in einer modernen Gesellschaft eine ‚richtige‘ Handlung addiert. Der Tod ist nicht nüchterne Tatsache, sondern eine reale Wesenheit. Ob das nötig oder gar gelungen ist, bleibt eine Streitfrage. Es öffnet dem Verfasser vor allem eine Hintertür zu einem einigermaßen gelungenen Ende seiner Geschichte, auch wenn dieses an Filme wie „Final Destination“ oder „Reeker“ erinnert. Leider kann sich Lindqvist nicht zurückhalten, ein fantastisches, aber wohl doch im Gefüge der Naturgesetze verankertes Geschehen mit (christlich) religiösen Heilsmetaphern zu verquicken – ein unnötiger und sentimentaler Ausklang, mit dem sich der Autor vor weiteren Fragen drückt: Die Toten sind wieder fort, doch das Wissen um ihre Wiederkehr ist ein Vermächtnis, dessen Aufarbeitung gerade dort beginnt, wo dieser Roman endet.
_Der Autor_
John Ajvide Lindqvist wurde 1968 in Blackeberg, einem Vorort der schwedischen Hauptstadt Stockholm, geboren. Nachdem er schon in jungen Jahren als Straßenmagier für Touristen auftrat, arbeitete er zwölf Jahre als professioneller Zauberer und Comedian.
Sein Debütroman „Låt den rätte komma“ (dt. [„So finster die Nacht“), 5218 eine moderne Vampirgeschichte, erschien 2004. Bereits 2005 folgte „Hanteringen av odöda“ (dt. „So ruhet in Frieden“), ein Roman um Zombies, die in Stockholm für Schrecken sorgen. „Pappersväggar“ ist eine Sammlung einschlägiger Gruselgeschichten. Lindqvist schreibt auch Drehbücher für das schwedische Fernsehen. Das prädestinierte ihn, das Script für die Verfilmung seines Romanerstlings zu verfassen, die 2008 unter der Regie von Tomas Alfredson entstand.
Als Buchautor ist Lindqvist in kurzer Zeit über die Grenzen Schwedens hinaus bekannt geworden. Übersetzungen seiner Werke erscheinen in England, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen und Russland.
_Impressum_
Originaltitel: Hanteringen av odöda (Stockholm : Ordfront Förlag 2005)
Übersetzung: Paul Berf
Deutsche Erstausgabe: September 2008 (Bastei-Lübbe-Verlag/TB Nr. 15913)
446 Seiten
EUR 8,95
ISBN-13: 978-3-404-15913-0
http://www.bastei-luebbe.de
Als Hörbuch: September 2008 (Lübbe Audio)
6 CDs, gelesen von Sascha Rotermund
445 min (bearbeitete Fassung)
EUR 19,95
ISBN 978-3-7857-3679-1
http://www.luebbe-audio.de
James White – Das Raumschiff der Rätsel

James White – Das Raumschiff der Rätsel weiterlesen
George Pelecanos – Der Totengarten
In Washington, der Hauptstadt der USA, trieb er 1985 sein Unwesen: der „Palindrom“-Mörder, der drei schwarze Teenager, deren Vornamen sich von vorn wie von hinten lesen ließen, vergewaltigte und ihnen in die Köpfe schoss. Gefasst werden konnte er nie, denn er tauchte spurlos unter; ein Fall, der Sergeant T. C. Cook, der damals mit den Ermittlungen betraut war, sehr nahe ging.
Mehr als zwei Jahrzehnte später liegt Asa Johnson mit einer Kugel im Schädel in einem Park in Washington. Ex-Cop Dan Holiday glaubt die Handschrift zu erkennen. Er tut sich mit dem längst pensionierten Cook zusammen, der dem „Palindrom“-Killer immer noch nachjagt. Dritter im Bund wird Gus Ramone, Holidays ehemaliger Partner, der im Polizeidienst geblieben und an den Ermittlungen im Mordfall Johnson beteiligt ist. Mit frischem Eifer und den Methoden des 21. Jahrhunderts beginnt das Trio aufs Neue mit der Fahndung.
Spillane, Mickey / Collins, Max Allan – Ende der Straße, Das
_Das geschieht:_
Nach dreißig Jahren hat Captain Jack Stang genug vom Polizeidienst. Die Zeiten haben sich geändert und ihn, der sich einen Namen als rabiater „Shooter“ machte und nie daran glauben mochte, dass Gangster auch Menschen sind, definitiv zurückgelassen. Sein altes Revier wird abgerissen, Stang fühlt sich entwurzelt, als Tierarzt Dr. Thomas Price ihn aufsucht und mit einer seltsamen Geschichte zwei Jahrzehnte in die Vergangenheit zurückwirft.
Einst war Jack Stang unsterblich verliebt in die junge EDV-Spezialistin Bettie Brice. In ihrem Job musste sie eines Tages zufällig auf etwas gestoßen sein, das sie definitiv nicht sehen sollte, denn die Mafia entführte sie. Die Befreiung scheiterte, Bettie schien in dem Fluss ertrunken zu sein, in den der Wagen der Kidnapper während der Verfolgungsjagd stürzte. Doch Prices Vater zog sie flussabwärts aus dem Wasser – ohne Gedächtnis und blind. Aus der Presse erfuhr er von Betties Status als Zielobjekt der Mafia. Er adoptierte die junge Frau, stattete sie mit einem reichen Erbe aus und siedelte sie in Florida und damit weit vom Schuss an. In der Seniorenwohnanlage Sunset Lodge, in der hauptsächlich pensionierte Polizeibeamte leben, führt sie seither ein behütetes Leben.
Nun ist Price senior gestorben. In seinem Testament hat er verfügt, dass Stang an seine Stelle treten und auf Bettie aufpassen soll. Die alte Liebe flackert wieder auf, obwohl Bettie sich an ihren Jack nicht erinnert. Doch auch die Mafia ist immer noch auf der Hut, Betties Todesurteil weiterhin gültig. Stang muss noch einmal aktiv werden, um einem unglaublichen Komplott auf die Schliche zu kommen, das ein ihm wohlbekannter Schurke eingefädelt hat. Der Gegner schläft nicht, aber Jack Stang ist entschlossen, sich sein spätes Glück mit Bettie zu bewahren – um jeden Preis …
_Der Tod ist keineswegs das Ende_
Wenn alte und womöglich erfolgreiche Schriftsteller das Zeitliche segnen, wird der Nachlass intensiv gesiebt. Es geht nicht um versteckte Goldmünzen, sondern um wesentlich Lukrativeres: Wohl jeder Autor hat mindestens eine Schublade, in der er Texte hortet, die er nie fertigstellte oder mit denen er so unzufrieden war, dass sie unveröffentlicht blieben. Hat er sich nicht früh genug von diesen Manuskripten trennen können, muss er sich auf Wolke Sieben tüchtig ärgern, denn solches Material kommt unweigerlich zur Veröffentlichung.
Mickey Spillane starb als sehr alter und vermögender Mann. Allerdings blieb er weder körperlich noch geistig von den Malaisen des Alters verschont. Seine Arbeitsweise hatte sich schon früher gravierend geändert; was er einst nach eigener Auskunft in wenigen Tagen geschrieben bzw. in die Maschine gehackt hatte, schritt nun langsam voran, wurde vielfach überarbeitet und blieb oft doch Stückwerk.
Seit mindestens zehn Jahren arbeitete Spillane an „Dead Street“, und die Idee ist sogar noch älter, wie Max Allan Collins in seinem Nachwort berichtet. Als Spillane im Juli 2006 starb, lagen acht von elf Kapiteln und Notizen für den Schluss vor. Der Schriftsteller hatte Collins gebeten fertigzustellen, was er selbst nicht mehr abschließen konnte. Das betraf übrigens nicht nur „Das Ende der Straße“. In den nächsten Jahren wird Spillane deshalb auf dem Buchmarkt mit ‚Neutiteln‘ präsenter denn je sein.
_Ein Cop ist ein Cop ist ein Cop ist ein …_
„Das Ende der Straße“ ist der erste der ‚postumen‘ Spillane-Romane. Erzählt wird eine ebenso simple wie solide Geschichte: Ein alter Cop stößt auf einen offenen Fall und muss noch einmal alle Register seines Könnens ziehen. Das schließt Spillane-typisch kriminalistische Erfahrung und kurzentschlossene Gewalt gleichrangig ein.
Jack Stang (1923-1996) hieß ein Polizist, mit dem Spillane eng befreundet und der in den 1950er Jahren einer Karriere als Schauspieler nicht abgeneigt war. Der Autor sah im Freund die ideale Verkörperung seiner Bestseller-Figur Mike Hammer, doch Stang kam in Hollywood nicht an. Mit „Das Ende der Straße“ setzte ihm Spillane ein kleines Denkmal. ‚Sein‘ Jack Stang ist ein Relikt aus der Vergangenheit – gerade heraus, wenig diplomatisch, der Rächer stets dicht unter der Oberfläche des Gesetzeshüters. Mit Mike Hammer teilt Stang die Liebe zum alten Automatik-Colt des Kalibers 45; keine raffinierte, sondern eine effektive Waffe, deren brutale Wirkung Spillane mit der ihm eigenen Wortgewalt (Achtung: doppeldeutig!) zu schildern weiß.
Dabei ist „Das Ende der Straße“ kein Roman, der in Brutalitäten schwelgt. Über dem Geschehen hängt stattdessen ein Hauch von Abschied und Resignation. Die Zeiten ändern sich, doch das Neue kann erst kommen, wenn das Alte endgültig abgewickelt ist. In der „toten Straße“, die Jack Stang gen Florida verlässt, treiben sich noch einige Gespenster der Vergangenheit herum. Erst wenn er die vertrieben hat, kann Stang mit Bettie ein neues Leben beginnen.
Zu viel Vergangenheit oder zu viel Drama?
Vielleicht hätte Spillane sogar ein wenig heftiger auf die Tube drücken sollen. Seine Geschichte kommt erst richtig in Fahrt, als die Fetzen zu fliegen beginnen. Bis es so weit ist, irritieren den Leser des 21. Jahrhunderts diverse Anachronismen, die „Das Ende der Straße“ als Produkt einer vergangenen Ära outen.
Der Plot ist höchstens unter dem Prädikat „Trash-Crime“ goutierbar. Das von Spillane entworfene Komplott um Mafiosi und Terroristen ist lächerlich; würde das organisierte Verbrechen so wirr und umständlich arbeiten, hätte es sich ohne Einmischung durch die Polizei oder die Bundesbehörden selbst erledigt. In diesem Punkt ist sich Spillane treu geblieben: Realistisch waren seine Krimis nie. Wenigstens die wütenden bzw. unkontrollierten Attacken gegen Kommunisten, Liberale, Feministen und andere Weicheier erspart Spillane dieses Mal sich und seinen Lesern; sie machen Platz für fast altersmilde Klagen über den kriminellen Wahnsinn des globalen Terrors, die womöglich von Collins eingefügt wurden.
Auch Betties Schicksal ist reiner Pulp, den der Leser nur unter Ausschaltung des Logiksektors verkraftet. Alte Liebe mag nicht rosten, doch sie kommt besser nicht so theatralisch oder sentimental daher wie in diesem Fall. Kein Auftritt vergeht ohne schmalzige Oden an Betties unverwelkte Schönheit, obwohl der Leser definitiv begriffen hat, dass Captain Stang unsterblich verliebt ist.
_Profi am Werk_
Zu den abstrusen gesellen sich erfreulicherweise gelungene Einfälle. Bizarr aber unterhaltsam ist Spillanes Schöpfung einer Rentnerstadt, die hauptsächlich von Ex-Polizisten bevölkert wird. Sie setzen ihren Dienst wie gewohnt fort und sind dabei besser bewaffnet als manche militärische Kampfeinheit. Sunset Lodge wirkt wie eine Karikatur, doch Spillane gestaltete die Siedlung nach einem realen Vorbild, das ihn sehr faszinierte. Fast direkt gegenüber platziert er eine entsprechende Siedlung, die von ‚pensionierten‘ Mafiosi bevölkert ist. Diese Konstruktion stellt man sich in der Realität lieber nicht vor, obwohl es auch dafür Vorbilder gibt.
Wie hätte Spillane das Finale gestaltet? Collins inszeniert es als Verbeugung vor dem Altmeister der offenen Gewalt, der für seine freiherzigen Schilderungen unverhohlener Selbstjustiz garstig kritisiert wurde. Captain Stang lässt die 45er sprechen und schafft das Böse zumindest aus seiner Welt. Ein wenig ungelenk muss Collins den absurden Plot um geraubtes Uran noch einmal aufgreifen; er bleibt klugerweise vage, denn dieser Anachronismus lässt sich nicht damit aus der Welt schaffen, indem der Verfasser Stang eifrig sein Handy benutzen und nach verschollenen Disketten – es sind tatsächlich noch Floppy-Disks … – fahnden lässt.
Obwohl Collins Mickey Spillane direkt neben Raymond Chandler, Dashiell Hammett und Agatha Christie (!) stellt und viele lobende oder besser ehrfürchtige Worte über den verstorbenen Freund und Lehrmeister verliert, ist „Das Ende der Straße“ kein Abschied auf der Höhe eines literarischen Gipfels. Diesen Roman konnte auch Collins nicht in der Gegenwart erden. Er lässt aber anklingen, was Spillane für das Genre in den 1950er und 60er Jahren bedeutet haben muss, und kündet von einer gewissen schriftstellerischen Weiterentwicklung (die Spillane vermutlich entrüstet abgestritten hätte, weil sie seinem raubauzigen Image widersprach). Außerdem ist er lesbar. Wirklich gut ist er nicht. Seinen eigentlichen Zweck wird er jedoch erfüllen und wie alle Spillane-Werke gutes Geld einbringen.
_Der Autor_
Frank Morrison „Mickey“ Spillane, geboren am 9. März 1918 in Brooklyn, New York: ein Selfmademan nach US-Geschmack, aus kleinen Verhältnissen stammend, in 1001 miesen, unterbezahlten Jobs malochend, doch mit dem amerikanischen Traum im Herzen und nach allen Mühen den gerechten Lohn – Geld, Ruhm, Geld, Anerkennung und Geld – einstreichend.
Vorab stand ein Intermezzo im II. Weltkrieg, in dem Spillane angeblich als Fluglehrer und aktiver Kampfflieger tätig war; die Beweislage ist freilich dünn. Eine Beschäftigung als Comic-Zeichner ist dagegen belegt. 1946 ins Zivilleben zurückgekehrt, machte sich Spillane voller Elan an den Durchbruch. Er berücksichtige alles, was gegen den zeitgenössischen Sittenkodex verstieß, und schrieb in neun Tagen „I The Jury“ (1947, dt. „Ich, der Richter“), das erste Abenteuer des raubeinigen Privatdetektivs Mike Hammer, dessen Name Programm war. Der erhoffte Aufruhr war genauso heftig wie der Verkaufserfolg. Spillane ließ seinem Erstling weitere Hammer-Brachialwerke folgen und wurde ein reicher Mann.
Für einige Jahre hielt er sich schriftstellerisch zurück, fuhr Autorennen, arbeitete als Zirkusartist und gründete eine Filmgesellschaft. Hier gönnte er sich den Spaß, Mike Hammer in dem B-Movie „The Girls Hunters“ (1963, dt. „Der Killer wird gekillt“ / „Die Mädchenjäger“) höchstpersönlich zu mimen. In den 1960er und 70er Jahren wurde Spillane wieder aktiver. Mit dem Geheimdienst-Söldner „Tiger Man“ schuf er sogar einen noch grobschlächtigeren Charakter als Mike Hammer. Aber die Kritik verschweigt gern, dass Spillane auch als Jugendbuch-Autor hervortrat. Für „The Day the Sea Rolled Back“ wurde er 1979 gar mit einem „Junior Literary Guild Award“ ausgezeichnet.
1971 hatte Spillane die Hammer-Serie beendet, sie aber 1989 unter dem erhofften Mediendonner wieder aufleben lassen. Natürlich war Hammers große Zeit längst vorüber; Brutalität und Menschenverachtung gehörten inzwischen zum normalen Unterhaltungsgeschäft. Aber der böse Bube erwies sich als zäh, kehrte 1996 in „Black Alley“ (dt. [„Tod mit Zinsen“) 657 noch einmal zurück und überlebte sogar Spillanes Tod am 17. Juli 2006: In „The Goliath Bone“ räumte er 2008 noch einmal kräftig in der Verbrecherwelt auf.
|Originaltitel: Dead Street
Übersetzung von Lisa Kuppler
222 Seiten, kartoniert
ISBN-13: 978-3-86789-049-6|
http://www.rotbuch.de
Festa, Frank (Hg.) – Necrophobia II: Die graue Madonna
18 klassische und moderne, meist selten und manchmal gar nicht veröffentlichte Kurzgeschichte erfassen das weite Spektrum der Phantastik. Mancher gruselig unterhaltsamer Schatz wird gehoben, oft stößt des Lesers Spaten auch auf taubes Gestein: Die Reise durch die literarische Dunkelheit lohnt dennoch auf jeden Fall!
_Inhalt_
|Graham Masterton: Die graue Madonna| („The Grey Madonna“, 1995), S. 9-27: Im belgischen Brügge verlor Dean auf tragische Art seine Gattin; sie hatte sich Rat suchend an die denkbar falsche Person gewandt, die der untröstliche Ehemann zu seinem Unglück ebenfalls findet …
|Christopher Fowler: Die langweiligste Frau der Welt| („The Most Boring Woman in the World“, 1995), S. 29-41: Eine vernachlässigte und betrogene Hausfrau und Mutter schwelgt in Rachevisionen, deren Umsetzungen näher rücken …
|Stefan Grabinski: Szamotas Geliebte| („Kochanka Szamoty“, 1922), S. 43-60: Endlich erhört sie den vor Liebe Verrückten, doch wen hat er eigentlich woher zu sich gerufen?
|David H. Keller: Da unten ist nichts!| („The Thing in the Cellar“, 1952), S. 61-69: Jedes Kind fürchtet sich vor dem Ding in der Dunkelheit, doch was geschieht, wenn es wirklich existiert …?
|Guy de Maupassant: Die Tote| („La morte“, 1887). S. 71-76: Im Laufe einer denkwürdigen Nacht auf dem Friedhof erfährt der Geliebte, um wen tatsächlich er so untröstlich trauert …
|F. Paul Wilson: Schockwellen| („Aftershock“, 1999), S. 77-127: Im Augenblick des eigenen Todes zeigen sich geliebte Verstorbene: eine Erfahrung, die bizarres Verhalten nach sich zieht …
|Clark Ashton Smith: Necropolis – Das Reich der Toten| („The Empire of the Necromancers“, 1932), S. 129-141: Zwei mächtige, aber moralfreie Zauberer schaffen sich ein Heer aus Zombie-Sklaven, doch sie treiben es schließlich so toll, dass sogar die Toten rebellieren …
|Simon Clark: Die Geschichte des Totengräbers| („The Gravedigger’s Tale“, 1988), S. 143-153: Was der faule Totengräber dieses Mal aus der Erde holte, hätte er besser lagern sollen, denn es erweist sich als nicht richtig tot …
|Margaret Irwin: Das Buch| („The Book“, 1930), S. 155-174: Wer es liest und seinen Anweisungen folgt, wird reich und berühmt – bevor der eigentliche Preis gefordert wird …
|Brian McNaughton: Ringard und Dendra| („Ringard and Dendra“, 1997), S. 175-219: Ein junges Paar sucht Zuflucht bei einem Hexenmeister, was wie erwartet für teuflische Folgen sorgt …
|Karl Hans Strobl: Das Auge| (1926), S. 221-230: Der berühmte Schriftsteller fühlt sich im Wahn beobachtet, und ein kleiner Junge rückt ihm in seiner Neugier ein wenig zu nahe …
|Storm Constantine: So ein nettes Mädchen| („Such a Nice Girl“, 1997), S. 231-257: Wer war Emma wirklich? Die unbedarfte Nachbarin findet es heraus, was ihr mehr Wissen über schwarze Magie beschert, als sie verkraften kann …
|Montague Rhodes James: Pfeife, und ich komme zu dir, mein Freund!| („Oh, Whistle, and I Come to You, My Lad“, 1904), S. 259-284: Als ein neugieriger Urlauber in die am Strand gefundene antike Pfeife bläst, erscheint des Nachts ein unerfreulicher Besucher …
|Cornell Woolrich: Papa Benjamin| („Papa Benjamin“, 1962), S. 285-340: Wer die Voodoo-Götter beleidigt, darf sich über spektakuläre Strafmaßnahmen nicht wundern …
|John Keir Cross: Das Glasauge| („The Glass Eye“, 1946), S. 341-361: Es gibt kein Leid auf dieser Welt, das nicht durch noch größeres Unglück übertroffen werden könnte …
|Algernon Blackwood: Der Schrecken der Zwillinge| („The Terror of the Twins“, 1914), S. 363-372: Der zornige Vater hielt die Geburt seiner Zwillingssöhne schon immer für einen Irrtum der Natur, den er nach seinem Tod zu korrigieren gedenkt …
|Mort Castle: Party-Time| („Party Time“, 1984), S. 373-376: Wenn Söhnchen nur zu bestimmten Anlässen aus dem Keller gelassen wird, so gibt es dafür gute Gründe …
|Graham Masterton: Der Hexenkompass| („Witch-Compass“, 2000), S. 377-412: Er erfüllt dir zuverlässig deine Wünsche, aber du bist womöglich nicht glücklich mit dem Ergebnis, denn du zahlst deinen speziellen Preis dafür …
|Frank Festa: Nachwort|, S. 413-415
_Sie kommen wieder, aber lange hat’s gedauert_
Viel, sehr viel Zeit ist verstrichen, bis diese neue Sammlung alter und aktueller Storys im |Festa|-Verlag erschien. Fast musste man als enthusiastischer Leser des [ersten „Necrophobia“-Bandes 1724 schon bangen, dass diese der phantastischen Kurzgeschichte gewidmete Reihe eingegangen war, bevor sie sich überhaupt zur Reihe entwickeln konnte. So ist es glücklicherweise nicht gekommen, doch die dreijährige Pause verdeutlicht einmal mehr, dass der ‚kurze Horror‘ in Deutschland einen schweren Stand hat.
Dabei nahm Herausgeber Frank Festa deutschsprachige Storys der Gegenwart erst gar nicht in seine Sammlung auf. Er begründet das mit deutlichen Worten: „Nun, ich habe schon öfter erklärt, dass ich lieber die Originale veröffentliche als deren Kopien, und zurzeit sehe ich wirklich keinen eigenständigen, unamerikanisierten Horrorautor im deutschen Sprachraum.“ (S. 414) Die Anhänger der deutschen Phantastik werden dies energisch und empört bestreiten, der Rezensent gibt Festa Recht und setzt noch eins drauf: Deutscher Grusel ist nicht nur Nachahmung, sondern Horror auf Groschenheft-Niveau, der seine Existenz dem Reservat der aktuellen Kleinverlage verdankt, die ihm mit viel Liebe, aber wenig Sinn für Qualität eine unverdiente Scheinblüte bescheren.
_Sie kommen nicht nur in der Nacht_
Das trifft auf die Mehrzahl der in „Necrophobia II“ versammelten Storys glücklicherweise nicht zu. Aus zwölf Jahrzehnten stammen sie und dokumentieren damit die Entwicklung, die das Genre nahm. Eine ‚akademische‘ Präsentation ist dem Herausgeber dabei fern; „Necrophobia II“ gehorcht keiner inhaltlichen und erst recht keiner chronologischen Systematik, Unterhaltung ist Trumpf. Alte und neue Geschichten stehen nebeneinander, thematisch decken sie – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – das breite Spektrum des Genres ab. Monster, Vampire, Phantome, Wahnsinn: Alles ist da, ein lange, gut bestückte Tafel für den gierigen Leser. Welchem Leser welche Story besser gefällt, ist natürlich Ansichtssache. An dieser Stelle können nur einige (subjektive) Hinweise und Hintergrundinformationen folgen.
_Gespenster, Gespenster …_
Die gute, alte Gespenstergeschichte wird in dieser Sammlung gleich mehrfach erzählt. Sie hat sich im Kern nicht geändert: Im Leben blieb der verstorbene Mensch ‚unvollendet‘, sodass er (oder sie) nun als Geist spuken und für Abhilfe sorgen oder sich rächen möchte.
Handwerklich perfekt drechselt Montague Rhodes James [1862-1936] seine Gruselmär vom Tempelritter-Schutzgeist. Sehr typisch für den Verfasser, trifft dessen Zorn einen völlig Unschuldigen: James-Gespenster unterscheiden nicht zwischen Gut und Böse; sie haben es auf alle Lebenden abgesehen. Vermutlich kann nur ein Autor, der rein gar nicht an Gespenster glaubt, sie so perfekt, d. h. spannend, witzig und ohne Beachtung ‚literarischer‘ Qualitäten heraufbeschwören wie James! Weniger elegant und nüchtern im Ton, aber mindestens ebenso konsequent ist David H. Keller [1880-1966], der gar nichts von einem Happy End hält, nur weil sein (niemals auch nur zipfelhaft sichtbar werdender) Keller-Schrecken Kinder als Beute bevorzugt. Wie man diesen Plot als makaberen Scherz zelebriert, zeigt uns Mort Castle [*1946].
Wesentlich ‚psychologischer‘ geht James‘ Zeitgenosse Algernon Blackwood [1869-1951] an das Thema heran. Das Gespenst des Vaters hat ein Motiv für sein Tun, das grausam und grauenvoll ist, was Blackwood einmal mehr ungemein stimmungsvoll darzustellen weiß. Graham Masterton [*1946] stellt unter Beweis, dass das Konzept des Gespenstes auch heute keineswegs unmodern geworden ist. F. Paul Wilson [*1946], mit seinen „Handyman Jack“-Geschichten sonst eher für grobschlächtigen Horror bekannt, erstaunt mit einer ‚aktuellen‘ und doch höchst klassischen Gespensterstory.
_Rückkehr als Leiche_
Noch erschreckender als das Gespenst wirkt die Vorstellung vom oder von der Toten, der oder die in persona aus dem Grab zurückkehrt und nicht nur durch das Erscheinen, sondern auch durch den Anblick (und den Geruch) Entsetzen verbreiten. Sehr drastisch spielt das Simon Clark [*1958] durch, der freilich gleichzeitig belegt, dass Horror und (friedhofserdeschwarzer) Humor erstaunlich gut korrespondieren.
Deutlich allegorischer beschäftigt sich Guy de Maupassant [1850-1893] mit dem Thema Tod. Die Erlebnisse seines Helden mögen sich so ereignet haben oder die Ausgeburt eines kranken Hirnes sein; eine Entscheidung, die dem Leser überlassen bleibt, ohne dass diese an der ‚Moral‘ der Geschichte etwas ändern würde. Ähnlich diffus bleibt Stefan Grabinski [1887-1936], der dem Schrecken indes eine perfide Präsenz verleiht; sein Geist gehört zu den wahrlich seltsamen seiner Art.
Grabinskis Geschichte balanciert auf der Schneide zwischen ‚reinem‘ Spuk und dem Grauen, das derjenige beschwört, der sich mit dem Jenseits einlässt und dabei meist mehr abbeißt, als er oder sie zu schlucken vermag. Margaret Irwin [1889-1969], Cornell Woolrich [1903-1968] und noch einmal Graham Masterton thematisieren das schaurige Angebot, das scheinbar eine ‚Abkürzung‘ zu Reichtum und Macht bietet, bis die Macht im Hintergrund ihren Preis einfordert. (Die Woolrich-Story gehört zu den Ausgrabungen Festas; leider hält sie in der Umsetzung nicht, was der Plot verspricht, und sie transportiert zahlreiche zeitgenössische Rassismen.) Storm Constantine [*1956] überrascht mit einer Nachwuchs-Magierin, die zur Abwechslung einmal erfolgreich bleibt; ohne Opfer geht es jedoch ebenfalls nicht ab.
_Wahn und Wirklichkeit_
Der letzte Schritt zum ‚realen‘ Grauen ist der Verzicht auf Übernatürliches. John Keir Cross [1911-1967], Karl Hans Strobl [1877-1946] und Christopher Fowler [*1953] erzählen von Menschen in der Krise, deren Stress sie geistig zu zerbrechen droht oder schon zerbrochen hat. Die Folgen sind furchtbar, weil hier der Mensch und nur der Mensch die Verantwortung für daraus resultierende Wahnsinnstaten trägt.
Aus dem Rahmen fallen die Storys von Clark Ashton Smith [1893-1961] und Brian McNaughton [1935-2004]. Sie mischen Horror mit Fantasy zur „Dark Fantasy“, wobei Smith trotz des schwülstigen, künstlich altmodischen Tonfalls fesselt, während McNaughton ein weiteres Mal mit seiner (zudem aus dem früheren |Festa|-Sammelband „Psycho-Express“ von 2000 recycelten) haltlos zwischen Pathos und Klamauk schwingenden Mär langweilt: neben „Papa Benjamin“ ist diese Story die einzige echte Enttäuschung in „Necrophobia II“.
Damit lässt sich leben. Das grundsätzliche Konzept der „Necrophobia“-Reihe hat seine Tragfähigkeit bewiesen. Bleibt zu hoffen, dass es bis zum dritten Teil nicht wieder so lange dauert.
_Impressum_
Originalzusammenstellung
Übersetzung: Andreas Diesel (4), Sigrid Langhaeuser (3), Jutta Swietlinski (2), Alexander Amberg (2), Felix Lake, Felix F. Frey, Friedrich v. Oppeln-Bronikowski, Heiko Langhans, Otto Knörrich (je 1)
Cover: Markus Vesper
Deutsche Erstausgabe: Juli 2008 (Festa Verlag Nr. 1521/Horror TB, Bd. 20)
415 Seiten
EUR 13,95
ISBN-13: 978-3-86552-061-6
http://www.festa-verlag.de
Partridge, Norman – dunkle Saat, Die
_Das geschieht:_
Irgendwo im Mittleren Westen der USA liegt eine kleine Stadt ohne Namen. Die Einwohner leben von den Erträgen der Maisfelder, die sich endlos außerhalb der Gemeindegrenze erstrecken. Unabhängig von den Widrigkeiten der Landwirtschaft sind die Ernten dauerhaft hoch. Das hat seinen Grund, der gleichzeitig das düstere Geheimnis der Bürgerschaft ist: Irgendwann wurde ein Pakt geschlossen. Der Preis für den Mais ist die Jagd auf den „October Boy“. In jedem Jahr wächst er aus dem Feldboden – ein Wesen aus Ranken mit einem Kürbis als Schädel. Sein Ziel ist die Kirche in der Mitte der Stadt. Sollte er sie je erreichen, ist die Gemeinde dem Untergang geweiht.
Doch die mächtige Schnittergilde sorgt dafür, dass es so weit nie kommt. Zu Halloween wird die Jagd auf den October Boy eröffnet. Alle männlichen Bewohner unter 18 Jahren müssen ihn in der Nacht jagen und umbringen. Wem dies gelingt, der darf die Stadt als reicher Mann verlassen.
Pete McCormick gehört in diesem Jahr 1963 zu den Jägern. Er will unbedingt gewinnen, denn er hat nichts zu verlieren. Jedes Mittel ist ihm recht und seine Intelligenz erstaunlich. Sie macht Pete zum ernsten Gegner für den October Boy, der voller Schrecken erwacht und alles andere als der Schrecken ist, als der er hingestellt wird. Der Boy kennt die grausame Wahrheit hinter dem Ritual, das keine Gewinner kennt. Er will die Wahrheit verkünden und den Teufelskreis durchbrechen, doch wer wird eine Kreatur aus dem Reich der Schatten anhören, zumal im Hintergrund die Schnittergilde dafür sorgen wird, dass der October Boy auf jeden Fall seinen Kürbiskopf verliert …
_Die Frage nach dem wahren Monster_
In einer großartig geschilderten Szene reinen Schreckens wird in einem toten Maisfeld der October Boy geboren – ein Monster wie aus dem Bilderbuch mit einem Körper aus verdrehten Pflanzenranken, gekleidet in die zerrissenen Gewänder einer Vogelscheuche und mit einem Kürbis als Kopf, in dem ein geisterhaftes Licht flackert: Das MUSS ein Monster sein, zumal es ein großes Messer bei sich trägt und seine Verfolger schlau und mit üblen Folgen in schmerzhafte Fallen lockt.
Kein Wunder, dass so ein Geschöpf gejagt und zur Strecke gebracht werden soll. Angenehme Schauder lenken erst einmal von Frage ab, was hinter dem Ritus steckt, der ja selbst für US-Landgemeinden ganz und gar nicht typisch ist. Warum gibt es den October Boy? Muss es ihn geben?
Allmählich wird dieses Rätsel größer, des Lesers Unbehagen steigt. Seine Sympathien schlagen um, als er erkennen muss, dass der October Boy selbst nur ein Opfer ist. Er wird in seine Rolle gepresst und will nichts sehnlicher als aus dem Albtraum zu erwachen, der sein ‚Leben‘ geworden ist.
Zu diesem Zeitpunkt hat uns Autor Partridge einen aus der Verfolgerhorde als Identifikationsfigur ans Herz gelegt. Pete McCormick steckt in seiner eigenen privaten Hölle, aus der ihn scheinbar nur der ‚Tod‘ des October Boy retten kann. Gerade der ist sein natürlicher Verbündeter – eine spannende Situation, da sich die beiden Kontrahenten selbstverständlich treffen werden.
_Es gibt Schlimmeres als böse Geister_
Die kleine Stadt ohne Namen ist ein verdammter Ort. Nach und nach schält sich heraus, in welche Abgründe der Verworfenheit sich seine Bewohner gewagt haben. Das wahre Grauen besteht indes in der Tatsache, dass sich keine übernatürliche Macht um die Einhaltung des Paktes kümmern muss. Außer dem October Boy spukt niemand umher.
Gibt es überhaupt jemanden, der Verstöße gegen den Ritus ahnden würde? Die Beantwortung dieser Frage verhindert entschlossen die Schnittergilde, deren Mitglieder sich zum Hüter des Zeremoniells und damit zu den eigentlichen Machthabern der Stadt aufgeschwungen haben. Sie schützen das System und damit ihre Privilegien nicht nur durch nackte Gewalt, sondern auch durch das Schüren der Furcht vor den Folgen, die ein Ende der „Jagd“ auf den October Boy nach sich ziehen könnte.
Die Folge ist ein Riss, der sich durch die Bevölkerung zieht: Da sind die Jugendlichen, die der Jagd und ihrer Belohnung entgegenfiebern, während ihre Eltern Bescheid wissen und still leiden. Niemand wagte bisher ernsthaft aufzubegehren. Erst die Jagd von 1963 bringt die Wende, weshalb Norman Patridge von ihr ‚berichtet‘.
_Der Ausbruch aus dem Teufelskreis_
Die Gründe dafür, wieso sich in diesem Jahr die Ereignisse überstürzen, lässt Partridge behutsam und überzeugend in die Handlung einfließen. 1963 ist das Maß voll. Sogar die Schnittergilde kann den Widerstand nicht mehr unterdrücken, der sich über die Jahre aufgestaut hat. Der October Boy ist intelligenter und willensstärker als seine Vorgänger. Pete McCormick hinterfragt die Routinen des Rituals. Mit Kelly Haines steht ihm eine weibliche Verbündete – so viel Klischee muss sein – entschlossen zur Seite.
„Die dunkle Saat“ spielt in der jüngeren Vergangenheit, weil diese Geschichte eine Abgeschiedenheit benötigt, die das 21. Jahrhundert dank Handy und Internet nicht mehr bieten kann. Die Isolation der verdammten Stadt trägt zur bedrohlichen Stimmung entscheidend bei. Sie ist nicht nur ein namenloser Punkt auf der Landkarte, sondern wirkt verloren in einem Dschungel aus Mais, der sie zusätzlich abschirmt.
Mais ist eine Pflanze, die sich hervorragend als ‚Requisit‘ für einen Horrorroman eignet. Sie wächst dem Menschen über den Kopf und bildet dichte und dunkle Felder, in denen sich Übles gut verstecken kann. Im Herbst, wenn die Tage ohnehin früh enden, steht der Mais trocken auf dem Feld, raschelt Unheil verkündend bei jedem Windstoß und erzeugt ein Unbehagen, dem sich niemand entziehen kann, der in der Nacht neben einem solchen Feld steht und lauscht.
Die Stadt ohne Namen ist auf Mais gegründet. In den USA war und ist für Farmer eine gute Maisernte die Existenzgrundlage für das kommende Jahr. Sie hoffen und bangen und sind womöglich sogar bereit, im Bund mit eindeutig unchristlichen Mächten diese Angst zu mildern … Wieder fügt Partridge diese Information geschickt dem Mosaik ein, das sich zur dramatischen Gesamtgeschichte formt.
_Verdiente Ehren für eine tolle Story_
Die ist für einen Roman ausgesprochen kurz. „Die dunkle Saat“ gehört indes zu den Werken, die genauso lang sind, wie sie sein sollen: Autor Partridge hat auf der 191. Seite seine Geschichte erzählt; nachdem er sie durchweg schlank gehalten und auf literarische Verzierungen und erzählerische Nebenstrecken verzichtet hat, mündet sie in ihr logisches und doch überraschendes Ende.
Im trüben Sud der aktuellen ‚Monster-als-love-interest‘-Gruselschmonzetten für kleine und klein gebliebene Mädchen ist „Die dunkle Saat“ ein echtes Highlight. Dass dies sogar hierzulande durch eine Veröffentlichung gewürdigt wird, liegt sicherlich auch an dem Ruf, den sich das Buch in kurzer Zeit erwerben konnte. Es wurde für mehrere Literaturpreise nominiert und konnte einen „Bram Stoker Award“ für den besten Roman des Jahres 2006 gewinnen. Den hat es zweifellos verdient – und Norman Patridge weitere Übersetzungen in diese unsere Sprache!
_Der Autor_
Norman Partridge wurde am 28. Mai 1958 in Vallejo, US-Staat Kalifornien, geboren. Er veröffentlicht seit Anfang der 1990er Jahre und begann mit Kurzgeschichten; die knapp, auf den Plot zentrierte Sprache hat er in seine Romane übertragen, die er seit 1994 vorlegt.
Partridge gehört in die Generation der (nicht mehr so) ‚jungen Wilden‘ um Joe R. Lansdale – der zu seinen engen Freunden gehört -, Ed Gorman oder Ed Bryant, die sich nicht in Schubladen pressen lassen. Er schreibt Phantastisches, Krimis und Abenteuergeschichten, wobei er unbekümmert die Genregrenzen ignoriert. Sein Roman „Wicked Prayer“, den er für die Mystery-Serie „The Crow“ verfasste, diente 2005 als Grundlage für das Drehbuch zum gleichnamigen Film.
Mit seiner Ehefrau lebt und arbeitet Norman Partridge in der San Francisco Bay Area. Über sein Werk informiert er auf seiner Website: http://www.normanpartridge.com.
_Impressum_
Originaltitel: Dark Harvest (Forest Hill/Maryland: Cemetery Dance Publications 2006)
Übersetzung: Bernhard Kleinschmidt
Deutsche Erstausgabe: September 2008 (Rowohlt Verlag/RoRoRo TB Nr. 24764)
191 Seiten
EUR 8,95
ISBN-13: 978-3-499-24764-4
http://www.rowohlt.de
Michael Connelly – Kalter Tod [Harry Bosch 13]
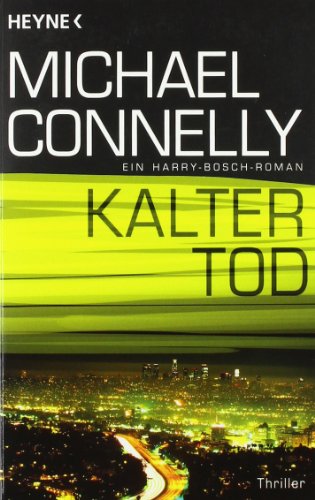
Michael Connelly – Kalter Tod [Harry Bosch 13] weiterlesen
Laymon, Richard – Keller, Der
_Das geschieht:_
|I – Im Keller (S. 7-252)|
Malcasa Point, ein Nest irgendwo in Kalifornien, 400 Einwohner – und das Horrorhaus, eine zwiespältige Touristenattraktion. Vor über 70 Jahren soll ein Serienmörder in dem viktorianischen Gebäude sein Unwesen getrieben haben, aber auch jetzt, im Jahre 1978, ist es dort nicht geheuer. Wer sich des Nachts dort umschauen will, stößt auf die Bestie, die hier ihr Lager aufgeschlagen hat.
Donna Hayes strandet auf der Flucht vor ihrem gerade aus der Haft entlassenen Ex-Gatten Roy, der für seine minderjährige Tochter Sandy ganz und gar nicht wie ein Vater empfand. Als sie ihn deshalb anzeigte und man ihn verurteilte, schwor Roy Rache und kündigte an, sie zu finden, wo immer sie sich verstecken würden. Genau das setzt er sechs Jahre später in die Tat um und hinterlässt eine Spur aus Folter und Mord, während er sich zielstrebig seiner ‚Familie‘ nähert.
Lawrence Maywood gehört zu den wenigen Menschen, die eine Begegnung mit der Bestie überlebten. Trotzdem für sein Leben gezeichnet, will er Rache und die Bestie zur Strecke bringen. Dafür heuert er den Söldner Judgment Rucker an, der an kein übernatürliches Treiben glauben mag.
Die Wege dieser fünf Personen werden sich im Horrorhaus kreuzen, ihre Schicksale sich dort entscheiden. Als Schiedsrichter tritt die Bestie auf, die – wer oder was sie auch sein mag – auf jeden Fall anwesend sein wird …
|II – Das Horrorhaus (S. 253-578)|
Ein Jahr später: Tyler vermisst Dan, einst die Liebe ihres Lebens. Kurz entschlossen packt Nora, ihre energische Freundin, die jammernde Schöne in ihren Wagen. Nachforschungen ergeben, dass Dan als Polizist in einem abgelegenen Ort namens Malcasa Point gelandet ist, wohin sich die beiden Frauen folglich aufmachen.
Den alternden Schriftsteller Gorman Hardy zieht die Geschichte des „Horrorhauses“ nach Malcasa Point. Er findet dort eine wertvolle Verbündete in der jungen Janice, die im Besitz des Tagebuchs der Lilly Thorn ist, die 1903 die Bestie im Keller des Hauses entdeckte – und lieben lernte! Das ist eine Bombenstory, die Hardy sich keinesfalls entgehen lassen möchte.
Jack und Abe, zwei Ex-Marines, die sich an Tylers und Noras Fersen (bzw. Hinterteile) heften, lassen sich von Hardy als Helfershelfer anheuern. Nachts sollen sie ins Horrorhaus einbrechen und Fotos schießen. Auch sie glauben nicht an die Bestie, was sich rasch ändert, da diese nicht nur sehr lebendig ist, sondern sich auf gänzlich unerwartete Unterstützung verlassen kann …
|III – Mitternachtstour (S. 579-1232)|
Wieder ein Jahr später: Sandy, die das Massaker im Horrorhaus vom Vorjahr überlebte, verlässt mit ihrer neuen Freundin, der Diebin und Mörderin Libby, sowie Eric, ihrem ganz besonderen Sohn, Malcasa Point und versucht ein neues Leben zu beginnen, was jedoch katastrophal fehlschlägt. Seitdem jagt Sandy erbittert aber erfolglos hinter Eric her.
1997: Das Horrorhaus ist nach mehreren Büchern und einer erfolgreichen Filmserie zu einer überregional bekannten Sehenswürdigkeit geworden. Es gehört jetzt Janice, die ihre grausame Geschichte so gut vermarkten konnte, dass sie nun mehrfache Millionärin ist. Tuck, ihr Stiefsohn, leitet eine ganze Schar von Fremdenführern, die routiniert durch das nun monsterfreie Horrorhaus führen.
Doch schon längst ist eine neue Generation gefräßiger und sexsüchtiger Kreaturen herangewachsen. Bisher haben sie sich im Hintergrund gehalten. Jetzt bricht die alte Wildheit durch. Die Bestie ist zurück und liefert den Mitgliedern der legendären Mitternachtstour durch das Horrorhaus eine Vorstellung, die nur wenige vergessen bzw. überleben werden …
_Drei Besuche im Haus der Bestie_
1232 recht ordentlich bedruckte Seiten: Diese Bestie hat ihren Verfasser, der nie Schwierigkeiten hatte, dicke Bücher mit neu ersonnenen Geschichten zu füllen, offensichtlich nachhaltig beschäftigt. Das bestätigt auch die Tatsache, dass Laymons letzte vor seinem überraschend frühen Tod 2001 fertiggestellte Arbeit der Kurzroman „Friday Night in Beast House“ war, der in diese Sammlung leider nicht aufgenommen wurde. Wie (oder ob) die Geschichte des Horrorhauses letztlich endet, bleibt auch nach der Lektüre dieses ziegelsteinstarken Werkes offen.
„Richard Laymons legendäres Meisterwerk“ soll dies sein, eifert der Klappentext. Tatsächlich liefert der Autor wie üblich wüste Kolportage. Mit nach einiger Lesezeit ermüdender Regelmäßigkeit verstößt er gegen möglichst jede politische Korrektheit, was er als beinahe ununterbrochene Folge von Splatter, Sadismen & Sex umsetzt. Mit dem Plot hält er sich dagegen nicht lange auf. „Im Keller“ gibt die Story vor: In einem von bizarren Hinterwäldlern bewohnten Städtchen – es wurde anscheinend um das „mal casa“, das „böse Haus“, herum gebaut – steht das „Beasthouse“, in dem es umgeht. Immer neue und neugierige Besucher kommen und werden zerschnetzelt oder geschändet oder beides. Wer oder was das Monster ist, wird bereits im ersten Teil enthüllt; Laymon hält nichts von Subtilität, sondern bevorzugt Vollgas und aufgeblendete Scheinwerfer.
_Das Original hat gruselige Momente_
Mit seinen nur 250 Seiten Umfang wird „Im Keller“ dem „Beasthouse“-Plot am besten gerecht. Die dünne Story gibt im Grunde gar nicht mehr her. Hier ist sie noch unbekannt und wird flott und nicht ungeschickt entwickelt. Laymon bemüht sich um Stimmung, ihm gelingen durchaus spannende Passagen, während er sich in seinen späteren Romanen oft damit begnügte, Dialogzeilen aneinanderzureihen.
1980 dürfte die Figur des Roy Hayes noch ziemlich starker Tobak gewesen sein – ein Psychopath, Folterknecht und Kinderschänder, wobei Laymon nicht ausblendet, wenn Hayes seine Triebe auslebt. Auch heute berühren diese Schilderungen den Leser so unangenehm, wie der Verfasser es geplant haben dürfte.
Laymon stellt dem ‚echten‘ Monster die „Bestie Mensch“ gegenüber. Der Mensch gewinnt, d. h. die Bosheit des Roy Hayes wirkt weitaus überzeugender, was Laymon veranlasste, die klassischen Gestalten der Dunkelheit in seinem späteren Werk mehr und mehr zugunsten sadistischer Schreckgestalten fallenzulassen.
Wie ‚böse‘ ist das Monster eigentlich? Ohne die Hilfe von Menschen, die auf seine besonderen ‚Fähigkeiten‘ nicht verzichten wollen, hätte es längst das Zeitliche gesegnet, denn es verfügt nur über geringe Intelligenz. Meist springt es als Buhmann durch seine eigene Geschichte und wird erst durch die Heimtücke seiner Spießgesellen zur Gefahr.
Schon im ersten „Beasthouse“-Roman stört indes Laymons Schlampigkeit. Er war ein schneller Schriftsteller, um es neutral auszudrücken. Was er einmal zu Papier gebracht hatte, überarbeitete er offenbar ungern. Wie sonst lässt sich das ständige Auftauchen von Figuren erklären, die kaum ordentlich eingeführt oder sogleich wieder sang- und klanglos aus der Handlung verabschiedet werden?
_Der Quark wird breiter_
„Das Horrorhaus“ entstand 1986, die Handlung knüpft indes an die Ereignisse des Jahres 1978 an. Faktisch wiederholt sich diese sogar – und das passagenweise wortwörtlich. Die dramaturgischen Grenzen des „Beasthouse“-Konzepts werden dadurch schmerzlich deutlich. Mit „Im Keller“ wurde die Geschichte eigentlich erzählt. Jetzt wird sie nur noch aufgewärmt. Die Bestie drückt sich weiter im Horrorhaus herum und tut, was sie halt nicht lassen kann. Einmal mehr geht die Gefahr vor allem von den Menschen aus.
Natürlich dürfte das auch Laymon aufgefallen sein. Er gedachte freilich nicht, dem Geschehen neue Impulse zu geben. Stattdessen lud er sie einfach mit Sexszenen an der Grenze zur Pornografie auf. Schöne, junge, stets geile Frauen machen die Mehrheit der Hauptfiguren im „Horrorhaus“ aus. Wie in seinen Gewaltschilderungen nimmt Laymon dabei kein Blatt vor den Mund. In den puritanischen USA mag er die Ideenarmut der Story seinem Publikum auf diese plumpe Weise verborgen haben. Dort, wo des Durchschnittsbürgers Hirn einer weniger eindimensionalen Gebrauchsanleitung folgt, lässt sich mit ausführlichen Waschlappen-Waschungen milchweißer Brüste und pseudo-ekstatischen Laken-Tollereien jedoch kein Blumentopf gewinnen.
Das erklärt auch, warum man um die Figuren nicht bangt, wenn ihnen die Bestie hinterhertobt: Sie sind sämtlich unsympathisch, nur Pappkameraden, die nach Schema F(uck) ‚denken‘ und handeln, wobei sich Letzteres im „Horrorhaus“ aufs Bluten & Töten beschränkt. Fast obsessiv beschreibt Laymon diese Dreiheit immer wieder in allen Details und unterstreicht die Einschätzung seiner Werke als Fastfood für knapp alphabetisierte Rednecks. Viel zu selten gelingt ihm im „Horrorhaus“ wirklich Finsteres, das ihn als Verfasser ehrt; so erschreckt die Beiläufigkeit, mit der Gorman Hardy zum Mörder mutiert und die Bestie an planvoller Bosheit leicht übertrifft. Und das Finale ist eine Splatter-Orgie, die an Dynamik und Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt.
_Ein Neuanfang nach altem Rezept_
Mit seinen 650 Seiten ist „Mitternachtstour“ umfangreicher als die ersten beiden Teile der „Beasthouse“-Serie zusammen. Für Laymons Verhältnisse ist die Geschichte komplex, spielt sie doch auf zwei Zeitebenen. Nach mehr als zehn Jahren schloss der Verfasser einerseits noch einmal an die ursprünglichen Ereignisse an, während er andererseits einen Sprung ans Ende des 20. Jahrhunderts wagte. Diese Schere schließt er langsam und führt die beiden Handlungsstränge zusammen.
Die „Beasthouse“-Saga schlägt scheinbar eine neue Richtung ein, was zu begrüßen ist, da ein weiterer Aufguss selbst den langmütigsten Gruselfreund erzürnen dürfte. In Malcasa Point sind seit dem Massaker von 1979 fast zwei Jahrzehnte verstrichen. Das Horrorhaus ist zu einem Grusel-Disneyland und einer Geldmaschine geworden, was Laymon die Gelegenheit zu sarkastischen Seitenhieben auf die Sensationsgier der ‚Nachgeborenen‘ gibt, für die das blutige Schlachten der Vergangenheit zum Freizeitvergnügen geworden ist.
Laymon wäre freilich nicht Laymon, würde er nicht bald bekannte Pfade einschlagen. Selbstverständlich ist das Monster nicht tot. Es gibt zwar keinen logischen Grund für die Kreatur, ausgerechnet nach Malcasa Point zu gehen; sie könnte ungestörter dort morden, wo man sie nicht kennt. Doch die Story fordert die ‚Heimkehr‘, wobei Laymon zugestanden werden muss, dass er viel Spannung aus der Konfrontation des „Beasthouse“-Mythos mit der ‚Realität‘ der Bestie herausholt.
Erneut ist viel Schriftstellerei per Autopilot im Spiel. Laymon traut sich tatsächlich, die sattsam bekannte Horrorhaus-Historie ein drittes Mal ausführlich und wortwörtlich zu wiederholen. Mit neuen Figuren wird auch der Leser auf einen Rundgang durch das Haus genommen, der nur dann Neues bringt, wenn man die Teile eins und zwei nicht kennt. Ein vierhundertseitiger Mittelteil und viele gesichtslose Hauptdarsteller könnten problemlos und zum Wohle der Geschichte gestrichen werden. Erneut schwelgt Laymon in dümmlichen Sex-Getümmeln, die mit der Story selbst nichts zu tun haben und heftig anöden.
Erst im Finale geht es wieder hoch her. Ein drittes Mal wird ohne Rücksicht auf etablierte Hauptfiguren gekillt, werden die Karten noch einmal neu gemischt. Das Ende ist nicht happy, und selbstverständlich öffnet es die Hintertür zu einer weiteren Fortsetzung. Auf die ist man nach dem „Keller“-Hattrick indes nicht wirklich neugierig.
_Laymon-Salven, bis die Munition ausgeht?_
„Der Keller“ ist der Höhepunkt der aktuellen Laymon-Welle, die der |Heyne|-Verlag tsunamiartig auf seine Leser zurollen lässt. Man hat den Eindruck, die angekauften und übersetzten Werke des fleißig Verfassers sollen mit aller Macht unters Volk gebracht werden, bevor dessen Aufmerksamkeit sich anderen Attraktionen zuwendet. Dazu zwingt man es allerdings förmlich, weil man ihm die Möglichkeit gibt zu erkennen, wie limitiert der Laymon-Faktor ist: Die Tricks wiederholen sich, wirklich Neues gibt es nicht. „Der Keller“ belegt, dass Laymon die Masse der Klasse vorzog, obwohl er schreiben, d. h. an tiefen, unangenehmen, normalerweise lieber unerwähnten Dingen rühren konnte. Leider ließ er viel lieber die Hormone wüten und pubertäre Kleinhirne anschwellen …
_Der Autor_
Richard Carl Laymon wurde 1947 in Chicago, Illinois, geboren, wo er auch aufwuchs. Ein Studium in Englischer Literatur begann er an der Willamette University, Oregon, und schloss es mit einem Magistertitel an der Loyola University, Los Angeles, ab. Anschließend arbeitete Laymon u. a. als Schullehrer, Bibliothekar sowie Rechercheur für eine Anwaltskanzlei.
Als Schriftsteller debütierte Laymon 1980 mit den Psychothrillern „Your Secret Admirer“ und „The Cellar“ (dt. „Haus der Schrecken“/“Im Keller“). In den folgenden beiden Jahrzehnten veröffentlichte er mehr als 60 Romane und zahlreiche Kurzgeschichten. Dabei beschränkte er sich nicht auf die Genres Horror und Thriller, sondern schrieb u. a. auch Romanzen oder Westernromane. Laymons Erfolg hielt sich in den USA lange in Grenzen; seine eigentliche Fangemeinde hielt ihm in Europa die Treue. Dafür dürften seine ungeschminkt derben und an blutigen Effekten nicht sparenden, die puritanische Sexfurcht der US-Gesellschaft ignorierenden und anklagenden Geschichten verantwortlich sein. Dennoch wurden Laymon-Werke mehrfach für renommierte Buchpreise nominiert. Im Jahre 2000 wurde „The Travelling Vampire Show“ (dt. „Die Show“) mit dem „Bram Stoker Award“ für den besten Horror-Roman des Jahres ausgezeichnet.
Den Preis konnte Richard Laymon nicht mehr selbst in Empfang nehmen. Er starb am 14. Februar 2001 an einem Herzanfall. Über sein Leben, vor allem jedoch über sein Werk informiert die Website http://www.ains.net.au/~gerlach/rlaymon2.htm.
|Originaltitel: The Cellar/The Beasthouse/The Midnight Tour
Übersetzt von Kristof Kurz
Paperback, 1232 Seiten
ISBN-13: 978-3-453-43351-9|
http://www.heyne.de
_Richard Laymon auf |Buchwurm.info|:_
[„Das Spiel“ 3491
[„Die Insel“ 2720
[„Rache“ 2507
[„Vampirjäger“ 1138
[„Nacht“ 4127
[„Das Treffen“ 4499
Patrick Mauriès – Das Kuriositätenkabinett
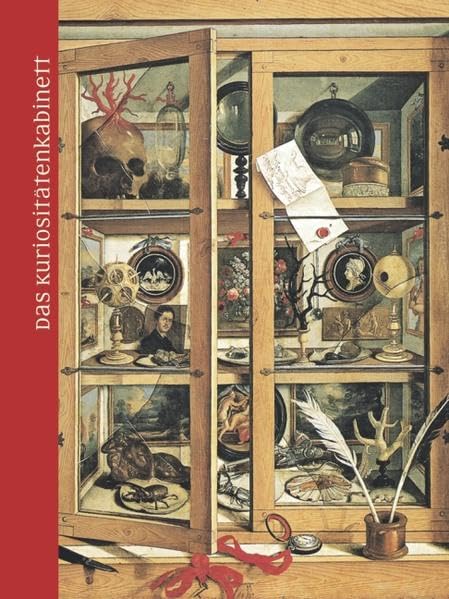
Der Mensch ist von seiner Natur aus Jäger und Sammler. Das beschränkte sich ursprünglich auf die Dinge, mit denen sich der Magen füllen ließ, erweiterte sich aber sicherlich bald auf den Kopf und bezog ein, was außerdem sein Interesse erregte. Der Drang zu wissen und die Welt um sich zu verstehen ließ sich mit dem Sammeltrieb mühelos in Einklang bringen.
Schon in der griechischen und römischen Antike begannen jene, die es sich leisten konnten, weil sie für ihren Lebensunterhalt nicht rund um die Uhr arbeiten mussten, zusammenzutragen, was die Natur produzierte und ihre Aufmerksamkeit erregte: Mineralien, Knochen, Schnecken- und Muschelschalen, Fossilien. Damit beginnt die Liste nur, denn sie ist schier unendlich. Den Inhalt sorgfältig arrangiert, schön geordnet und zum Studium bereit, schienen diese Kabinette die große Welt und den Kosmos außerhalb der eigenen Türschwelle widerzuspiegeln. Als „Welttheater“ konnte man sie in den Griff bekommen, sie überschauen und verstehen. Patrick Mauriès – Das Kuriositätenkabinett weiterlesen