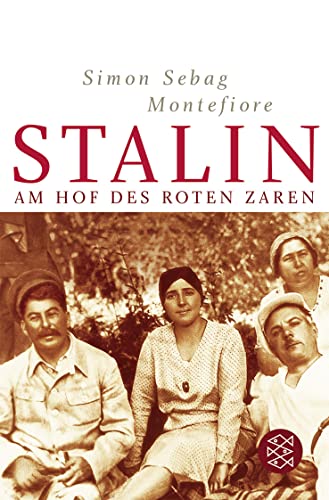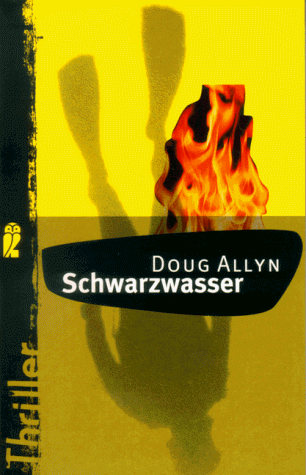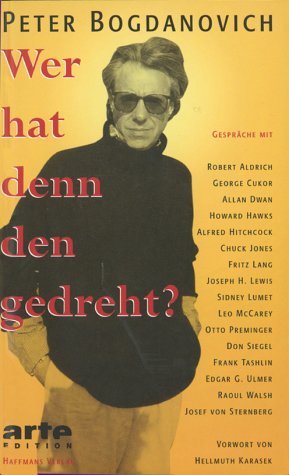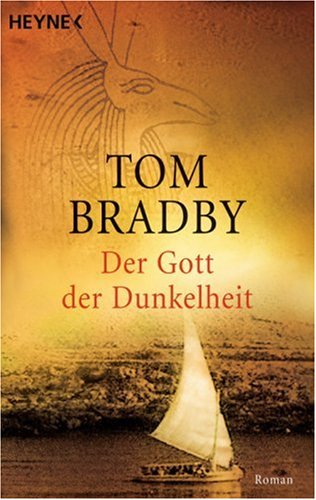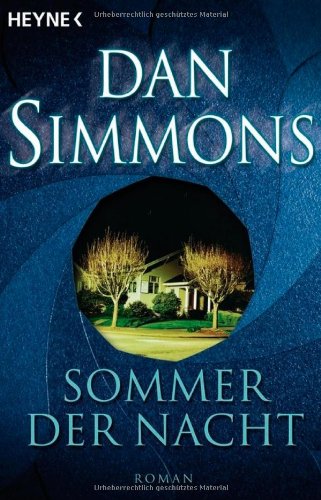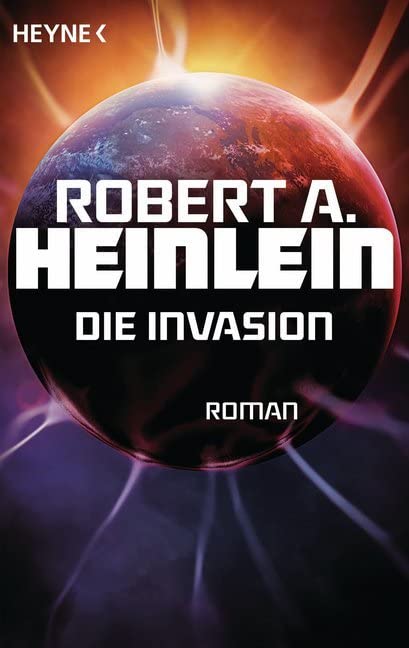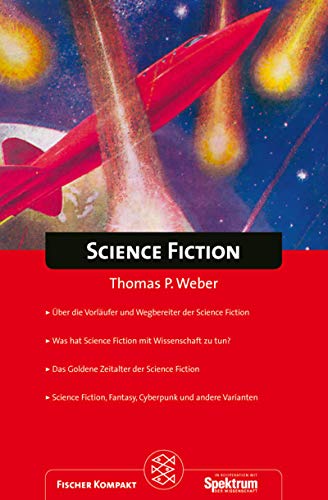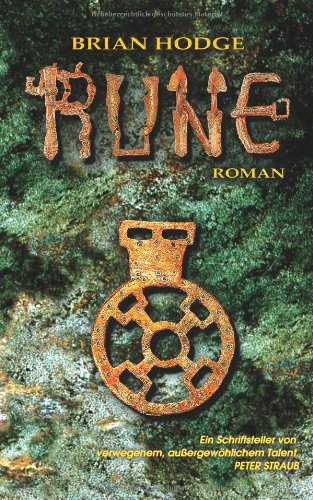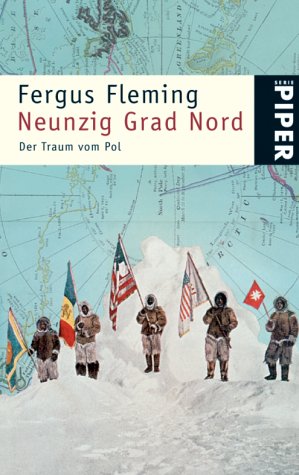Mehr als drei Jahrzehnten arbeitete die Ärztin und forensische Psychologin Helen Morrison als Profilerin, d. h. sie befragte und untersuchte gefangengesetzte Mörder, die gezielt in Serie mordeten und sich dabei so geschickt als ‚normale Menschen‘ tarnten, dass sie ihr Tun über Jahre oder Jahrzehnte fortsetzen konnten. Morrison versuchte einerseits herauszufinden, wie ihnen dies gelang, um mit der entsprechenden Kenntnis anderen, noch nicht entdeckten Serienkillern auf die Spur zu kommen, während sie sich andererseits zu begreifen bemühte, wie diese mörderischen Zeitgenossen „entstehen“ und sich entwickeln, um auf diese Weise Methoden zu ihrer frühzeitigen Erkennung und Behandlung zu finden.
Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse fasste Morrison in diesem Buch zusammen. Die Darstellung ist chronologisch strukturiert und stellt somit auch eine Autobiografie der Verfasserin dar, die ihre Arbeit verständlicherweise nicht strikt vom Privatleben trennen kann; die eine beeinflusst das andere, was folgerichtig in das Erzählte einfließt. Morrison beschreibt zunächst ihre ersten Gehversuche als Profilerin, die sie in den 1970er Jahren als junge und unerfahrene Ermittlerin mit einem Serienkiller namens „‚Babyface‘ Richard Macek“ zusammenführt. Morrison schildert die ungelenken Gehversuche, die in der Kriminalistik damals in Sachen Serienmord unternommen wurden. Es gab noch keine solide Informationsbasis, auf die man sich stützen konnte. Gewagte und aus heutiger Rückschau manchmal seltsame und riskante Versuche wurden in dieser Pionierzeit unternommen, um zu lernen, wie Serienmörder ticken („Gefährliches Terrain: Ein Serienmörder wird hypnotisiert“). Zahlreiche Sackgassen und Rückschläge mussten hingenommen werden, doch allmählich gewannen die Profiler an Boden („Einblicke in Maceks Geist“).
Im Verlauf ihrer Recherchen erkannte Morrison, dass Serienmord keine singuläre Erscheinung des 20. Jahrhunderts ist. Am Beispiel eines Veteranen – des Muttermörders und Leichenschänders Ed Gein, dessen Taten Alfred Hitchcock zum filmischen Meisterwerk „Psycho“ und Tobe Hooper zum Schock-Klassiker „Texas Chainsaw Massacre“ inspirierten – wirft Morrison einen Blick auf die (Kriminal-) Historie und weiß Serienkiller seit dem Mittelalter namhaft zu machen („Ed Gein und die Geschichte der Serienmörder“).
Prominenz und Alltag
Mit dem Fachwissen wuchs der Kreis derer, die Helen Morrison um Hilfe angingen. Es folgte die Prominenz in den Medien, die ihr manches unerfreuliche Erlebnis bescherte aber gleichzeitig half, auch mit den ‚Superstars‘ unter den Serienkillern zu arbeiten („John Wayne Gacy“). Der 33-fache Mörder Gacy verhalf ihr nicht nur zu neuen und wichtigen Erkenntnissen („Auge in Auge mit Gacy“), sondern brachte sie auch ins schmutzige Geschäft mit der ‚Gerechtigkeit‘: In den USA verdienen sich kriminalistische Fachleute gern ein Zubrot als Sprachrohre für Staatsanwälte oder Verteidiger („Im Zeugenstand beim Gacy-Prozess“).
Morrison zog sich nach diesen Erfahrungen auf ihre wissenschaftliche Arbeit zurück, verfeinerte ihre Untersuchungsmethoden parallel zu den medizinischen Errungenschaften, die inzwischen buchstäblich den Blick ins Hirn eines Menschen ermöglichten, und vertiefte ihr einschlägiges Wissen („Die Briefe und Träume des Bobby Joe Long“; „Der Sadismus des Robert Berdella“; „Der Auslöser: Michael Lee Lockhart“). Außerdem erweiterte sie ihr Untersuchungsfeld auf die Menschen, die – in der Regel ahnungslos – mit Serienmördern gelebt hatten: Eltern, Lebensgefährten, Kinder, Freunde („Serienmörder und ihre Angehörigen“) sowie jene seltsamen Menschen, die im Wissen um ihre Verbrechen mit Killern lebten oder diese bei ihren Foltermorden sogar unterstützten („Rosemary West und die Partner von Serienmördern“).
Gegenwart und Zukunft
Der Fortschritt der Kriminologie geht einher mit einer allgemeinen Globalisierung, die auch bisher fremde und isolierte Länder nicht mehr ausschließt. Dabei wird deutlich, dass Serienmörder weder Einzelfälle noch ein singuläres Phänomen der westlichen Industriestaaten sind. Es gibt sie auf der ganzen Welt („Serienmörder – ein internationales Phänomen“). Diese deprimierende Erkenntnis wird teilweise ausgeglichen durch die Tatsache, dass auch die Kriminalisten ihr Wissen verfeinern. Zwar bleibt die „CSI“-Perfektion sicherlich auch zukünftig dem Fernsehen überlassen, doch wird es Serienmördern immer schwerer fallen, ihre Untaten lange unerkannt zu treiben („Die DNA und der Mörder vom Green River“).
Morrison geht in ihrem Schlusswort noch einen Schritt weiter. Ist es möglich, Serienmörder nicht nur möglichst früh zu stellen, sondern kann man sie womöglich identifizieren, bevor sie überhaupt ihren ersten Mord begangen haben? Aus ihrer Arbeit meint sie eine Reihe von möglichen und gangbaren Wegen gefunden zu haben („Epilog: Wie geht es weiter?“).
Schlüssel zum Hirn des Killers
Bücher über Serienkiller und ihre Jäger gibt es sicherlich in ebenso großer Zahl wie ‚Sachliteratur‘ über den Heiligen Gral oder die Umtriebe der UFOs. Mit freundlicher Unterstützung durch Hannibal Lecter ist quasi ein eigenes Genre entstanden, das sich erstaunlich lange in der Gunst des Publikums hält und nicht zuletzt durch die „CSI“-Welle dank des Fernsehens neuen Auftrieb erhielt. Vom Treiben fiktiver Unholde und markiger Mörderfänger profitieren auch reale Kriminalisten, die lange im Verborgenen arbeiten mussten. Heute sind die neugierigen Laien geradezu süchtig nach Blicken in Labors & Leichenhallen, in denen Spezialisten gleich mittelalterlichen Hexenmeistern aus winzigsten Spuren verbrecherische Szenarien rekonstruieren.
Helen Morrison tritt erst auf den Plan, wenn der Strolch – Serienmörder sind in der Regel männlich – bereits gefasst wurde und sicher hinter Gittern setzt. Mit Fragebogen und Hirnstrommessgerät setzt sie sich dem Täter gegenüber und horcht ihn aus. Was keine besonders komplizierte Aufgabe zu sein scheint, relativiert sich durch die Erkenntnis, dass sie es hier mit Menschen zu bekommt, denen Gesetzesvorschriften oder die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens nichts bedeuten: Serienmörder, das weiß uns Morrison in ihrem Buch deutlich zu machen, leben nach ihrem eigenen Verhaltenskodex, der ausschließlich auf ihre privaten Bedürfnisse zugeschnitten ist, zu denen mit einer Furcht erregenden Selbstverständlichkeit Folter und Mord in Serie gehören.
Die Tatsache, dass man es mit einer „anderen Art“ von Mensch zu tun hat, die womöglich geistig gar nicht in der Lage ist zu begreifen, welcher Verbrechen sie sich schuldig macht, erschwert verständlicherweise die Kommunikation mit Serienmördern. Manche sind sogar stolz auf ihre ‚Leistungen‘ und erinnern sich gern ihrer Untaten, was wiederum Morrison einen wichtigen Zugang zur fremdartigen Denkwelt dieser Männer (und einiger weniger Frauen) öffnet.
Profiling als Geschäft
Dies zu schaffen, ermöglicht nicht nur viel Geduld – Morrison ringt und debattiert oft Wochen und Monate mit ihren Gesprächspartnern -, sondern auch eine stabile Psyche, denn mit einem Serienmörder in wirklich engen Kontakt zu treten, bedeutet wahrlich einen Blick in den Abgrund. Unglaubliche Scheußlichkeiten muss Morrison sich nicht nur auf Tatortfotos anschauen, sondern sich von oft triumphierenden Mördern in allen Details beschreiben lassen. Eine Flut belastender, dabei oft wenig informativer Worte und Bilder ergießt sich über sie, unter denen sie die wenigen relevanten Fakten erkennen muss und auswerten kann.
In mehr als drei Jahrzehnten hat Morrison ihr Verständnis vom Serienmörder entwickelt. Sie vertritt klare Standpunkte, die ihr Werk freilich nicht unumstritten machen. So ist sie beispielsweise davon überzeugt, dass Serienmörder als solche bereits geboren werden, sie also genetisch vorbelastet sind und letztlich außerstande sind zu begreifen, was sie anrichten. Auch gegen den Drang zum wiederholten Töten können sie sich im Grunde nicht wehren, so Morrison. Nach ihrer Meinung sind Serienmörder Menschen, die sich emotional niemals entwickelt haben sondern auf der Stufe eines Säuglings, der handelt ohne zuvor über eventuelle Folgen nachzudenken, stehengeblieben sind.
Die Logik dieser Theorie eines rein biologisch bedingten Serienmord-Phänomens ist weder absolut schlüssig noch in der Beweisführung überzeugend. Morrison ist sich dieser Tatsache bewusst. Man muss ihr hoch anrechnen, dass sie der Kontroverse nicht ausweicht, indem sie beispielsweise über ihrer Argumentation Nebelkerzen zündet. Klipp und klar und für Kritik sofort erkennbar fallen ihre Äußerungen aus. Unangenehmen Wahrheiten geht Morrison dabei nie aus dem Weg. Die Welt der Kriminalisten dreht sich nicht ausschließlich um die Suche nach Wahrheiten, sondern wird geprägt von Animositäten, Konkurrenzdenken und im Brustton der Überzeugung geäußerten Falscherkenntnissen. Mit seltener Deutlichkeit nennt Morrison Namen und Ereignisse, die kein gutes Licht auf die Forensiker, Profiler und kriminalistischen Psychologen werfen. Die Autoren ist eindeutig niemand, die ihrem Gegner auch die andere Wange hinhält, ihr Buch auch eine Abrechnung mit Zeitgenossen, die ihr beruflich in die Quere gekommen sind.
Warnung vor dem Heiler!
Unter diesen Aspekten muss man vor allem Morrisons Schlussfolgerungen im letzten Kapitel bewerten. Allen Ernstes plädiert sie für noch intensivere Untersuchungen weiterer Serienmörder, die Gehirnoperationen einschließen. Nicht einmal die Justiz der USA, die kaum als menschenfreundlich zu bezeichnen ist, gestattet solche Experimente. Morrison geht noch wesentlich weiter: Sie denkt über mögliche Konsequenzen ihrer Forschungsarbeit nach. Was geschieht, wenn sie wirklich eine Art ‚Serienmörder-Gen‘ entdeckt? Sollten alle Neugeborenen entsprechend untersucht werden? Kann man sie ‚heilen‘, wenn besagtes Gen auftritt? Falls nicht: Was macht man mit ihnen? Steckt man sie in Gefängnissanatorien, bevor sie – eventuell – zu morden beginnen?
Mit solchen drastischen ‚Anregungen‘ möchte die Verfasserin einerseits provozieren, denn der Serienmord ist für sie, die sich tagtäglich damit beschäftigt, ein brennendes Problem, dem von Politik und Öffentlichkeit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Andererseits resultiert Morrisons Vorstoß aus dem, was sie lernen musste: Serienmörder sind nicht unbedingt die seelenlosen Kreaturen, die sie in ihren sieht. Auf jeden Fall aber sind jene Menschen und ihre Familien und Freunde unschuldig, die unter mörderischen Attacken schreckliche Qualen erdulden müssen. Wer so etwas quasi miterlebt, wird sich in der Planung von Gegenmaßnahmen nicht von den Grenzen des politisch Korrekten bremsen lassen.
„Mein Leben unter Serienmördern“ ist letztlich kein Fach- oder Lehrbuch, sondern ein allgemeinverständliches Sachbuch, das informieren und Denkanstöße liefern möchte. Als solches ist es eine interessante und anregende Lektüre. Morrison hält sich im Ton meist zurück, ohne aber zu leugnen, dass auch sie oft erschüttert und angeschlagen oder angewidert ihre Arbeitsstätten verlässt. Es fehlt das aufdringlich Spektakuläre, das Schwelgen in blutigen Details, welchem die „True Crime“-Sparte ihren anrüchigen Ruf verdankt. Morrison verzichtet auf Fotos von Tatorten oder die üblichen Fahndungsbilder von Verbrechern, denen ‚Monster‘ praktisch in die Fratzengesichter geschrieben steht. Das Buch kann durch solche Zurückhaltung am richtigen Fleck nur gewinnen.
Autorin
Helen Morrison (*1942) ist Ärztin und als solche spezialisiert auf die Gebiete Neurologie und Psychiatrie. Seit mehr als drei Jahrzehnten arbeitet sie als forensische Psychologin und hat mehrere Fachbücher sowie mehr als 125 Artikel für wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. Mit ihrer Familie lebt Morrison in Chicago.
Taschenbuch: 352 Seiten
Originaltitel: My Life Among the Serial Killers (New York : William Morrow 2004)
Übersetzung: Sebastian Vogel
http://www.randomhouse.de/goldmann
Der Autor vergibt: