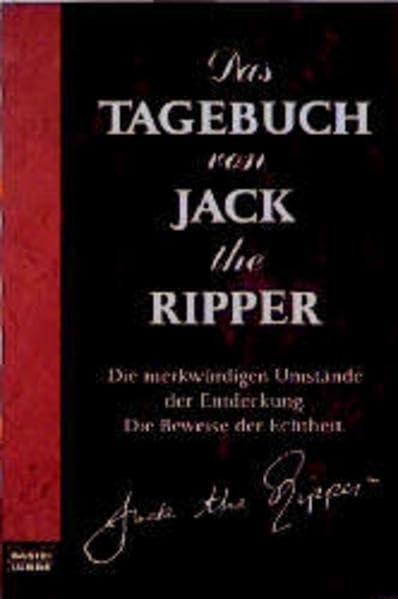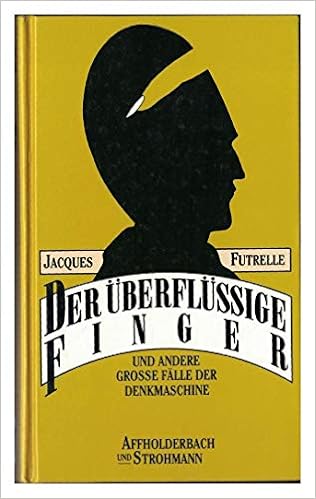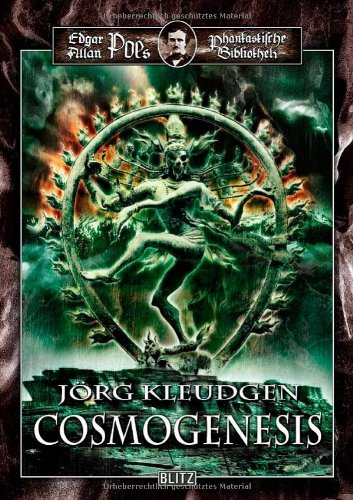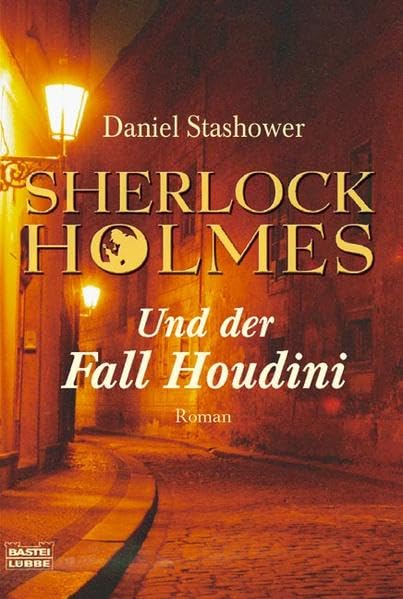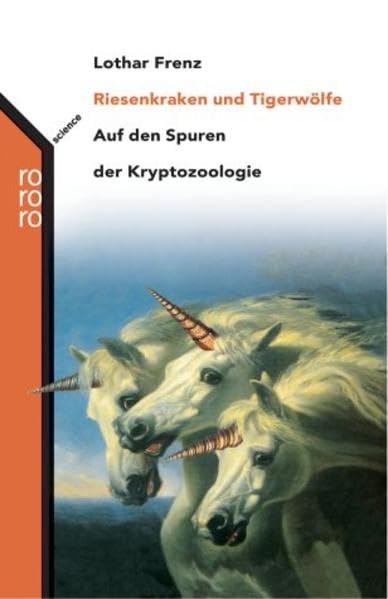Kôji Suzuki – Ring 0: Birthday weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Bo R. Holmberg – Schneegrab

Bo R. Holmberg – Schneegrab weiterlesen
Harrison, Shirley – Tagebuch von Jack the Ripper, Das
Wie es heißt, ist nichts so tot wie der Bestseller der letzten Saison. Falls dies zutreffen sollte, hätte sich Ihr Rezensent mit diesem Artikel eine Menge unnötiger Arbeit gemacht. Die (angebliche) Sensation um die Entdeckung des Tagebuchs von Jack the Ripper ist nämlich schon ein Jahrzehnt alt. Die gebundene Ausgabe des vorliegenden Buches wurde auch in Deutschland Anfang der 1990er Jahre mit Fanfarenschall in die Läden begleitet und fand in der Presse die gewünschte, weil verkaufsförderliche Resonanz. Selbst negative Werbung sorgt für Aufsehen, und so ließen sich kluge Köpfe, Besserwisser und Spinner gleichermaßen lang und breit aus über ein Medienphänomen, das die Menschen seit über einem Jahrhundert fasziniert, ohne dass darob Einigkeit darüber erzielt werden konnte, ob denn das auf so wundersame Weise zutage geförderte Tagebuch tatsächlich aus der Feder des Rippers geflossen war.
Nachdem die Aufregung abgeklungen ist, kann man sich der Beantwortung dieser Frage wesentlich gelassener widmen – wenn es denn überhaupt erforderlich ist, denn „Das Tagebuch von Jack the Ripper“ ist auch jenseits aller Sensationshascherei eine interessante Lektüre. Tatsächlich wird es bald völlig unerheblich, ob der böse Jack denn ein rauschgiftsüchtiger Baumwollhändler namens James Maybrick aus dem englischen Liverpool gewesen ist und seine Untaten in einem Tagebuch festgehalten hat, das in einem unbekannten Versteck ein volles Jahrhundert überdauerte, bis es auf mysteriöse Weise in die Hände eines arbeitslosen Seemannes geriet …
Shirley Harrisons Darstellung gewinnt ihren Wert als Bestandsaufnahme eines Jahrhunderträtsels: Um das Tagebuch in die bekannte Chronologie der Rippermorde einzupassen, muss die Autorin das London von 1888 wieder erstehen lassen und das Drama und seine Akteure noch einmal ihrem Publikum vorstellen. Freilich tut sie das mehr als 100 Jahre später und nach durchaus sorgfältiger Sichtung der in diesem Zeitraum erschienenen Ripper-Literatur bzw. wiederentdeckten Quellen. Besonders Letztere haben es in sich, denn überraschenderweise werden bis auf den heutigen Tag neue Belege entdeckt. Harrison wartet denn auch mit Fakten auf, die einige Irrtümer früherer „Ripperologen“ eliminieren, nachdem sie lange Zeit immer wieder aufgegriffen wurden.
So darf sich der Leser einer vorzüglichen Zusammenfassung der Ereignisse vom August bis November 1888 erfreuen, wenn diese Formulierung angesichts des Themas gestattet sei. Weil im Zeitalter des privaten Fernsehens manch’ alter Zopf abgeschnitten wurde, werden ihm (und auch ihr) einige zeitgenössische Tatort- und Leichenfotos präsentiert. Sie bieten eine ausgezeichnete Gelegenheit zur Überprüfung der alten Weisheit, dass es nicht immer eine reine Freude sein muss, seine Neugier befriedigen zu können. Was Jack the Ripper seinen Opfern angetan hat, ist wahrlich ungeheuerlich. Der Anblick ist schwer zu ertragen, macht aber eines sehr schön deutlich: Irgendwann müssen sich der authentische und der mythologische Jack voneinander getrennt haben. Der rste war ein lebensgefährlicher, schwer geisteskranker Psychopath, der zweite ein früher Medienstar, ein Zeitgenosse von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, von Graf Dracula und Sherlock Holmes. Irgendwie ist das Bewusstsein geschwunden, dass diese Figuren fiktiv waren, während Jack the Ripper eine sehr reale Person gewesen ist. Aber man hat ihn niemals gestellt und vor Gericht entzaubert, und so war sein Weg frei in den Olymp kultisch verehrter Bösewichte. Als sich dann die moderne Unterhaltungsindustrie des Rippers annahm, war der Übergang vollzogen.
Shirley Harrison belegt sehr schön, wie „unser“ Jack the Ripper ein Geschöpf der Medien wurde – vielleicht sogar ihre erste und höchst gelungene Schöpfung! Serienmörder hatte es schon vor 1888 gegeben – aber nicht in einer Stadt wie London, in der Ende des 19. Jahrhunderts 200 (!) Tageszeitungen um Leser kämpften. Die Presse machte Jack the Ripper erst berühmt und dann unsterblich. Er hat dies selbst sehr gut begriffen, sich seiner Taten in Leserbriefen gerühmt und neue Scheußlichkeiten angekündigt. Insofern ist der Fall Jack the Ripper quasi ein Modell für das, was die Massenmedien heute zu „leisten“ vermögen.
Diese Entwicklung wird von Harrison angedeutet, aber leider nicht weiter ausgeführt; hier ist Ihr Rezensent – so gut er es vermochte – in die Bresche gesprungen. Die Autorin kehrt verständlicherweise bald zu ihrem eigentlichen Anliegen zurück: Sie bemüht sich, den Ripper auf den Spuren ihres Hauptverdächtigen James Maybrick zu entlarven. Das will ihr auf stolzen 450 Seiten allerdings nie wirklich gelingen. Zu apokryph ist das Manuskript, zu fadenscheinig seine Überlieferungsgeschichte, und selbst ein Heer von Historikern, Graphologen und anderen Sachverständigen konnte zu keinem eindeutigen Urteil kommen. Dass Harrison sowohl die Indizien für wie die Belege gegen das Tagebuch ausführlich vorstellt, muss ihr hoch angerechnet werden. Ihr bleibt auf der anderen Seite auch gar keine Alternative, will sie doch einem möglichen Desaster vorbeugen, wie es den „Stern“ 1983 mit den angeblichen Hitler-Tagebüchern getroffen hat.
In den Jahren seit dem Erscheinen der englischen Originalausgabe ist es bemerkenswert ruhig um das Tagebuch geworden. Das ist im Grunde die beste Bestätigung dafür, dass es nicht überzeugen konnte. Aber wie die Autorin selbst sehr richtig sagt: Wenn es eine Fälschung ist, dann ist sie großartig gelungen. Davon kann man sich übrigens selbst überzeugen: Dem fotografischen Faksimile aller erhaltenen Seiten wird eine Übersetzung beigefügt. Wenigstens steht nach der Lektüre fest, dass Jack the Ripper nicht zu allem Überfluss ein begabter Schriftsteller gewesen ist …
Sein (bzw. James Maybricks) Ende war übrigens düster – oder angemessen, wenn man so will: Von Drogensucht und Schuldgefühlen zerfressen, ließ sich Jack the Ripper im Mai 1889 von seiner eigenen Ehefrau vergiften. Hier stutzt der Leser, doch dieses Mal wird er von Shirley Harrison schmählich im Stich gelassen. Offensichtlich ist für sie der Punkt erreicht, an dem sie den Erfolg ihres potenziellen Bestsellers ungern durch allzu viel Realität gefährden möchte. Außerdem lässt sich der Tod des Rippers viel zu schön mit einem weiteren Klassiker der „True Crime“-Literatur verknüpfen: der Geschichte vom Prozess gegen seine angebliche Mörderin und Ehefrau, der so tatsächlich 1889 stattgefunden hat und offensichtlich ein Paradebeispiel für einen echten Justizskandal ist. Das ist bei Harrison so spannend wie ein Thriller nachzulesen, hat aber mit der Frage, ob James Maybrick Jack the Ripper war, nur indirekt zu tun.
So schlingert Shirley Harrison immer eng an den Fakten entlang, ohne sich jemals wirklich festzulegen oder endgültig den Bezug zum Beweisbaren zu verlieren. Weil man Wahrheit und Mutmaßung jedoch gut voneinander trennen kann, nimmt man ihr das nicht übel. Noch einmal sei dem Leser versichert: „Das Tagebuch von Jack the Ripper“ besitzt unabhängig davon, ob es echt ist, jederzeit einen hohen Unterhaltungswert. In der Taschenbuchausgabe ist es darüber hinaus bei seiner Ausstattung sehr preisgünstig; allerdings leidet die Qualität der Abbildungen in der Verkleinerung erheblich. Was die blutrünstigen Opferfotos angeht, so ist dies nur von Vorteil, aber die interessanten zeitgenössischen Presseartikel, Porträts oder Lagepläne wünscht man sich schon etwas übersichtlicher.
Officer, Charles / Page, Jake – Entdeckung der Arktis, Die
Was sind das nur für seltsame Menschen, die es hinaufzieht in eine Welt, die etwa so einladend ist wie die Rückseite des Mondes? Tatsächlich gibt es weitaus angenehmere Reiseziele auf der guten Mutter Erde, doch wie so oft darf man die (Neu-)Gier ihrer angeblich vernunftbegabten Bewohner nicht unterschätzen: Wo es schwierig bis unmöglich ist hinzugelangen, muss es ganz besonders interessant sein!
Seit zweieinhalb Jahrtausenden (!) zieht es daher den Menschen in den Norden, der damals noch bevölkert war (oder wurde) mit allerlei finsteren Gottheiten, Ungeheuern und anderen ungeselligen Zeitgenossen. Lässt sich die Geschichte der Arktisforschung angesichts einer solchen gewaltigen Zeitspanne auf weniger als 300 Seiten zusammenfassen? Wie wir sehen werden, geht es; vorzüglich sogar, wenn hinter der Feder jemand sitzt, der sein Handwerk versteht.
Hier sind es sogar zwei Autoren, die sich den Lorbeer teilen dürfen. Die Wissenschaftsjournalisten Charles Officer und Jake Page profitieren nicht nur von den Ergebnissen einer kundigen Recherche, sondern mindestens ebenso von ihrer Bereitschaft und ihrer Fähigkeit, die Fakten zu ordnen und auszuwählen. Das Ergebnis ist eine Darstellung, die sich in eine Einleitung, eine Vorgeschichte, einen dreiteiligen Hauptteil, ein Nachwort und einen Ausblick gliedert, die Erkundung der Arktis klipp und klar und vor allem überzeugend nachzeichnet und überdies fabelhaft zu lesen ist.
Besagte Einleitung führt in die Natur der Arktis ein, stellt auf wenigen Seiten Informationen über Klima, Relief, Tierwelt oder Meeresströmungen vor, die zu ergründen es Jahrhunderte entsagungsvoller Forschungen bedurft hatte und für die unsere Entdeckungsreisenden der Vergangenheit ohne Zögern ihren rechten Arm gegeben hätten. Wer meint, Officers & Pages Blitzseminar rieche zu sehr nach Kreidestaub, führe sich nur die Schwierigkeiten der Reiseplanung in einem Land vor Augen, in dem am Pol die einzige Himmelsrichtung der Süden ist und die Sonne entweder ein halbes Jahr wie angenagelt am Firmament hängt (= Sommer) oder im Winter dieselbe Zeitspanne durch völlige Abwesenheit glänzt (bzw. eben nicht) …
Im zweite Teil ihres Buches beschreiben unsere Autoren die notgedrungen recht lückenhaft bleibende Vorgeschichte der eigentlichen Arktiserkundungen. Mit der Überlieferung ist es so eine Sache; Naturkatastrophen, Kriege und die übliche menschliche Gleichgültigkeit im Umgang mit dem, was längst Verblichene zusammengetragen haben, lassen die Rekonstruktion der ersten beiden Jahrtausende nur teilweise gelingen. Immerhin wissen wir von wagemutigen Phöniziern, neugierigen Griechen und raublustigen Nordmännern, und in Gestalt der Brüder Zeno aus Venedig treten uns bereits zwei typische Repräsentanten einer ganz besonderen Gruppe von Forschungsreisenden entgegen: die Aufschneider und Lügenbolde, die geschickt die einstige Unendlichkeit der Welt nutzten, um von gefährlichen Fahrten und ruhmreichen Abenteuern zu „berichten“, die sich ausschließlich in ihrem Hinterkopf abgespielt hatten. Die Zenos markieren eine lange Reihe verdächtiger Arktisreisen, die ihren Höhepunkt sogar erst im 20. Jahrhundert finden sollten, wie wir weiter unten noch feststellen werden.
Etwa ab 1500 wurde es ernst mit der Arktisforschung, als sich zum Wissensdurst handfeste wirtschaftliche und militärische Interessen gesellten, die mit mehr als einem Spritzer Patriotismus garniert wurden. Die Briten, die Russen und die Skandinavier suchten nach einer Nordostpassage von der Nordsee zum Pazifik, weil es verständlicherweise mühsam und zeitaufwändig war, erst den gesamten afrikanischen Kontinent umrunden zu müssen, um dorthin zu gelangen. (Den Suez-Kanal gibt es erst seit 1869.)
Auf der amerikanischen Hälfte der Erde stand man vor einem ähnlichen Problem: Wollte man (im Osten startend) die Westküste Nordamerikas oder die lukrativen asiatischen Gewässer auf dem Seeweg erreichen, musste man eine riesige Außenkurve um Südamerika schlagen; schön, wenn es eine Abkürzung im Norden gäbe: eine Nordwestpassage. Auch hier waren es vor allem die Briten und die Skandinavier, die sich auf die Suche begaben (während die Nordamerikaner verständlicherweise den Standpunkt vertraten, es sei wesentlich einfacher, ein paar Hafenstädte an der Westküste zu errichten.)
Und als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beide Passagen endlich gefunden (und gleich wieder wegen ihrer witterungsbedingten Untauglichkeit für die Schifffahrt verworfen) worden waren, rückte das letzte Ziel in den Mittelpunkt des Interesses: der Nordpol, „höchster“ Punkt unseres Erdballs, eigentlich nur ein beliebiger Punkt in einer öden Landschaft, dessen Erreichen höchstens den sportlichen Ehrgeiz befriedigen konnte.
Den darf man allerdings nicht unterschätzen; ganz besonders nicht in einer Welt, in der Nationalstolz buchstäblich tödlich ernst genommen wird. Also stürmten sie los, die Polarexpeditionen aus (fast) allen Ländern der Nordhalbkugel. Die meisten kamen nicht einmal in die Nähe ihres Ziels; nicht wenige blieben (zur Freude der stets hungrigen Eisbären und Polarfüchse) für immer im hohen Norden.
Siehe da: Es erscheinen neben vielen ernsthaften Aspiranten wieder unsere Möchtegern-Arktisfahrer, deren prominentester Vertreter ausgerechnet der Mann ist, der den Nordpol im Jahre 1909 erreicht haben will. Tatsächlich weiß auch heute niemand so recht, ob Robert E. Peary das wirklich gelungen ist. Die Beweisdecke war denkbar dünn, Peary bemerkenswert wortkarg, die Anerkennung des Polsieges primär eine politische Entscheidung. In der Darstellung dieses äußerst dubiosen Kapitels der Entdeckungsgeschichte erreicht „Die Entdeckung der Arktis“ in der Tat die Qualitäten eines Kriminalromans, wie der sonst stets mit Misstrauen zu betrachtende Hochjubel-Profi „Kirkus Review“ auf dem Cover dröhnt.
John Wyndham – Die Triffids

John Wyndham – Die Triffids weiterlesen
Baumann, Mary K. (u. a.) – All!, Das. Unendliche Weiten
Eine Darstellung des Weltalls in acht spektakulären Großkapiteln. Eingeleitet wird sie vom Vorwort eines Mannes, der als Leitfigur der modernen Astronomie gilt: Stephen Hawking. Der fast vollständig gelähmte Forscher mit dem vom Körper quasi losgelösten Geist hat entscheidend mit zum gegenwärtigen Blick auf den Kosmos beigetragen.
– „Ursprung“ (S. 8/9): Ein Bild der Milchstraße, wie sie vom Planeten Erde gesehen werden kann, leitet dieses Buch würdig ein: „Unser“ Sonnensystem verliert sich in einer Galaxie, die aus 200 Milliarden Sternen besteht und nur eine von vermutlich 150 Milliarden Galaxien im All ist – ein Vorgeschmack der Maßstäbe, die dieses Buch in Sachen „Unendlichkeit“ setzen wird!
– „Nebel“ (S. 10-29): „Geburt“ und „Tod“ der Sterne, die wir Menschen im Weltall erkennen können, verschwimmen in gewaltigen Nebelwolken. Sie bilden die galaktische „Ursuppe“, aus der sich Sonnen bilden und „zünden“ können, und sie stellen die Asche dar, die von den Sonnen bleibt, die in rasenden Explosionen „sterben“ und deren Überreste sich im Universum verteilen, wo sie zu neuen Sternen zusammenfinden.
– „Sterne“ (S. 30-53): Sie sind gebündelte Energie – vom „Weißen Zwerg“ bis zum „Blauen Überriesen“ gibt es zahlreiche Arten von Sternen. Sie erscheinen uns Menschen bizarr und sogar bedrohlich, sind im All jedoch überall zu finden. Das Wissen um ihre Existenz verdeutlicht, wie winzig die Chance war, dass ein kleiner blauer Planet eine mittelgroße gelbe Sonne am Rand der Milchstraße umkreisen und Leben hervorbringen konnte.
– „Die Sonne“ (S. 54-75″): Dies ist umso bemerkenswerter, als besagte Sonne sich bei näherer Betrachtung als grausiger Feuerball entpuppt, der nicht nur Hitze ausstrahlt, sondern mit diversen Todesstrahlen um sich schießt. Der Blick in die atomare Superhölle der „Sonnenfabrik“ ist heute möglich. Er enthüllt bei allem Schrecken, dass uns Menschen auf der Erde ohne „unseren“ Stern nur acht Minuten von einer eisigen Ewigkeit trennen.
– „Planeten“ (S. 76-115): Sie folgen der Sonne – neun Planeten umkreisen ihr Zentralgestirn. Nur auf einem hat sich nachweislich Leben entwickelt; Nr. 1 und 2 sowie 4 bis 9 sind glühend heiß oder
knochentrocken, bestehen aus Gas oder sind ewige Eisklumpen, also insgesamt
ungastlich. Womöglich gibt es nirgendwo Leben auf ihnen, aber das lässt sie nicht weniger interessant erscheinen: Jeder Planet stellt ein Kapitel in der Entstehungsgeschichte des Universums dar und der Mensch lernt immer besser, sie zu „lesen“.
– „Monde“ (S. 116-141): Mindestens 140 kleine bis sehr große Himmelskörper gesellen sich den Planeten als Monde zu – Kugeln aus Stein und Eis, die von „ihren“ Planeten in den Bann gezwungen wurden und sie umkreisen. Darunter sind groteske Seltsamkeiten wie Phobos und Deimos, die kartoffelförmigen Winzmonde des Mars, aber auch gewaltige Welten wie die großen Jupitermonde, von denen einige trotz ihrer spezifischen Eigentümlichkeiten womöglich eigenständiges Leben hervorgebracht haben.
– „Galaxien“ (S. 142-159): Die Vorstellungskraft des Menschen beginnt zu versagen, lässt er die Grenzen des eigenen Sonnensystems oder gar der Milchstraße hinter sich. Milliarden weiterer Galaxien stehen am Firmament. Sie sind oft von einer Fremdartigkeit, die erschreckt. Die moderne Astronomie hat unerschrocken begonnen, „Ordnung“ in dieses kosmische Gewirr zu bringen; wieso dies eine Sisyphusarbeit ist, können die Fotos dieses Kapitels nachdrücklich belegen.
– „In den Weiten des Alls“ (S. 160-171): Doch damit beginnen die Rätsel eigentlich erst. Das Universum ist seit seiner Entstehung so groß geworden, dass selbst das Licht der Galaxien an seinem „Rand“ die Erde kaum erreicht hat. Was wir sehen oder sichtbar machen können, ist ein Blick in die Vergangenheit. Je weiter wir schauen, desto „älter“ ist das Licht, das uns somit die Welt nach dem „Big Band“ zeigt, mit dem alles begann. 13 Milliarden Jahre können wir inzwischen zurückblicken, womit wir uns dem Ursprung allen Seins zu nähern beginnen.
„Das All!“ ist über die Präsentation kosmischer Phänomene hinaus Bestandsaufnahme der fotografischen Technik, die es heute ermöglicht, diese Wunder zu fixieren, die dem menschlichen Auge sonst verborgen bleiben müssten. „Das Universum der Farben“ erläutert, wie die sensationellen Bilder in diesem Buch möglich wurden. Ergänzt wird dieses Kapitel durch eine kommentierte Auflistung der unerhört ausgetüftelten Teleskope, Satelliten, Raumschiffe, Sonden und Kameras, die in vier Jahrzehnten jenes Bild vom Kosmos vermitteln halfen, das in diesem Buch dokumentiert wird. Ein zweiseitiges Glossar erläutert noch einmal die wichtigsten astronomischen Fachbegriffe, an denen dieses Buch notgedrungen so reich ist. Der Index ermöglicht es abschließend, bestimmte Informationen nachzuschlagen.
Ist es möglich, auf weniger als 200 Bild- und Textseiten darzustellen, was „da draußen“ im Universum „ist“? Die Verfasser des hier vorgelegten Werkes können diese Frage geradezu Aufsehen erregend bejahen: Es funktioniert, wenn man auf ein Bildmaterial zurückgreifen kann, das die sensationellsten astronomischen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte umfasst.
Kein halbes Jahrhundert ist es her, dass kamerabestückte Sonden ins All geschossen wurden. Was sie vor Ort in Bildern festhielten, revolutionierte damals die astronomische Wissenschaft. Und doch wirken diese Fotos heute „wie mit einer Pappkamera gemacht“: so das drastische Urteil eines der Autoren dieses Buches. Was er damit meint, wird rasch klar: Die hier auf knapp 190 Seiten versammelten Abbildungen dokumentieren einen Fortschritt, dessen Ergebnisse den Menschen erschrecken können.
Gemeint sind damit weniger die Bilder von den Planeten, Monden und Asteroiden des Sonnensystems. Sie sind primär faszinierend, stellen sie uns doch in nie gekannten Details Orte vor, die wir vom Blick in den Nachthimmel kennen oder von denen wir gelesen haben: Dass es einen Uranus, einen Neptun oder einen Pluto gibt, kann sich heute (hoffentlich) selbst der naturwissenschaftliche Ignorant vorstellen.
Doch die Vorstellungskraft wird auf eine harte Probe gestellt, sobald der Blick über dieses Sonnensystem hinausschweift. „200 Milliarden Sterne“ findet man dort: Das ist ein Wert, unter dem sich der Mensch nicht wirklich etwas vorstellen kann. Dabei ist dies nur die Zahl der Sterne in der eigenen Milchstraße! Das Universum erstreckt sich vermutlich mehr als 13 Milliarden Lichtjahre in alle Richtungen und dehnt sich beständig weiter aus. Was soll man sich unter dieser Entfernung vorstellen? Hier müssen die meisten Menschen ihre geistigen Waffen strecken. „Das All!“ macht deutlich, dass trotzdem die Arbeit an der Entschlüsselung der universalen Geheimnisse wacker voranschreitet. Da draußen ist nicht nur etwas, es lässt sich auch ergründen und erklären.
Die moderne Technik unterstützt solche Forschungen. Was sich der Mensch einfallen ließ, um 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit zu blicken, versöhnt durchaus mit den alltäglichen Scheußlichkeiten, die sich unsere Spezies so reichlich einfallen lässt: Richtet er sich gezielt auf Ziele, richtet der menschliche Geist wahrlich Erstaunliches aus! Wer hätte noch vor zehn, fünfzehn Jahren geglaubt, dass sich theoretische Konstrukte wie „Pulsare“ oder „Schwarze Löcher“ tatsächlich fotografisch belegen lassen? Immer Neues bringt die Suche im Kosmos zu Tage. Vieles fügt sich zu dem, was man bisher in Erfahrung brachte, anderes verstört ob seiner unglaublichen Fremdartigkeit. Doch auch diese Entdeckungen werden früher oder später entschlüsselt; daran lässt die Lektüre von „Das All!“ kaum Zweifel.
Für gottesgläubige Zeitgenossen mag das erschreckend oder wenigstens ein Ärgernis sein: Gott würfelt vielleicht deshalb nicht, weil es ihn überhaupt nicht gibt. Die Autoren von „Das All!“ klammern diesen Aspekt sorgfältig aus. „Ihr“ Universum funktioniert in der Tat ohne kosmischen Steuermann. Sicherlich macht dies mit den Schrecken aus, der sich in die Faszination mischt: In diesem womöglich tatsächlich unendlichen All könnten das Sonnensystem, die Erde und die Menschen eine Laune der Natur sein – nicht mehr aber auch nicht weniger. Nicht jede/r kann es unter diesen Umständen ertragen, den Blick zum Nachthimmel zu wenden.
Wer es – zumal unterstützt durch die moderne Technik – riskiert, wird freilich belohnt. Für die in diesem Band versammelten Fotos stellt das Prädikat „eindruckvoll“ im Grunde eine Untertreibung dar. Noch erstaunlicher ist das Aufgehen eines Konzepts, das die textlichen Erläuterungen auf ein Minimum begrenzt und die Leser trotzdem umfassend informiert. Der oft beschworene „Mut zur Lücke“ wird hier belohnt, weil beim „Abschmelzen“ des jeweils möglichen Informationsblocks die relevanten Fakten zurückbleiben. Wer meint, dies sei einfach, versuche sich doch einmal an einer Definition von „coronaler Loop“ in vierzig kurzen Zeilen …
„Das All!“ ist in jeder Beziehung kein billiges Vergnügen – das Buch ist kostspielig, sein Inhalt dem Thema jederzeit gewachsen. Bestes Kunstdruckpapier optimiert eine Reise durch das Universum, die wie selten zuvor erschreckt und fasziniert.
John Varley – Der Satellit
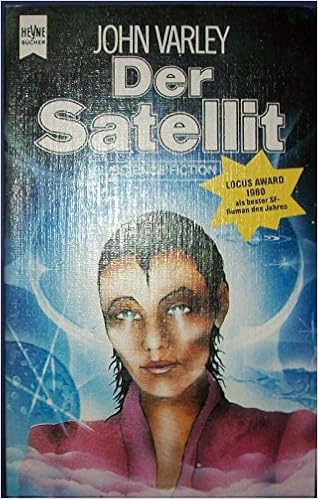
F. Paul Wilson – Tollwütig
Milos Dragovic, Erpresser, Drogenhändler & Mörder, sorgt in New York City für Terror. Das Gesetz ist wie üblich machtlos und kann dem „schlüpfrigen Serben“ seine zahllosen Untaten nicht nachweisen, zu denen sich aktuell die Nötigung der Pharmafirma GEM addiert. Dr. Luc Monnet hat finanzielle Not verlockt, sich mit Dragovic einzulassen, der nun das Sagen in der Chefetage hat.
Gelockt hatte Monnet Dragovic mit einer neuen Designerdroge, die sich unter den Reichen und Schönen der Stadt außerordentlicher Beliebtheit erfreut und folglich famose Gewinne garantiert. Es gibt allerdings ein Problem: Monnet stellt die Droge nicht wirklich her; er verarbeitet einen wahrlich unmenschlichen Lebenssaft, den ein gruseliges Fabelwesen spendet, das in einem heruntergekommenen Wanderzirkus sein Dasein fristet. Aber die Quelle droht zu versiegen, denn das Untier liegt im Sterben. Diese Neuigkeit dürfte bei Dragovic nicht auf Verständnis stoßen. In seiner Not heuert Monnet daher seine geniale Studentin (und Ex-Geliebte) Nadia Radzminsky an, der gelingen soll, woran die GEM-Forscher bisher scheiterten: die künstliche Herstellung der Droge! F. Paul Wilson – Tollwütig weiterlesen
Flannary, Tim – Dschungelpfade. Abenteuerliche Reise durch Papua-Neuguinea
Neuguinea-Pidgin ist eine merkwürdige Kombination aus Englisch und diversen Sprachen der einheimischen Inselbewohner. Aber die Verständigung funktioniert, was ratsam ist in einer Welt, die sich bis vor wenigen Jahren praktisch in jedem isolierten Bergtal neu definierte. „Throwim way leg“ bedeutet: „sich auf eine Reise begeben“. Genau das beherzigte der australische Zoologe Tim Flannery, den in den 1980er Jahren das Fernweh packte. Ihn zog es auf die nach Grönland größte Insel dieses Planeten, wobei über den Eisblock im Norden viel mehr bekannt ist als über die Tropenwelt im Süden. Weiterhin sind große Teile der Insel völlig unentdeckt. Wo gibt es das sonst noch auf diesem Erdball? Ein verlockendes Betätigungsfeld für einen wagemutigen Forscher und Reisenden also. Flannerys launig beschriebenen sieben Reisen führten ihn deshalb direkt auf die Spuren der großen Entdeckungsreisenden der Vergangenheit. Nicht umsonst nennt man ihn den „australischen David Livingston“ (wenn wir dem Klappentext Glauben schenken möchten).
Neuguinea – das wusste Flannery schon – ist zwar geologisch die „Bugwelle“, die der Zwergkontinent Australien auf seiner Drift über das Lavameer unterhalb der Erdschollen aufgeworfen hat, weist aber in seiner Tier- und Pflanzenwelt bemerkenswert wenige Parallelen auf. So leben auf Neuguinea z. B. die Kängurus prinzipiell auf Bäumen – mit Ausnahme der eigentlichen Baumkängurus, denn die leben hartnäckig auf dem festen Boden und unterstreichen eindrucksvoll Flannerys These, dass in diesem seltsamen Winkel alles etwas anders läuft. (Kängurus spielen eine wichtige Rolle in diesem Buch, denn Tim Flannery hat sich auf ihre Biologie spezialisiert; Fledermäuse kann er aber auch gut …)
Seit 45.000 Jahren leben Menschen auf Neuguinea, aber noch in den 1930er Jahren hatten die meisten noch niemals einen weißen Mann gesehen. Das war kein Verlust, wie sich zahlreiche Massaker später herausstellte, aber es hatte gewisse Nachwirkungen, die noch heute Forschungsreisen in abgelegene Regionen nicht ungefährlich macht, zumal Kannibalismus und Kopfjagd auf Neuguinea nicht nur wehmütig erinnerte, sondern durchaus weiterhin praktizierte Gebräuche sind: Die einheimische Bevölkerung kann oft nicht schreiben, aber ihr Gedächtnis ist ausgezeichnet und unendliche Duldsamkeit der kolonialistischen Obrigkeit gegenüber ihr Ding nicht.
Die Entbehrungen, die er auf sich nehmen musste, lesen sich in Flannerys Erinnerung vergnüglich, weil er sich offenbar mit einer Art Crocodile-Dundee-Mentalität ins absolute Abenteuer stürzt. Bei näherer Betrachtung schreckt der couchkartoffelige Durchschnittsleser aber doch schaudernd zurück. Neuguinea wartet nicht nur mit einem meist mörderisch heißen und feuchten Schimmel-Klima, sondern auch mit einer Furcht erregenden Tierwelt auf. Parasiten und giftiges Getümmel gedeiht prächtig hier und schätzt den Menschen gar sehr als Wirt. Was das für Folgen hat, wird von Flannery in drastischen Worten beschrieben. Einige Fotos des Bildteils belegen, dass er nicht untertreibt. (Lerne selbst, was „grile“ ist, liebe/r Leser/in – aber bitte auf eigenes Risiko! Und der Bandwürmer verspeisende Willok gilt selbst unter seinen strapazierfähigen Mitbürgern als Außenseiter.)
Flannery hungert, stinkt und steckt sich mit Krankheiten an, von denen man nicht einmal lesen möchte. Aber er kehrt immer wieder zurück, und man versteht ihn. Neuguinea ist eine fremde und unbarmherzige, aber faszinierende Welt. Inzwischen hat Flannery reichen Lohn empfangen. Er konnte bemerkenswerte Bekanntschaften knüpfen, hat Erfahrungen gemacht, um die man ihn beneiden kann. Aber auch als Wissenschaftler ist ihm Erstaunliches gelungen: Tim Flannery gehört zu denen, die immer wieder völlig unbekannte Tierarten entdecken! Das ist auf Neuguinea noch im 21. Jahrhundert möglich – und wir sprechen hier nicht von Insekten, sondern von ziemlich großen Säugetieren.
Freilich sterben sie oft aus, noch bevor sie richtig entdeckt werden. Trotz seines von angelsächsischem (und robustem) Humor geprägten Schreibstils verschweigt Flannery die eher traurigen Seiten des Urwelt-Lebens auf Neuguinea nie. Sie sind – wen wundert’s – primär von Menschen gemacht. Die Insel ist heute ein zweigeteiltes Land. Der Westen – Irian Jaya – gehört zur Militärdiktatur Indonesien. Papua-Neuguinea im Osten ist selbstständig, aber das bedeutet längst nicht, dass die Ureinwohner über ihre Heimat bestimmen dürfen. In vielen deprimierenden Kapiteln beschreibt Flannery, wie die eigentlichen Bürger der Insel um ihre Rechte betrogen wurden und werden. Gesetzlosigkeit, Krankheit, Hunger, Unterdrückung, Ausbeutung: Neuguinea ist in diesen Punkten ein sehr modernes Land.
Flannery verschweigt noch unangenehmere Wahrheiten nicht. Die bedrängten Ureinwohner sind beileibe keine Engel. Ihr unglaubliches hartes Leben hat sie in Jahrzehntausenden zu einem hoch spezialisierten Menschenschlag werden lassen, dessen Sozialstruktur uns angeblich „zivilisierten“ Erdmenschen äußerst exotisch, ja, grausam anmutet. Aber selbst unter Berücksichtigung der alten Weisheit „Andere Länder, andere Sitten“ und unter großzügig politisch korrekter Auslegung des Selbstbestimmungsrechtes der im Einklang mit Mutter Natur existierenden Ureinwohner lässt sich beim besten Willen nicht leugnen, dass auch diese vor allem – Menschen sind. Flannery entdeckt daher unerfreuliche Wesenszüge auch bei den notorisch über den Tisch gezogenen Inselbewohnern. Sie betrügen einander, sind sich spinnefeind; statt greenpeacige Einigkeit ihren neokolonialistischen Feinden gegenüber zu demonstrieren, lassen sich von alten Naturgöttern keine klügeren Weisheiten vermitteln als von garstig besserwisserischen Missionaren.
Neuguinea ist ganz sicher nicht das verlorene Paradies auf Erden. Auch der eifrige und offene Forscher Flannery muss dies auf die harte Tour lernen – ein schmerzlicher Prozess, der ihm während einer Reise durch den indonesischen Westen ein echtes Trauma bescherte, als er Zeuge wurde, wie die Bediensteten eines Konzerns, der seine aktuelle Expedition finanzierte, rassistisch einen „Wilden“ umbrachten und er sich plötzlich fragen musste, ob er sich mitschuldig an dieser Tat gemacht hatte. Flannery unterschlägt dieses Ereignis und seine womöglich wenig schmeichelhafte Rolle darin nicht. Es hat seiner Liebe zur Insel Neuguinea einen nachhaltigen Dämpfer versetzt.
Flannerys Ehrlichkeit und die lange Kette definitiv berichtenswerter Abenteuer machen „Dschungelpfade“ zum Lektüre-Erlebnis. Rührselig-epiphanisches „Groß ist Mutter Gäa!“-Gestammel bleibt dem Leser erspart. Die eindrucksvollen Farbbilder komplettieren den durchweg positiven Eindruck, den dieses Buch hinterlässt. Dass die Faszination Neuguineas trotzdem aus jeder Zeile spricht – und das überzeugend -, ist die bemerkenswerte Leistung eines klugen Mannes, der sein Wissen teilt statt zu predigen und auf diese Weise einen um so nachhaltigeren Eindruck hinterlässt.
Tim Flannery, geboren 1956 in Canberra, der Hauptstadt Australiens, ist nicht nur Entdeckungsreisender und Feldforscher, sondern „hauptberuflich“ der Direktor des „South Australian Museum“ in Adelaide. Darüber hinaus lehrt er als Professor an der örtlichen Universität. Immer wieder unternimmt er ausgedehnte Forschungsreisen durch die ozeanische Welt. Flannery gilt als bester Kenner der heimischen Säugetierwelt, widmet sich aber auch komplexen ökologischen Studien und macht sich stark für die Tier- und Pflanzenwelt dieser Region, die wie die einheimische Bevölkerung bedroht wird durch den Raubbau der „modernen“ Zivilisation. 18 Bücher hat Flannery veröffentlicht.
Richard Marsh – Der Skarabäus
Das Schicksal hat es wirklich auf ihn abgesehen, denkt Robert Holt, ein zum Landstreicher herabgekommener Londoner Bürger, der in dunkler, kalter Nacht in ein einsam gelegenes Haus einsteigt. Leider steht dies nicht leer; ein unheimliches Wesen haust hier, das kaum Menschenähnlichkeit aufweist und sich womöglich in einen riesigen Skarabäus-Käfer verwandeln kann.
Vor allem ist diese Kreatur abgrundtief böse. Sie hat es auf den jungen Politiker Paul Lessingham abgesehen, der ihr während seines Aufenthalts in Ägypten – über den er sich sorgfältig ausschweigt – nach eigener Auskunft großes Unrecht angetan hat. Bis nach London ist sie Lessingham gefolgt und plant nun sorgfältig dessen politischen Ruin, privaten Untergang und schließlich Tod. Der unglückliche Holt muss ihr als Werkzeug dienen. Mit unwiderstehlicher hypnotischer Kraft wird er gezwungen, in Lessinghams Haus einzubrechen und einige persönliche Briefe zu stehlen, die das Geschöpf über die bevorstehende Verlobung mit der schönen Marjorie Lindon informieren. Richard Marsh – Der Skarabäus weiterlesen
Jacques Futrelle – Der überflüssige Finger
13 Fälle, zwischen 1906 und 1908 gelöst von Professor Van Dusen, der „Denkmaschine“:
– Die silberne Box („The Leak“/“The Silver Box“, 1907), S. 7-29: Ein Unsichtbarer spioniert die Geheimnisse des Börsenhais aus und kostet ihn Millionen. Van Dusen vermutet eher Köpfchen und Technik hinter diesem Rätsel …
– Das Motorboot („The Motor Boat“, 1906), S. 30-53: Ein toter Mann in Uniform braust am Steuer seines Boots in den Hafen von Boston. Nur van Dusen kann klären, was hinter diesem mysteriösen Auftritt steckt …
– Der überflüssige Finger („The Superfluous Finger“, 1906), S. 54-78: Warum lässt sich eine schöne Frau ihren völlig gesunden Finger amputieren? Dahinter verbirgt sich ein schlau eingefädeltes Verbrechen, ahnt van Dusen …
– Der unterbrochene Funktelegraph („The Interrupted Wireless“, 1907), S. 79-102: Auf hoher See stirbt der Funker mit einem Messer im Herzen, doch wer setzt in der Nacht seine Arbeit fort? Van Dusen findet die Erklärung, ohne einen Schritt an Bord zu setzen …
– Die drei Mäntel („The Three Overcoats“, 1907), S. 103-118: Was sucht ein fein gekleideter Meisterboxer und Einbrecher, der die übliche Beute verschmäht und stattdessen Mäntel aufschlitzt? Nur van Dusen fragt sich, was in diesen Mänteln steckte …
– Das Rätsel des zerbrochenen Armreifs („The Problem of the Broken Bracelet“, 1907), S. 119-144: Gleich mehrere Diebe raufen einfallsreich um ein scheinbar wertloses Schmuckstück; nur van Dusen entdeckt, dass es buchstäblich etwas in sich hat …
– Das Rätsel des Kreuzes („The Problem of the Cross Mark“, 1907), S. 145-161: Eine groteske Schauspielerscharade deckt van Dusen als Bestandteil einer tückisch ausgetüftelten Erbschleicherei auf …
– Das Rätsel der Ansichtskarten („The Problem of the Souvenir Cards“, 1907, S. 162-178:
Der Dieb stahl den großen Diamanten und irritiert dessen Eigentümer durch die Einsendung unverständlicher Kartenbotschaften, die für van Dusen natürlich nicht lange ein Geheimnis bleiben …
– Das Rätsel des verschwindenden Mannes („The Problem of the Vanishing Man“, 1907), S. 179-200: Ein Geschäftsmann betritt jeden Morgen sein Büro, um sich dort in Luft aufzulösen und feierabends wieder zu erscheinen; wie so etwas möglich ist, erklärt Professor van Dusen …
– Das Rätsel des Taxis („The Problem of the Auto Cab“, 1907), S. 200-216: Reporter Hatch sieht sich in einen Juwelenraub verwickelt und schätzt sich glücklich, ein Vertrauter der „Denkmaschine“ zu sein …
– Das Rätsel der versteckten Million („The Problem of the Hidden Million“, 1907), S. S. 217-232: Auf dem Totenbett verkündet der boshafte Millionär triumphiernd, wie er seine Schätze vor den Erben versteckt hat, aber er hat die Rechnung ohne seinen Papagei und Professor van Dusen gemacht …
– Das Roswell-Diadem („The Roswell Tiara“, 1906), S. 232-253: Wohin ist das berühmte Schmuckstück verschwunden? Van Dusen löst den Fall buchstäblich im Schlaf …
– Der verhexte Gong („The Haunted Bell“, 1906), S. 254-306: Er dröhnt ohne geschlagen zu werden und kündigt den Tod seines Besitzers an – reiner Humbug, so Augustus van Dusen, der diesen Worten eine spektakuläre Beweisführung folgen lässt …
|“In den Naturwissenschaften müssen wir exakt sein – und zwar nicht annähernd, sondern absolut. Wir müssen wissen. … Wissen ist Fortschritt, Wissen erlangen wir durch Beobachtung und Logik – unwiderlegliche Logik. Und die Logik sagt uns, dass zwei plus zwei vier ergibt, und zwar nicht nur manchmal, sondern immer.“| (S. 9)
Dies ist das Credo von Augustus S. F. X. van Dusen, der sich keinesfalls als Detektiv, sondern ausschließlich als Wissenschaftler versteht. Die oben zitierte Ansprache hält er kaum variiert jedem, den es mit einem „unmöglichen Fall“ oder einem „perfekten Verbrechen“ zu ihm treibt (was zwischen 1905 und 1912 immerhin fünfzigmal geschieht). Van Dusen ist die „Denkmaschine“; noch mehr als Sherlock Holmes beschränkt er sich auf die Ermittlung durch Nachdenken. Er ist der „armchair detective“ par excellence, die kaum mehr körperliche Geisteskraft, welche sich Furcht einflößend bemerkbar macht, wenn van Dusens gewaltige Stirn sich in unzählige Runzeln legt: Die „Denkmaschine“ läuft auf Hochtouren!
Für van Dusen gibt es keine Rätsel, sondern höchstens Fragen, auf die noch keine Antworten gefunden wurden. Er ist auch deshalb meist grämlich, weil er einfach nicht verstehen kann, wieso die Menschen um ihn herum dies einfach nicht begreifen. Immer wieder erläutert er sein Vorgehen, wenn er einen neuen Kriminalfall gelöst hat – es besteht darin, die vorhandenen Fakten zu sammeln, zu sichten und auszuwerten. Die Lösung ergibt sich dann automatisch.
Freilich wird sich van Dusen wohl bis an sein Lebensende ärgern müssen. Die Welt, in der er lebt, ist nur zum Teil die seine. In seinem mit Riesenbibliothek und Labor ausgestattetem Domizil brödelt er eigen vor sich hin. Gäbe es nicht seinen Watson – hier in Gestalt des rasenden Reporters Hutchinson Hatch – würde er wohl gar nicht das Haus verlassen und Wissen allein um des Wissens willen anhäufen: „Ph. D., LL. D., F. R. S., M. D., M. D. S.“ lautet die Liste seiner akademischen Titel, die damit wohl sämtliche Bereiche der Naturwissenschaft abdecken. Hatch ist es, der ihn ins Freie lockt und ihn sich praktisch betätigen lässt. Zwar lässt es sich van Dusen nie anmerken, aber geht man von der Bereitwilligkeit aus, mit welcher er sich stets von Hatch ‚verführen‘ lässt, hat die „Denkmaschine“ offensichtlich ihren Spaß an den sich daraus entwickelnden Abenteuern.
Frauen existieren für van Dusen selbstverständlich nur als wissenschaftlich definierte Wesen. Immerhin erkennt er: „Man kann nicht umhin, die Stärke von Frauen unter gewissen Umständen zu bewundern …“ (S. 65) In der Tat trifft die „Denkmaschine“ verblüffend oft auf Frauen, die kriminell, einfallsreich und skrupellos auftreten und sich zweifellos mit den männlichen Schurken messen können. Jacques Futrelle war in diesem Punkt – und nicht nur in diesem – wesentlich „moderner“ als beispielsweise Arthur Conan Doyle, dessen Sherlock Holmes nur „die eine Frau“ (Irene Adler) als gleichwertige Gegnerin akzeptierte.
Wobei Sherlock Holmes hier mit Absicht genannt wird. Augustus van Dusen verdankt ihm viel; die „Denkmaschine“ ist in gewisser Hinsicht ein – durchaus ironisch – überhöhter Holmes. Wie Doyle spielt Futrelle mit offenen Karten. Auch der verzwickteste Fall wird im Finale aufgedröselt. Es gibt keine Tricks oder doppelte Böden und erst recht keine Zauberei. Van Dusen liegt richtig: Wer die Augen offen hält und seine Indizien korrekt deutet, wird obsiegen. Das ist für ihn so selbstverständlich, dass er den Applaus seiner verblüfften Zeitgenossen ablehnt: Er hat doch nur nach der eigenen Maxime gehandelt und konnte deshalb nicht irren! Aus diesem Grund kann es durchaus vorkommen, dass er einen Fall löst und der Täter unbekannt bleibt: Dessen Identität blieb für die Klärung nebensächlich und interessierte van Dusen deshalb nicht.
Mit der Konstruktion seiner van-Dusen-Storys hat sich Jacques Futrelle große Mühe gegeben. Ihm fällt immer eine Ausgangssituation ein, die den Leser in den Bann zieht, wobei er oft auf eigene Spezialkenntnisse zurückgreift – er war u. a. Telegraphist und setzt diese zeitgenössische „Hightech“ gleich mehrfach in seinen Kriminalgeschichten ein. Einhundert Jahre später funktionieren manche Plots natürlich nicht mehr so gut wie einst. Der Nostalgiefaktor gleicht es aus, zumal Futrelle über einen feinen, trockenen Humor verfügt, der seinen Geschichten sehr gut bekommt. Damit einher geht ein Verzicht auf theatralische Gefühlsüberschwänge. Zwar fällt auch bei Futrelle manche feine Dame in Ohnmacht, wenn der Schreck sie überwältigt, doch nicht selten entpuppt sich das nachträglich als Trick einer gewieften Schurkin.
Während Jacques Futrelle im angelsächsischen Sprachraum längst für Augustus van Dusen als wichtiger und prägender Vertreter des frühen Kriminalromans gewürdigt wird, blieb er in Deutschland lange unbemerkt. Als der Durchbruch dann kam, erfolgte er erstaunlicherweise nicht im Buch, sondern im Radio. Zwischen 1978 und 1999 schreibt der Rundfunk-Journalist und Autor Michael Koser für den RIAS Berlin (ab 1993 DeutschlandRadio Berlin) insgesamt 79 Hörspiele um van Dusen und Hutchinson Hatch, die meist vom Verfasser neu erfunden wurden.
Im Druck ist hierzulande nur knapp die Hälfte der van-Dusen-Storys erschienen. Das Fehlen einer ordentlichen Gesamtausgabe ist sowohl ein Manko für den Freund klassischer Krimi als auch ein Ärgernis, denn hier harrt ein Autor seiner endgültigen Entdecker, der auch heute noch gut unterhalten könnte!
Jacques Heath Futrell wurde 1875 in Pike County im US-Südstaat Georgia als Sohn eines Lehrers geboren. Er wuchs mit vielen Büchern auf, die seine Eltern ihn zu lesen ermunterten. Vielleicht wäre Futrell als Literat ins Berufsleben gestartet, doch seine finanzielle Situation zwang ihn zu einer „vernünftigen“ Planung. Schon in seiner Schulzeit half er in einer Druckerei aus und absolvierte später eine Druckerlehre. Mit 18 Jahren ging Futrell zum „Atlanta Journal“, wo er u. a. die erste Sportseite aus der Taufe hob.
1895 heiratete Futrell Lillie May Peel; das Paar zog nach New York um, wo Jacques als Telegraf für den „New York Herald“ tätig wurde. 1904 rief ihn William Randolph Hearst nach Cambridge, Massachusetts, wo er für dessen neue Zeitung, den „Boston American“, arbeitete. Hier erschienen auch die ersten Kurzgeschichten um Professor Augustus Van Dusen, die „Denkmaschine“. Sein Erfolg als Schriftsteller ermöglichte es Futrelle, sich ab 1906 als hauptberuflicher Schriftsteller zu etablieren; nunmehr blieb ihm auch die Zeit für das Verfassen von Romanen, deren erster noch in diesem Jahr veröffentlicht wurde.
Jacques Futrelle wurde auch auf der anderen Seite des Atlantiks populär. Im Frühjahr 1912 begab er sich mit seiner Gattin May auf eine Reise nach England. Für die Rückfahrt beschlossen die Futrelles sich etwas zu gönnen, zumal sich eine einmalige Gelegenheit bot: Sie buchten eine Passage auf dem größten und prächtigsten Passagierschiff ihrer Zeit, der brandneuen und unsinkbaren „Titanic“ …
Das Drama im Nordatlantik überlebte in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 nur May; ihr Ehemann versank in den Fluten, seine Leiche wurde niemals gefunden. Als Schöpfer der „Denkmaschine“ ging Futrelle in die Geschichte des Kriminalromans ein und gehört zu jenen frühen Vertretern, die das Genre formten und ihm entscheidende Impulse gaben.
(Über Jacques Futrelle informiert die Website www.futrelle.com. Sehr informativ ist die deutsche Site www.profvandusen.com/fut2.htm geraten, die sich außerdem mit der deutschen Hörspielserie um Van Dusen beschäftigt.)
Simon Beckett – Die Chemie des Todes
Einst war er einer der führenden forensischen Mediziner Englands: David Hunter hat sie alle übertroffen, wenn es galt, einem modernden Mordkadaver die Geheimnisse seines Todes zu entlocken. Dann kam seine Familie durch einen Unfall um, was Hunter beruflich und privat aus dem Gleis warf. Er floh aus der Großstadt und zog als einfacher Landarzt in dem kleinen Dorf Manham in der englischen Grafschaft Norfolk.
Die Tage des selbst gewählten Exils gehen zu Ende, als in einem Wäldchen die übel zugerichtete Leiche von Sally Palmer gefunden wird: traktiert mit scharfen Messern und mit Schwanenflügeln dort, wo eigentlich nur Schulterblätter sein sollten. Chief Inspector Mackenzie findet wenige Spuren aber David Hunter, der ihn bei seinen Ermittlungen unterstützen soll. Als dieser sich weigert, traktiert ihn der mürrische Polizist so lange, bis Hunter nachgibt.
Den Ausschlag dafür gibt das Verschwinden von Lyn Metcalf. Nicht nur Mackenzie fürchtet, dass der unbekannte Mörder die junge Frau in seine Gewalt gebracht hat. Ein Wettlauf auf Leben und Tod beginnt. Die Suche im dichten Wald um Manham ist gefährlich, denn der Kidnapper hat überall Schlingen aus- und Fallgruben angelegt. Im Dorf schwingt sich der fanatische Law-and-Order-Pfarrer Scarsdale zum Sprecher der Furchtsamen und Misstrauischen auf. Eine Bürgerwehr wird aufgestellt, die mehr Schaden anrichtet als zu schützen.
Für Dorffremde und Außenseiter wird das Leben in Manham ungemütlich, denn die braven Bürger suchen Sündenböcke. Alte Rechnungen werden bei dieser Gelegenheit gleich mit beglichen. Auch Hunter kommt ins Gerede, hält aber aus: Der Mörder hat sich ausgerechnet seine neue Freundin geschnappt, welcher das bekannte Ende droht, wenn es nicht endlich gelingt, die kärglichen Beweise so zu deuten, dass dem Täter Einhalt geboten werden kann …
Schon wieder der beste Thriller?
„Die Chemie des Todes“ ist als Roman nicht so interessant wie der Konflikt, der sich in der Kritik um ihn entzündet hat. Der nüchterne Tatbestand ist für den erfahrenen Krimileser rasch klar: Dies ist ein solider Thriller um bizarre Serienmorde und unterhaltsam dargebotene Ermittlungstechniken, der – verschnitten mit dem üblichen Quantum Seifenoper – dem Genre weder nützt noch schadet.
Ruhig und bei langsamem Aufbau der Spannung erzählt Autor Beckett eine Story, wie sie die Liebhaber klassischer britischer Krimis normalerweise lieben und die in jedem Jahr zu Dutzenden – meist als Taschenbuch mit gesichtslosem Bildstock-Einheitscover – auf den Buchmarkt geworfen werden.
Den Unterschied macht offensichtlich das Getöse der Werbetrommeln, die für „Die Chemie des Todes“ gerührt wurden. Längst sind bei den Verlagen sämtliche Hemmungen gefallen, noch der übelste Mist wird nicht nur gedruckt, sondern auch in Superlativen angepriesen. Man fällt als Leser darauf herein und ist verstimmt. Trotzdem ist es ungerecht, dass ausgerechnet der arme Simon Beckett die Zeche zahlen soll.
Der Tod kann sehr lebendig sein
Zur Klage gibt es selbstverständlich Anlass. Wieso wählt der Autor als Hauptfigur einen forensischen Anthropologen, wenn er für die Handlung recht wenig Kapital daraus schlägt? Oder sind wir Leser alle bereits so CSI- & Scarpetta-geschädigt, dass wir ohne Seziersaalbabbel und labortechnischen Overkill etwas vermissen? Beckett lässt Hunters Beruf sehr wohl in die Handlung einfließen: angenehm zurückhaltend allerdings und primär dort, wo seine Erkenntnisse zur Geschichte beitragen, wie der Verfasser entschied sie zu erzählen.
Dazu gehört auch der gemächliche Einstieg ins kriminalistische Geschehen. „Die Chemie des Todes“ ist einerseits kein Actionthriller und andererseits Auftakt zu einer Serie mit David-Hunter-Romanen. So nimmt sich Beckett die Zeit diese Figur und ihre von tiefen inneren Konflikten geprägte Geschichte sorgfältig aufzubauen bzw. zu erzählen, während sich der kriminalistische Handlungsstrang erst nach und nach in den Vordergrund schiebt. Selbstverständlich gehört die vorsichtige Annäherung ans weibliche Geschlecht zu Hunters Gesundungsprozess, und natürlich ist es das Objekt seiner neu erwachten Begierde, das dem Mörder in die Finger gerät: „Die Chemie des Todes“ ist wie schon angedeutet ein konventionell geplotteter Thriller.
David Hunter trägt zwar einen sprechenden Namen, benimmt sich jedoch ganz und gar nicht wie ein Jäger. Beckett schildert ihn als gebrochenen Mann, der nach einer persönlichen Tragödie aus seinem psychisch anstrengenden Job als Gerichtsmediziner aussteigt und in der Stille der Provinz einen Neuanfang versucht. Die damit verbundenen Schwierigkeiten schildert der Verfasser überzeugend aber ohne das Seelendrama neu zu erfinden.
Todes-Experte kehrt ins Leben zurück
Hunter ist kein Sherlock Holmes des 21. Jahrhunderts, der sich eifrig über faulige Leichen beugt, um sie unter Präsentation angenehm ekliger Überraschungen zu ‚lesen‘, sondern ein verstörter und störrischer Zeitgenosse, der sich zudem gegen die Rolle des zentralen Handlungsträgers sträubt. Tatsächlich wehrt er sich gegen alles, das den mühsam geschaffenen Panzer aus Routine und Gleichgültigkeit zerbrechen könnte. Eine blitzartige Wiedergeburt als spürgewaltiger Schnüffel-Forensiker wäre deshalb reichlich unglaubwürdig.
Beckett mag kein Neuerer sein aber er bemüht sich wenigstens, allzu ausgefahrene Geleise zu vermeiden. Sein Manham ist kein Sammelbecken ulkig-wirrer Dorftypen oder -trottel, die in so vielen „Whodunits“ den Hintergrundchor abgeben müssen. Das Verderben kommt über eine Gemeinde, der Harmonie stets ein Fremdwort war. In der Krise bildet sich keine Gemeinschaft; stattdessen bilden sich Gruppen, die einander argwöhnisch belauern und höchstens in ihrer Hatz auf verdächtige Außenseiter einig sind: Selbst die Bürger von Manham unterliegen im 21. Jahrhundert dem alten Irrglauben, dass auf dem Land Frieden dort herrscht, wo in der Stadt das Böse regiert.
Pfarrer Scarsdale ist das Sprachrohr für die gleichzeitig Ängstlichen und Aggressiven. Leider ist diese Figur Beckett zum Zerrbild missglückt. Er wirkt wie ein frühneuzeitlicher Hexenjäger, der im Namen des HERRN seinen persönlichen religiösen Fundamentalismus nährt. Selbst in der Provinz dürfte es indes kaum mehr möglich sein ‚normale‘ Menschen auf diese Weise in einen hysterischen Lynchmob zu verwandeln. Beckett merkt es selbst und lässt diesen Handlungsstrang unauffällig versanden.
Der Mörder muss einer der Manham-Bewohner sein – so verlangt es die Regel. Wer es sein könnte, dämmert dem Leser eventuell ein wenig zu früh; Beckett verteilt in dieser Hinsicht großzügig Hiebe mit dem Zaunpfahl. Ansonsten hält sich der Verfasser auch hier an die Konventionen, die einen Irrsinnigen fordern, der rasch und gnadenlos killt und erst im Finale vom Drang erfasst wird, sich dem Helden in einem wahren Redeschwall zu offenbaren. Kein Wunder, dass es so mit dem perfekten Mord nichts wird. Wiederum gilt freilich: Beckett mutet seinem Publikum nichts Schlimmeres zu, als es bereits gewöhnt ist. Wer sich ohne große Vorab-Erwartungen an die Lektüre begibt und die Dreist-Werbung ignoriert, wird durchaus seinen Lese-Spaß finden.
Autor
Simon Beckett (geb. 1968) versuchte sich nach Abschluss eines Englischstudiums als Immobilienhändler, lehrte Spanisch und war Schlagzeuger. 1992 wurde er freier Journalist und schrieb für bedeutende britische Zeitungen wie „Times“, „Daily Telegraph“ oder „Observer“. Im Laufe seiner journalistischen Arbeit spezialisierte Beckett sich auf kriminalistische Themen. Als Romanautor trat Beckett zuerst 1994 an die Öffentlichkeit, doch deren breite Aufmerksamkeit fand er erst mit den Romanen um den Forensiker David Hunter (ab 2006). Allerdings wurde Beckett bereits für „Animals“ (1995, dt. „Tiere“) mit einem „Raymond Chandler Society’s Marlowe Award“ für den besten internationalen Kriminalroman ausgezeichnet.
Mit seiner Familie lebt Simon Beckett in Sheffield. Über sein Werk informiert er auf dieser Website. Interessant ist, dass er seine vier zwischen 1994 und 1998 veröffentlichten (und inzwischen auch in Deutschland erschienenen) Romane unerwähnt lässt.
Taschenbuch: 431 Seiten
Originaltitel: The Chemistry of Death (London : Bantam Press 2006)
Übersetzung: Andree Hesse
http://www.rowohlt.de
eBook: 530 KB
http://www.rowohlt.de
Der Autor vergibt: 



Jörg Kleudgen – Cosmogenesis
Europäische Händler und Flüchtlinge – unter ihnen viele deutscher Herkunft – gründeten Mitte des 17. Jahrhunderts an der Ostküste Indiens in Sichtweite des Himalaja-Gebirges die Stadt Cathay. Von Anfang an war der Ort verflucht. Die Siedler haben angeblich einen dämonenbeseelten Götzen mitgebracht haben. Außerdem verärgerten sie einen ortsansässigen Zaubermeister, der die Stadt daraufhin mit einem Fluch belegte.
Tiefe Dschungel und schroffe Berge umgeben die Stadt. Der Standort ist sumpfig, das Klima feucht, die Kanalisation marode, sodass immer wieder Seuchen die Bürger heimsuchen. Schon lange liegt der Handel brach. Cathay verfällt, viele Häuser stehen leer. Dekadenz greift um sich, Melancholie liegt über den vernachlässigten Straßen. Seltsame Kulte treiben ihr Unwesen, noch seltsamere Wesen streifen oft mordend durch die Nacht. Jörg Kleudgen – Cosmogenesis weiterlesen
Daniel Stashower – Sherlock Holmes und der Fall Houdini
Im April des Jahres 1910 steht das britische Empire auf dem Gipfel seiner Macht. Doch die Regierung weiß um die anstehenden Umwälzungen, die vor allem das aufstrebende Deutsche Reich unter Kaiser Wilhelm II. in den Kreis der Weltmächte drängen lassen. Diplomaten und Spione geben sich im Parlament und bei Hofe die Klinke in die Hand. Zu allem Überfluss lässt der fragile Gesundheitszustand des Königs sein rasches Ende erwarten. Seinem Sohn ist Edward leider nur als Weiberheld ein Vorbild gewesen. Kronprinz George konnte sich keinen unpassenderen Zeitpunkt für seine Liason mit der deutschen Gräfin Valenka aussuchen. Er hat ihr allerlei Briefe geschrieben, die ihn, den baldigen König George V., zu kompromittieren drohen.
Denn man hat sie gestohlen – aus dem hermetisch verschlossenen Tresorraum von Gairstone House, einem Landsitz der Regierung außerhalb Londons! Für Scotland Yard, hier vertreten durch Inspektor Lestrade, steht der Täter fest: Im Savoy-Theater tritt der Illusionist Harry Houdini auf, der als Ausländer ohnehin verdächtig ist sowie sich als Entfesselungskünster weltweit einen Namen gemacht hat. Indizien lassen auf eine Täterschaft des Künstlers schließen. Also setzt Lestrade Houdini fest. Glücklicherweise hat dessen Gattin Beatrice kurz zuvor den bekannten Detektiv Sherlock Holmes engagiert. Daniel Stashower – Sherlock Holmes und der Fall Houdini weiterlesen
Fritz Leiber – Der unheilige Gral (Die Abenteuer von Fafhrd und dem Grauen Mausling 1)

Fritz Leiber – Der unheilige Gral (Die Abenteuer von Fafhrd und dem Grauen Mausling 1) weiterlesen
John Sandford – Kalter Schlaf
Lucas Davenport, Ermittler in der Abteilung Öffentliche Sicherheit im Stab des Gouverneurs von Minnesota, wird gerufen, wenn sich ein Verbrechen ereignet, das sich nicht ins übliche kriminalistische Raster fügt. Der Mord an dem Russen Oleschew in der Stadt Duluth fällt in diese Kategorie, hat man ihn doch mit einer Waffe erschossen, die mehr als ein halbes Jahrhundert alt sein muss.
Hektik bricht aus, als sich herausstellt, dass der Ermordete der Sohn eines einflussreichen Geschäftsmanns ist, der es im neuen Russland zu Macht und Geld sowie besten Verbindungen zur Regierung gebracht hat. Außerdem werden ihm Verbindungen zur russischen Mafia nachgesagt. Der zornige Vater fordert Aufklärung, aus Russland schickt man die „Ermittlerin“ Nadeschda Kalin. Das ruft den US-Geheimdienst auf den Plan, der nicht ohne Grund vermutet, dass Kalin zur ‚Konkurrenz‘ gehört und mehr weiß als sie verlauten lässt. John Sandford – Kalter Schlaf weiterlesen
Jonathan Latimer – Rote Gardenien
Ein neuer Fall für William Crane, der in der Detektivagentur des knurrigen Colonel Black arbeitet. Der Industriemagnat Simeon March will den mysteriösen Tod seines Sohnes aufgeklärt wissen. John March wurde tot in der Garage gefunden, erstickt an den Abgasen seines Wagens, den er angeblich reparieren wollte. Leichtsinn, meint die Polizei, die nicht irritiert, das auch Johns Cousin Richard einem ähnlichen ‚Unfall‘ zum Opfer fiel.
Simeon March scheut den Skandal, den ein Mord in der Familie bedeuten würde. Er verdächtigt Carmel, seine Schwiegertochter, die mit John keine gute Ehe geführt hat. Auch mit Richard war sie sehr vertraut, und jetzt zieht sie die Aufmerksamkeit von Peter, dem jüngeren March-Sohn, auf sich. Zu denken gibt March sr. auch, dass über den Leichen von Richard und John deutlich der Duft von Gardenien schwebte, die in Carmels Lieblingsparfüm reichlich Verwendung finden. Jonathan Latimer – Rote Gardenien weiterlesen
Frenz, Lothar – Riesenkraken und Tigerwölfe. Auf der Spur mysteriöser Tiere
Auf die Spur mysteriöser Tiere begeben sich Autor und Leser dieses Bandes, der sich binnen weniger Seiten als echte Überraschung und Kleinod des deutschen Sachbuch-Marktes entpuppt. Dabei scheinen sich hier zunächst nur die üblichen Verdächtigen zu tummeln: Nessie, Bigfoot & Yeti und – die Königsfrage für Kryptozoologen (1) in der Endrunde von „Wer wird Millionär?“ – Mokéle-mbêmbe, der trompetende Miniatur-Brontosaurus im Tele-See (!) des düsteren Kongo-Dschungels.
Dort, wo solche Fabelwesen schnauben, sind auch die Fliegenden Untertassen niemals fern. Die hartnäckige Weigerung der UFO-Jünger, regelmäßig die ihnen verschriebenen Medikamente einzunehmen, sichert zwar allerlei über- und außerirdischen Kreaturen ihre Präsenz auf den „Lone Gunmen“-Websites dieser Welt („Elvis & Bigfoot rocken auf Alpha Centauri“), lässt aber den neugierigen Durchschnittsbürger vor der Kryptozoologie eher zurückschrecken.
Glücklicherweise gehört Lothar Frenz eindeutig zu jenen Vertretern dieser Zunft, deren Kopf sich dort befindet, wo er hingehört: auf seinen Schultern nämlich, statt irgendwo haltlos im esoterischen Gewaber zu treiben. So gibt es statt mystischen Gefasels Fakten oder gut begründete Thesen, die dort, wo es sich der Sache wegen ziemt, mit der nötigen Vorsicht präsentiert werden.
Überhaupt ist Frenz‘ Ansatz ein anderer als der, den der Titel zunächst suggeriert: Dem Autoren geht es nicht um die Sensation um jeden Preis; damit kann er ohnehin nicht dienen: Was bisher verschwunden blieb, taucht auch nach der Lektüre der „Riesenkraken und Tigerwölfe“ nicht auf. Aber das ist völlig unwichtig, denn gar zu rasch und fest hängt der Leser am Kanthaken, wenn Frenz damit beginnt, von ’neuen‘ Tieren zu erzählen, die immer und überall auf dieser Welt gefunden werden, die doch angeblich längst bis in den letzten Winkel vermessen, untersucht und zu allem Überfluss aus dem Weltall unter ständiger Beobachtung gehalten wird.
Doch entscheidend ist, was man mit seinen Daten anfängt. Mit Hilfe moderner Satelliten ist es zwar möglich, ahnungslose Zeitgenossen zu überraschen, die sie sich in Moskau auf dem Roten Platz in der Nase bohren. Dennoch könnte es durchaus möglich sein, dass großfüßige Affenmenschen in der nordamerikanischen Provinz direkt neben McDonalds-Filialen hausen: Es hat sie dort halt noch nie jemand wirklich intensiv gesucht!
Erstaunlich ist es schon: Unbekannte Kreaturen verbergen sich nicht zwangsläufig in tiefen Höhlen, auf arktischen Hochplateaus oder 20.000 Meilen unter dem Meer, sondern häufig direkt um die Ecke. Wer hätte beispielsweise damit gerechnet, dass ausgerechnet Mallorca die Heimat einer Krötenart ist, von der bis 1980 kein Mensch jemals gehört hatte? Ganze Legionen hirntoter Ballermänner haben jahrelang praktisch zu Häupten der kostbaren Lurche ahnungslos Sangria aus Plastikeimern in sich hineingeschüttet!
Der Gedanke hat etwas Tröstliches: Wir Menschen kommen mit dem Ausrotten der alten Arten kaum nach, so schnell entdecken unsere fleißigen Wissenschaftler Nachschub … Fast noch interessanter ist die Regelmäßigkeit, mit der die Forscher Tiere, die sie längst kennen gelernt haben, wieder ‚verlieren‘, bis sie Jahrzehnte später erneut ‚entdeckt‘ werden. Wie Frenz nachweist, kann sich dieses Spiel durchaus mehrfach wiederholen. Seltsam auch, mit welcher Hartnäckigkeit sich angeblich ausgestorbene Wesen zurückmelden. Irgendwie scheinen sie alle ein Eckchen zu finden, in das sie sich flüchten und verschnaufen können, die Quastenflosser, Seychellen-Riesenschildkröten oder Kongopfauen dieser Erde, bis sie erneut das Licht der Öffentlichkeit suchen. Und den wohl endgültig Dahingeschiedenen wie dem Moa, dem Beutelwolf oder dem Zwergelefanten diverser Mittelmeerinseln (gab es tatsächlich!) verhilft immerhin das kollektive schlechte Gewissen ihrer menschlichen Meuchler zu einem geisterhaften Nachleben, wie Frenz ebenso überzeugend wie kurzweilig deutlich macht.
Überhaupt tut es gut, ein Buch zu lesen, das diesen Titel schon rein formal für sich beanspruchen kann! Dieser Stoßseufzer ist im Zeitalter des E-Books und der Kleinstverlage, die wirklich jedem Mist zumindest die Gestalt eines Buches verleihen, sofern dafür nur bezahlt wird, durchaus angebracht. Lothar Frenz ist Naturwissenschaftler (sogar ein studierter) und Journalist (dito); für „Riesenkraken und Tigerwölfe“ erweist sich das als ideale Mischung. Ob sich sein Werk deshalb so flüssig liest, weil er regelmäßig Drehbücher für die ZDF-Kinder-Dokumentar-Filmreihe „Löwenzahn“ verfasst, sei an dieser Stelle einmal dahingestellt. Auf jeden Fall versteht Frenz sein Handwerk; die Biografie nennt zwei weitere Buchveröffentlichungen zu den Themen Störche bzw. Sterbehilfe; größer kann die thematische Bandbreite eines Wissenschaftsjournalisten eigentlich nicht sein …
Anlass zur Kritik geben höchstens die Illustrationen: Uralte Kupferstiche, Zeichnungen aus Urvater Brehms „Thierleben“ und Schwarzweiß-Fotos in miserabler Wiedergabe-Qualität, nicht selten digital-dilettantisch aus der Vorlage ‚ausgestanzt‘, ohne Hintergrund jeglichen Aussagewertes beraubt und lieblos irgendwo in den Text montiert, lassen zumindest in der Gestaltung den Verdacht aufkommen, der Verlag habe das Manuskript von einem an Selbstüberschätzung leidenden, autodidaktisch ‚ausgebildeten‘ (und billigen) Grafiker am heimischen PC in Form bringen lassen. Sparsamkeit hin, Preiskalkulation her: So geht es jedenfalls nicht!
Damit ist es aber auch schon genug der Kritik an einem Sachbuch, das kundig und unterhaltsam, nicht mit wissenschaftlichem Anspruch (doch diesen auch gar nicht erhebend), sondern neugierig und ohne den in Deutschland stets präsenten erhobenen Zeigefinger in sein Thema einführt: kein Wunder, dass sich eine renommierte Naturwissenschaftlerin wie Jane Goodall nicht nur als Kryptozoologin ‚outet‘, sondern auch gern dazu bereit erklärte, „Riesenkraken und Tigerwölfe“ durch ein Vorwort zu adeln – nicht, dass dieses Buch darauf angewiesen wäre!
Anmerkung:
(1) Die „Krytozoologie“ – übrigens kein ‚offizieller‘ i. S. von anerkannter Zweig der Naturwissenschaften – widmet sich dem Studium von (d. h. in der Realität primär der Suche nach) Lebewesen, auf deren Existenz zwar Spuren hindeuten, ohne dass diese letztlich jedoch (bisher) bewiesen werden konnte.
Crowe, Cameron – Hat es Spaß gemacht, Mr. Wilder?
Während einige wenige Schauspielerinnen und Schauspieler aus Hollywoods „Goldenem Zeitalter“, das Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre endete, noch unter uns Normalsterblichen weilen, sind die Regisseure jener Ära, die ihnen einen guten Teil ihres Glanzes verdankt, längst in den Zelluloid-Himmel eingegangen. Billy Wilder, geboren 1906 in einem vergessenen Flecken irgendwo in der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, einer der größten Drehbuchautoren und Filmemacher überhaupt, hat sie alle überlebt! Zwar ließ ihn Hollywood seit 1981 keine Filme mehr drehen, doch der bärbeißige Meister hat den Kontakt zur Kinowelt niemals abreißen lassen. Bis kurz vor seinem Tod im biblischen Alter von 96 Jahren behielt Wilder am berühmten Hollywood-Boulevard ein eigenes Büro, in dem er sich als sein eigener Nachlassverwalter die Zeit vertrieb und voller Groll auf die Rechenschieber und Bilanzenreiter schimpfte, die seiner Karriere ein unrühmliches und vorzeitiges Ende bereitet hatten.
Seit Mitte der 1920er Jahre war Wilder im Filmgeschäft; zunächst in Deutschland, dann nach 1933 – Wilder war Jude – für kurze Zeit in Frankreich und schließlich in den Vereinigten Staaten, wo er zunächst als Drehbuchautor und dann als Regisseur über vier Jahrzehnte Filmgeschichte schrieb. Die Liste seiner Klassiker ist eindrucksvoll: „Das verflixte 7te Jahr“ gehört ebenso dazu wie „Manche mögen’s heiß“, „Das verlorene Wochenende“, „Das Appartement“ oder „Irma la Duce“.
Dass dieser Mann über das Filmemachen eine ganze Menge weiß, liegt auf der Hand. Es war hoch an der Zeit, dieses Wissen zu dokumentieren. Wilder wollte biografisch nie zur Feder greifen; er habe nie etwas geschrieben, für das man ihn nicht im Voraus bezahlt habe, ließ er verlautbaren. Leider ist unter der Knute der globalisierten Ignoranten die Ehrung der alten Meister aus der Mode gekommen. Wilder war – nicht zuletzt aufgrund seiner niemals verwundenen Kaltstellung – in seinen späten Jahren zudem ein schwieriger Interviewpartner. Zur Bitterkeit gesellte sich ein guter Teil Altersstarrsinn. Dumme Fragen – oder was er dafür hielt – reizten ihn und fehlende Fachkenntnis bei seinem Gegenüber weckten seinen ausgeprägten Sinn für Sarkasmus.
Unter solchen Voraussetzungen war es naturgemäß denkbar schwierig, Wilder als Interviewpartner zu gewinnen. Cameron Crowe unternahm in der zweiten Hälfte der 90er Jahre den schwierigen Versuch. Auch er schien rasch zum Scheitern verurteilt zu sein, doch dann setzte sich Wilders Neugier durch: Crowes Werdegang wies erstaunliche Parallelen zur eigenen Karriere auf. In den frühen 1920er Jahren begann Wilder (damals noch „Billie“) als Reporter (der fragwürdige Gipfelpunkt dieser „Karriere“ bestand darin, vom interviewunwilligen Sigmund Freud höchstpersönlich vor die Tür gesetzt zu werden …). Crowe war in dieser Hinsicht als Journalist und Mitherausgeber des renommierten „Rolling Stone“-Magazins ungleich erfolgreicher, bevor er sich nach Hollywood begab und sich dort wie Wilder an der seltenen Kombination Drehbuchautor/Regisseur versuchte – mit durchschlagendem Erfolg: Crowes dritter Film – „Jerry Maguire“ mit Tom Cruise – entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Filme der 90er Jahre und sicherte seinem Schöpfer gleich zwei „Oscars“.
Billy Wilder konnte beruhigt sein: Hier bemühte sich ein „Ebenbürtiger“ um seine Aufmerksamkeit. 1995 begann Crowe mit seinen Interviews, die sich aufgrund der Eigenwilligkeiten des Befragten zunächst mühsam anließen. Doch je besser sich Crowe und Wilder kennen lernten, desto besser kamen sie in den drei Jahren, über die sich das Projekt schließlich (mit großen Pausen) hinziehen sollte, miteinander zurecht. Crowes orientierte sich grob an einem berühmten und bewährten Konzept: Dreißig Jahre zuvor hatte der Regisseur und Filmhistoriker François Truffaut den großen Alfred Hitchcock befragt. Dies geschah im Rahmen einer längeren Reihe ausführlicher Interviews, die zum ersten Mal einen einzigartigen Einblick in das Werk und das Leben des vom Publikum geschätzten, von der Kritik aber bisher weitgehend unbeachteten Meisters der Suspense ermöglichten. Den roten Faden bildeten die Filme, die lückenlos ange- und besprochen wurden.
Genauso gingen nun Crowe und Billy Wilder vor, was Letzteren nicht immer begeisterte, gibt es doch in seiner Filmografie Werke und in seinem Leben Vorfälle, über die er zu gern den Mantel des Vergessens breiten wollte. Zudem war Wilder ein Meister der Finte und des Ausweichens. Festnageln konnte man ihn nur schwer. Doch bei aller gebotenen Ehrfurcht ließ Crowe nicht locker. Noch größeres Vergnügen als die hochinteressanten filmhistorischen Informationen bereitet die Beobachtung der rhetorischen Scharmützel, die er und sein Wild(er) sich lieferten, denn Crowe beschreibt immer wieder, wo und unter welchen Umständen er sich mit Wilder traf und was sich dabei jenseits des Aufnahmemikrofons ereignete. Über die späten Jahre prominenter Männer und Frauen zeigen sich die Quellen oft ziemlich schweigsam. Das ist auch verständlich, denn im Alter verlieren sie mit ihrer Kraft gewöhnlich das, was sie für ihr Publikum so faszinierend machte. Doch Wilder war zum Zeitpunkt der Crowe-Interviews zwar alt, nicht mehr gesund und oft melancholisch, doch geistig völlig auf der Höhe und von daher eine Persönlichkeit, die der Welt etwas zu sagen hatte.
„Conversations with Wilder“, wie der vorliegende Band im Original viel schöner und auch treffender betitelt wurde, ist nicht nur bis zum Rand angefüllt mit klugen Anmerkungen zur Filmgeschichte und zahllosen Anekdoten über die Schauspieler/innen, Studiochefs, Kameramänner und Autoren, mit denen (oder gegen die) Wilder im Laufe seiner langen Karriere gearbeitet hat. Der großformatige Band prunkt außerdem mit einer Unzahl begleitender Schwarzweißfotos. Doch hier muss die einzige echte Kritik ansetzen: Für den modischen, aber für eine Dokumentation ungeeigneten „Sechzigerjahre-Retro-Schick“ mit seinen direkt vom Fernsehbildschirm abgenommenen und folgerichtig konturschwachen und verschwommenen Filmbildern opfert Crowe die klare Linie seiner ansonsten über die gesamte Distanz unterhaltsamen Quasi-Werkschau und -Biografie. Bei einem Buch, das ziemlich teuer verkauft wurde, hält sich das Verständnis für pseudo-künstlerische Stückchen dieser Art in Grenzen! Das ist aber auch der einzige Einwand, der sich gegen Crowes meisterhafte Darstellung erheben lässt, die dem Bücherschrank jedes Filmliebhabers zur Zierde gereichen wird.
Venables, Stephen – Everest. Die Geschichte seiner Erkundung
Ein halbes Jahrhundert ist seit der Erstbesteigung des Mount Everest am 29. Mai 1953 verstrichen. Die ehrwürdige Royal Geographical Society zu London nahm dies 2003 zum Anlass, ihr berühmtes Bildarchiv zu öffnen. Mehr als 20.000 oft noch niemals publizierter Fotos werden hier aufbewahrt, von denen ca. 400 Eingang in dieses Buch fanden, um die Geschichte der von der Gesellschaft geförderten Everest-Expeditionen zwischen 1921 und 1953 zu illustrieren.
„Vorwort“ (Sir Edmund Hillary), S. 8-10: Der Mann, der 1953 den Mount Everest mit Tenzing Norgay als Erster erklommen hat, leitet mit einer kurzen Erinnerung an dieses Ereignis das Buch ein. Eine „Grußbotschaft des Dalai Lama“ (S. 11) erinnert daran, dass Tibet nicht nur der Standort des höchsten Gipfels der Erde, sondern auch die Heimat eines Volkes ist, das seit fünf Jahrzehnten systematisch von den chinesischen Kommunisten unterdrückt wird. Der Dalai Lama merkt weiterhin an, dass die Menschen im Himalaja die Berge als Wohnsitz der Götter achten und nicht als alpinistische Herausforderung betrachten.
„Die Fotografien“ (Joanna Wright), S. 12-18: Die Kuratorin für Fotografie der Royal Geographical Society erläutert das Besondere dieses Buchprojekts: Seit jeher fordert die Gesellschaft von den Expeditionen, die sie unterstützt, Berichte, Karten und Bilder. Über die Jahrzehnte – die RGS existiert seit 1830 – hat sich vor allem seit der Erfindung der Fotografie ein bemerkenswerter Quellenbestand angesammelt, der unschätzbaren wissenschaftlichen Wert gewonnen hat, weil er – so wie die in diesem Band gezeigten Fotos aus Tibet und Nepal – Welten fixiert, die längst versunken sind. Gleichzeitig fügt es sich, dass immer wieder begnadete Fotografen in die Wildnis gezogen sind, wo ihnen mit den schwerfälligen Apparaten ihrer Zeit erstaunliche Aufnahmen gelangen.
„Der Höchste Berg der Erde“, S. 19-38: Den Mount Everest hat es schon vor seiner „Entdeckung“ durch Reisende und Bergsteiger gegeben. John Keay fasst die lange, leider nur bruchstückhaft überlieferte „Vorgeschichte“ des Monumentalgipfels zusammen und beschreibt, wie dieser allmählich ins Visier der englischen Kolonialmacht, der Forschung und schließlich der Bergsteiger geriet. Im Kapitel „Chomolungma: Wohnsitz der Götter“ (S. 39-70) versucht Ed Douglas zu erklären, was die Gipfel des Himalaja der einheimischen Bevölkerung bedeuten. Er liefert eine behutsam vereinfachte Einführung in die buddhistische Glaubenslehre bzw. Götterwelt, von der prominente Mitglieder auf besagten Bergspitzen thronen und von ihren Gläubigen nicht gestört werden möchten.
„Der lange Aufstieg 1921-53“ (Stephen Venables), S. 71-198: Drei Jahrzehnte dauerte der Sturm auf den Gipfel des Everest, an dem natürlich nicht nur Briten teilnahmen. Der Verfasser beschäftigt sich mit jeder Expedition, wobei er sich verständlicherweise auf die verhängnisvollen Versuche der 1920er Jahre, den Mythos George Mallory sowie den in Etappen errungenen Erfolg nach dem II. Weltkrieg konzentriert.
„Die Sherpa: Tiger im Schnee“, S. 199-218: Ohne sie läuft nichts im Himalaja – die Sherpas mauserten sich vom reinen Gepäckschleppern für weiße „Sahibs“ zu gleichberechtigten Bergkameraden, von denen einer sogar zu den Erstbesteigern des Everest gehört. Tashi Tenzing, Enkel des legendären Norgay Tenzing, und seine Ehefrau Judy erzählen die Geschichte der zähen Bergbewohner, die eine seltsame Gunst des Schicksals vor einem Dasein als ausgebeutetes Drittweltvolk bewahrte.
„Die ewige Herausforderung“ (Stephen Venables im Gespräch mit Reinhold Messner), S. 219-243: Selbstverständlich endet die Geschichte des Everest-Alpinismus’ nicht mit der Erstbesteigung des Gipfels. In den Jahrzehnten nach 1953 suchten und fanden zahlreiche Bergsteiger weitere Herausforderungen am höchsten Berg der Erde. Sie erschlossen neue Routen, erstürmten den Gipfel im Alleingang, im Winter, blind, mit Holzbein, ohne künstliche Sauerstoffzufuhr, fuhren auf Skiern oder auf dem Snowboard ab, flogen mit dem Drachengleiter zu Tal – dem Erfindungsreichtum (sowie dem Schwachsinn) waren und sind keine Grenzen gesetzt. Gleichzeitig verkam der Everest zum Protzberg für Amateur-Abenteurer, die sich heute für viel Geld auf den Gipfel hieven lassen und daheim ordentlich angeben können. An den Hängen türmt sich der Müll, die Sherpas entfremden sich der eigenen Kultur. Andererseits bietet der moderne Massentourismus auch die Möglichkeit, eine Infrastruktur für die sonst in Armut gefangene einheimische Bevölkerung zu schaffen, welche die Tradition und die Welt des 21. Jahrhunderts harmonisch verbindet.
Eine Liste der „Mount-Everest-Expeditionsteilnehmer 1921-53“ (Sue Thompson und Mike Westmacott), S. 244-248, bietet kurze Biografien derselben, welche klarstellen, dass sich das Leben dieser Männer nicht auf das Besteigen möglichst hoher Berge beschränkt. Auf Namen beschränkt bleibt eine Liste der „Besteigungen seit 1953“, S. 249-251. Sie belegt den zunehmenden Sturm auf den Everest-Gipfel. Anmerkungen und weiterführende Literatur schließen auf S. 252 das Buch ab.
Bücher über den Mount Everest oder den Himalaja gibt es auch auf dem deutschen Buchmarkt viele; wieso also noch eines publizieren bzw. an dieser Stelle rezensieren? „Everest. Die Geschichte seiner Erkundung“ präsentiert in der Tat kaum neue Fakten, sondern fasst Bekanntes noch einmal zusammen. Dies geschieht freilich in einer Form, die vor allem den Laien mit der Landschaft, ihren Menschen und den seltsamen Fremden, die auf Leben & Tod möglichst hohe Felsen erkriechen, vertraut machen kann: lesbar, informativ, kompakt.
Doch das eigentliche Pfund, mit dem diese Jubiläumspublikation wuchern kann, sind die Abbildungen. Bemerkenswerte Schätze kommen aus dem RGS-Archiv ans Tageslicht. Da sind nie gesehene frühe Aufnahmen des Everest; der Fotoapparat dokumentiert, wie die „Sahibs“ dem lange nicht zugänglichen Objekt ihrer begehrlichen Aufmerksamkeit allmählich immer näher rücken.
Dann gibt es da Aufnahmen von Expeditionen, die ulkig gewandete Männer mit gewickelten Beinen und in schweren Mänteln zeigen, die mit aus heutiger Sicht völlig unzureichenden Mitteln Unglaubliches leisten, per Baumstamm klaffende Gletscherspalten überbrücken, von Eisstürmen gebeutelt lotrechte Steinwände ersteigen und in winzigen Zelten in einer unwirtlichen Mondlandschaft ausharren. (Auffälliges Lieblingsmotiv aller Everestreisenden: gewaltige Bergpanoramen, darin suchspielartig & ameisengleich Menschen.) Dabei sind die berühmten letzten Bilder von George Mallory und Andrew Irvine, die 1924 bei dem Versuch, den Gipfel unbedingt zu erreichen, spurlos verschwanden, ohne dass jemals klar wurde, ob es ihnen gelungen ist, bevor sie starben. (Mallorys Leiche wurde 1999 am Berg gefunden; das Rätsel bleibt bestehen.)
Nebeneinander gestellt verraten die Fotografien von Everestmannschaften viel über die Entwicklung des Himalaja-Bergsteigens vor und nach dem II. Weltkrieg. Kleidung, Ausrüstung, Verpflegung – alles ändert sich, während die einheimischen Sherpas aus dem Hintergrund vom Lastenträger zum gleichberechtigten Kameraden in den Vordergrund rücken. Am Tag des Triumphes, dem 29. Mai 1953, ist es Tenzing Norgay, der die Gipfelfahne in die Luft hält; von Edmund Hillary existiert kein Foto auf der Everestspitze.
„Everest“ dokumentiert aber auch ein Interesse der Himalajareisenden, das sich nicht nur grimmig auf die Besteigung von Bergen richtete, sondern auch auf die fremde Welt, die man auf dem Weg dorthin durchreiste. Einmalige Aufnahmen der Natur sowie der tibetischen und nepalesischen Menschen entstanden, die einen Lebensalltag dokumentieren, der spätestens seit der chinesischen Besetzung Tibets und dem Einbruch der „modernen“ Zivilisation auch in diesen entlegenen Winkel des Erdballs endgültig der Vergangenheit angehört.
Mit fast 50 Euro ist „Everest“ kein kostengünstiges Buch. Das lässt sich damit begründen, dass hier nichts „billig“ geraten ist. Feines Kunstdruckpapier, sauberes Layout, kräftige Fadenbindung, großartige Abbildungsqualität: Der Preis kommt nicht von ungefähr. Der sparsame Leser sei indes darauf hingewiesen, dass Restbestände dieses Bandes u. a. im Weltbild-Verlag für ca. 20 Euro angeboten werden – einer möglichen Neuausgabe verkleinerten Maßes ist dieses Original allemal vorzuziehen, denn nur auf den ursprünglichen 30,5 x 29,3 cm lassen sich die Fotos wie vorgesehen genießen!
Stephen Venables (geb. 1954) gehört zur alpinistischen Prominenz. Auf der ganzen Welt hat er Berge erklommen, dabei neue Routen entdeckt und in der Antarktis Gipfel gefunden, die noch unbestiegen waren. Seine große Liebe gehört indes dem Himalaja, den er im Verlauf von mehr als einem Dutzend Expeditionen ausgiebig bereiste. Seine Kletterleidenschaft führte ihn hier zu den weniger hohen, dafür jedoch unbekannten Bergen. 1988 gehörte Venables jenem Vier-Mann-Team an, das eine spektakuläre Route durch die Mount-Everest-Ostwand erschloss. Als Publizist ist Venables auf dem Buchmarkt und in praktisch allen einschlägigen Zeitschriften für Bergsteiger vertreten.