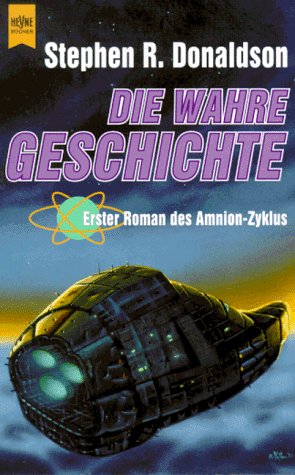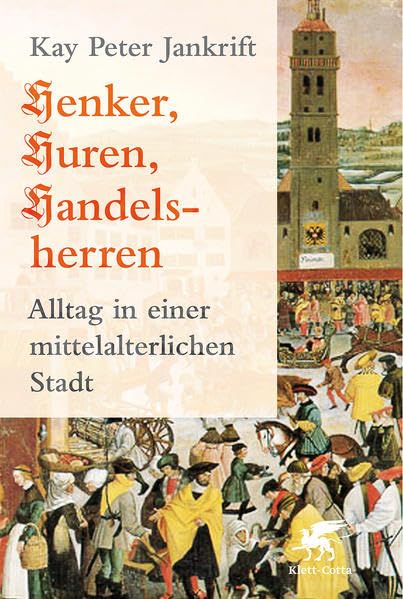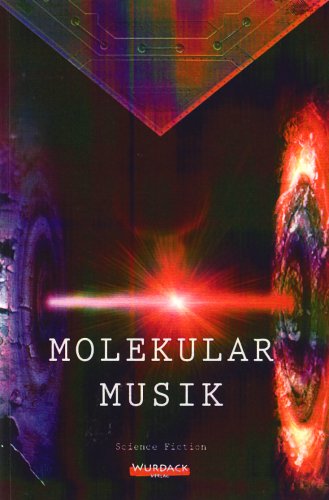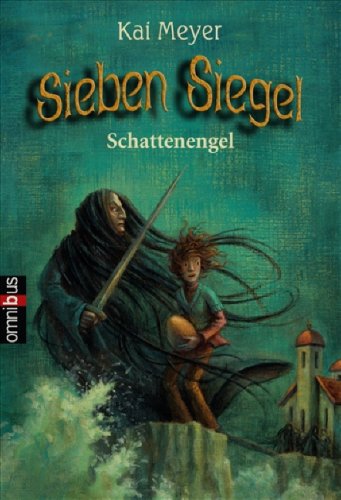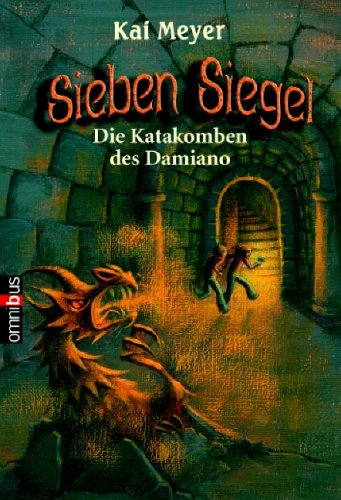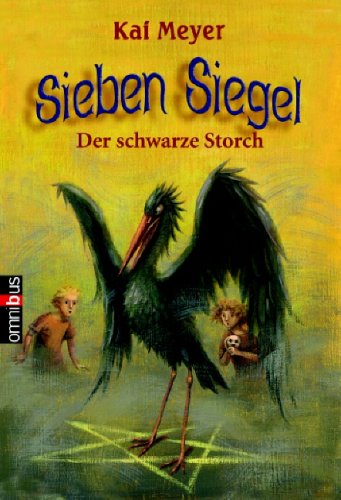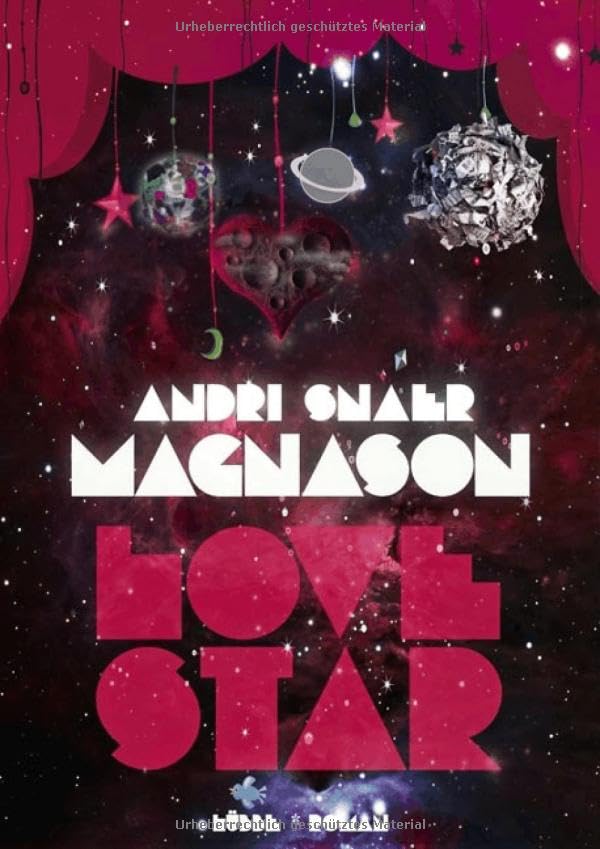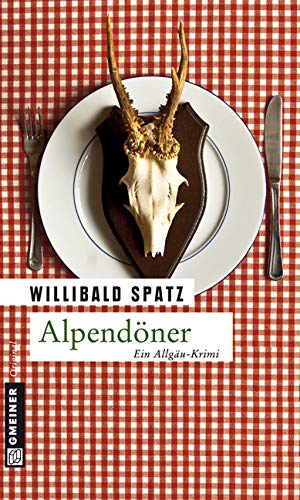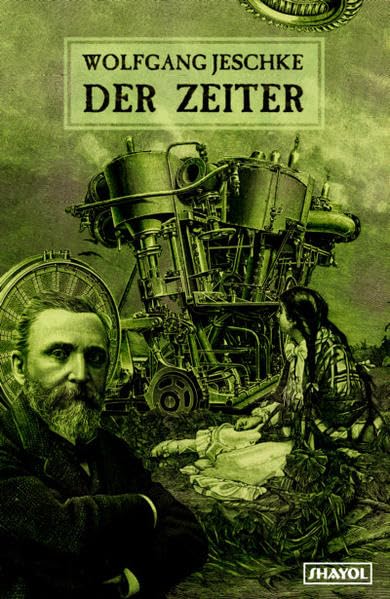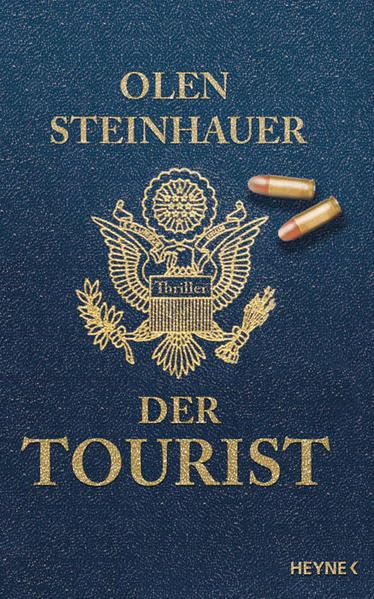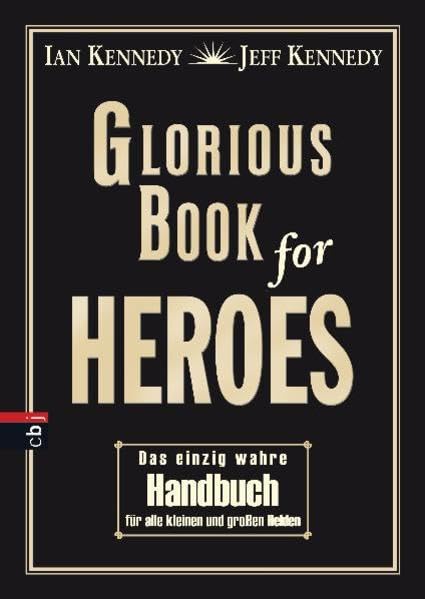Die jüngste Erzählungssammlung des interessantesten amerikanischen SF-Autors der letzten 30 Jahre präsentiert 13 Beiträge. Bis auf zwei sind alle Storys für jeden deutschen Leser mit mittleren Englischkenntnissen leicht lesbar. Doch besagte zwei Storys haben es wirklich in sich.
– Die Story einer verbotenen Liebe
– Storys über Design und Architektur der nahen Zukunft
– Über das Ende der Welt und der Menschheit
– Über die Zukunft, die jetzt Vergangenheit ist: in Alt-Ägypten, in der Türkei und in Palästina
– Über die Zukunft des Schwarzen Kontinents
– Über die Zukunft des Silicon Valley
– Und vieles mehr.
Der Autor
Bruce Sterling, der Mitbegründer der Cyberpunk-Bewegung der achtziger Jahre, ist der Autor von neun Romanen, wovon er einen, „Die Differenz-Maschine“, zusammen mit William Gibson schrieb. Er veröffentlichte drei Storysammlungen (darunter „A Good Old-fashioned Future“) und zwei Sachbücher, darunter das bekannte „The Hacker Crackdown“ (1992) über die Verfolgung von Hackern und Crackern.
Er hat Artikel für die Magazine Wired, Newsweek, Fortune, Harper’s, Details und Whole Earth Review geschrieben. Den Hugo Gernsback Award für die beste Science-Fiction-Novelle gewann er gleich zweimal, u. a. für „Taklamakan“. Er lebt in der Universitäts- und Industriestadt Austin in Texas und hat schon mehrmals Deutschland besucht. Eine seine Storys spielt in Köln und Düsseldorf. Ich habe ihn 2007 persönlich in München bei einem Interview kennengelernt.
Die Erzählungen
1) In Paradise (2002)
Felix Hernandez, ein junger Klempner, sieht das Muslimmädchen das erste Mal an der Sicherheitsschleuse zum Gebäude, in dem er einen Auftrag erledigen soll. Während ihre zwei erwachsenen Begleiter – Vater und Onkel? – auf sie warten, fällt der Strom und ihr Akku streikt. Felix ist so nett, ihr den Akku seines eigenen Handys der gleichen Marke zu geben und erhält dafür ihren. Dabei merkt er sich nicht nur ihre Telefonnummer, sondern auch ihr wunderschönes Gesicht. Sein Herz ist entflammt.
Später ruft er sie wieder an und – oh Wunder der Technik – ihr finnisches Handy übersetzt seine poetische Liebeserklärung automatisch in Farsi, also die persische Sprache. So schöne Worte hat der 19-jährigen Perserin noch niemand gesagt, und sie ist bereit, mit ihm auszureißen. Zehn paradiesische Tage im Bett und am Handy folgen. Dann kommt die kalte Dusche, sozusagen die Schlange.
Ein Agent des Heimatschutzministeriums meint es gut mit Felix, doch seine zwei Begleiter vom iranischen Geheimdienst weniger. Enttäuscht darüber, dass das Mädchen nicht da ist, stellen sie Felix’ Wohnung auf den Kopf, bevor sie wieder abziehen. Der DHS-Agent macht Felix klar, dass das Mädchen, die Tochter eines Mullahs, sich illegal in den USA aufhält und alle Ausgänge und Transportwege sowie Kreditkarten überwacht werden. Der Agent schaltet sich später sogar in das Gespräch zwischen Felix und seiner Herzensdame ein – und schaltet per Fernsteuerung ihre Handys aus!
Nun ist guter Rat wahrlich teuer, doch wahre Liebe findet stets einen Weg, sogar in einer Republik der totalen Überwachung …
Mein Eindruck
Eine warnende und ironische Story über Liebe in Zeiten der totalen Überwachung. Wenn sogar die Handys per Fernsteuerung ausgeschaltet werden können (vom Abhören ganz zu schweigen), dann haben es Adam und Eva nicht leicht, der Schlange in ihrem Eden zu entkommen. Aber es geht – mit Hilfe primitiver Mittel, auf die die Agenten nie im Leben kommen würden.
Im Übrigen ist die automatische Sprachübersetzung im Handy durchaus eine Technik der nahen Zukunft, und die Fernabschaltung sowie Speicherlöschung lässt sich bereits heute bei vielen Smartphones und Handys realisieren.
2) Luciferase (2004)
Vinnie ist ein Leuchtkäferchen, das in der Nacht hell leuchtet. Jedenfalls solange es nicht gefressen wird, und diese Gefahr lauert überall. Da wäre beispielsweise sein alter Bekannter Peck, die Spinne. Peck ist hungrig, aber auch unglücklich. So ein einsamer Wolf hat’s eben nicht leicht bein den Frauen. Da ist der helle Vinnie schon besser dran: Die Frauen fliegen auf ihn! Nach ein paar Ratschlägen für Peck saust er weiter.
Auf einer Nesselblüte erspäht er eine kesse Braut, die ihn besonders hell anstrahlt. Zu spät erkennt er, dass es sich um eine Falle handelt. Sie ist eine Photuris, die auf das Fressen von Photinussen wie Vinnie spezialisiert ist. Zunächst balgen sie sich, doch dann herrscht Stillstand: Matt beide. Sie heißt Dolores und ist scharf ihn. Natürlich nur auf seine Fleisch. Aber er bringt ihr bei, dass es mehr gibt als nur fleischliche Gelüste, nämlich Kunst.
Als ein männlicher Photuris eintrifft, der von Dolores verlangt, sie solle Vinnie töten und ihm die Hälfte abgeben, weil er ja so toll ist, hat Vinnie ein ausgezeichnetes Ziel, um Dolores zu demonstrieren, was er meint. Dieser Geck ist ein Dampfplauderer – und gleich darauf ein Opfer von Peck, der Spinne …
Mein Eindruck
Man könnte die witzige Geschichte für eine Fabel halten, wenn sie bloß auch eine Moral hätte, Aber davon ist weit und breit nichts zu sehen. Vielmehr unterhalten sich die Tierchen so, als befänden sie sich in einer texanischen Bar (der Autor ist Texaner) über die Frauen, das Leben und den ganzen Rest. Das tun sie im typisch amerikanischen Umgangston. Vinnie behält die Oberhand, was uns richtig aufbaut – er ist ein authentischer Künstler, nicht wie die anderen Imitatoren und Epigonen. Möge ihm eine lange Nacht vergönnt sein!
Luciferase ist übrigens eine im Text vorkommende chemische Substanz, die der biologischen Lichterzeugung dient.
(3 kurze Stücke für die Zeitschrift NATURE)
3) Homo sapiens declared extinct (1999, „Menschen für ausgestorben erklärt“)
Im Jahr 2350 wird die Menschheit für ausgestorben erklärt – na und? Kein Grund sich aufzuregen, finden die posthumanen KIs und Entitäten, schon gar nicht die Blutbader in der Oort’schen Wolke, die seit jeher auf die „federlosen Zweibeiner“ herabgeschaut haben. Eine Grabrede wäre jedoch angebracht, findet die Poetware: „Sie waren sehr, sehr sonderbar und nicht sonderlich mit Weitsicht gesegnet.“
Mein Eindruck
Nicht gerade eine Story, aber wenigstens ein Nachruf auf die Menschheit. Allerdings erfahren wir nicht, was zum Aussterben des Menschen geführt hat.
4) Ivory Tower (2005, Elfenbeinturm)
Im Jahr 2050 stürzen sich die Net-Geeks auf das Gebiet der Quantenphysik – natürlich in ihrer typischen Manier. Erst googeln sie alles Wissen zusammen, speichern alles in Storage-Einheiten, tauschen sich in sozialen Netzwerken und Blogs aus. Schließlich errichten sie irgendwo in Rajastan, Indien, ihre eigene Forschungseinrichtung, einen Teilchenbeschleuniger. Ihre Programme sind Open-Source und kostenlos, ihre Hardware ist Abfall, ebenso wie die Technik, die sie für die Errichtung des Supercolliders nutzen. Ihr Essen ist ebenso recycelt wie ihre Möbel und alles andere.
Man sollte erwarten, dass eine derart auf Lösungen fixierte, geradezu mönchische Männergemeinschaft die Frauen abschrecken würde, aber weit gefehlt! Die Ladys finden die Sache cool und machen schon bald einen großen Teil der Kolonie aus – natürlich nicht unter den Physikern. Das war ja schon immer so. Und was nachts passiert, geht keinen was an.
Das Einzige, was man hier nicht haben will, sind Typen, die an der Atombombe forschen. Diese 100 Jahre alte Technik ist nun wirklich nicht cool.
Mein Eindruck
So ein moderner Elfenbeinturm ist auch nicht mehr das, was er mal war. Diesmal haben sich die Geeks die Hochtechnologie der Teilchenbeschleunigung vorgenommen, sozusagen den teuersten Bereich der Physik – siehe CERN bei Genf. Dass man solch eine Forschungseinrichtung auch ganz anders aufziehen kann als bisher, zeigen die modernen Geeks aus Kalifornien. Dass sie das erst 2050 tun sollen, ist das einzige Unwahrscheinliche an der Geschichte.
5) Message found in a bottle (2006)
Diese „Flaschenpost“ stammt aus dem Tank eines Warmwassersboilers aus einer Bibliothek in Schottland, gefunden unter dickem Eis. Geschrieben hat sie ein Klimawissenschaftler, der uns berichtet, dass er Wissenschaftsmagazine wie NATURE verbrannt hat, um heizen zu können. Denn über Europa ist durch den Treibhauseffekt nicht die Hitzewelle gekommen, sondern die Eiszeit.
Der Grund für die Eiszeit ist ebenso simpel wie tödlich: Die Wälder Russland und Brasiliens sind niedergebrannt und haben dabei Unmengen von Ruß und CO2 freigesetzt, so dass sich daraus eine dicke Wolkendecke ergab, die keinen Sonnenstrahl mehr durchlässt – ähnlich wie ein Nuklearer Winter. Deshalb gibt es in Schottland Eis, von Deutschland ganz zu schweigen. Der wärmende Golfstrom scheint völlig versiegt zu sein, wird aber nicht erwähnt.
Die geistige Verfassung der Überlebenden sieht jetzt offenbar so aus, dass der kleine Stamm, dem der Klimawissenschaftler angehört, inbrünstig zu Gott um Vergebung seiner Sünden betet. Ein bisschen spät, findet er. Denn die Sünden wurde ja schon weit in der Vergangenheit begangen, als man den Klimawandel noch hätte dämpfen können.
Mein Eindruck
Sterling ist ein Schelm: Er schrieb diesen Text für das Magazin NATURE und lässt doch den Urheber der Flaschenpost, Magazine wie NATURE verbrennen, um heizen zu können. Ein weiteres ungewöhnliches Merkmal dieses Textes ist die Theorie, dass uns der Klimawandel nicht die große Hitzewelle bringt, sondern die Eiszeit.
Diese Prophezeiung hat durchaus etwas für sich, wenn man die ungeheuren Rußmengen bedenkt, die das Abfackeln der Wälder des Amazonas, Indonesiens und der Taiga Russlands bedenken. Dieser Prozess hat bereits begonnen, wie im Sommer 2010 in Russland beobachtet werden konnte, als dort die Wälder brannten und über 1700 Kilometer hinweg den Himmel verdunkelten. Das gleiche Schicksal könnte das Amazonesbecken ereilen, das ja ebenfalls schon unter ein oder zwei Dürren hat leiden müssen – ungewöhnlich für eine so regenreiche Region.
Obwohl die „Flaschenpost“ mit 2,5 Seiten ziemlich kurz ist, bietet sie doch eine Menge Stoff zum Nachdenken.
6) The Growthing (2004)
Im Jahr 2045 steht irgendwo im ausgetrockneten West-Texas eine sehr sonderbare Anlage: Der einzige Ort weit und breit, wo sich Feuchtigkeit findet, denn sie wird von genetisch veränderten Bakterien im Treibhaus erzeugt, der Wind wird gefangen und die Feuchtigkeit im ganzen Wohngebäude verteilt. Die ganze blasenförmige Architektur erhebt sich über einem Brennstoffreservoir, dessen Hüter Milton ist, ein Architekt und Designer.
Heute ist der letzte Tag, an dem seine Tochter Gretel ihn besuchen darf, die sonst in New Jersey bei seiner geschiedenen Frau leben muss. Der Zeppelin holt sie ab, ohne zu landen. Aber wenig später taucht ein weiteres Mädchen auf, dem Gretel eine E-Mail geschickt hat. Dieses Mädchen gehört zu einem wandernden Stamm von Westtexanern, die Wasser suchen, und sie sucht das blasenförmige Gebäude Miltons. Hier will sie Schafe züchten. Milton ist nicht abgeneigt, den Stamm aufzunehmen.
Mein Eindruck
Die Zukunft von West-Texas, die der Texaner Sterling hier entwirft, ist wahrlich nicht wünschenswert: die unterirdischen Wasserläufe sind versiegt, ebenso das Erdöl (deshalb der Zeppelin), und deshalb muss es neue Wege geben, die geringen Ressourcen zu nutzen und neue zu erzeugen. Ganz nebenbei stellt er die Objekte seines Bekannten, des Öko-Architekten greg Lyn vor. Denn dieser Text wurde für das Architekturblatt „Metropolis“ geschrieben.
7) User-Centric (1999, „Benutzerorientiert“)
Das 21. Jahrhundert lässt eine bestimme US-Firma sich fragen, was sie mit der neuen MEMS-Technologie anfangen könne. MEMS sind heute besser als RFID-Funketiketten bekannt, also als Chips, die per Funk Daten liefern, empfangen und speichern können. Das siebenköpfige Designteam wird vom Chefkoordinator dazu angehalten, an den Nutzer zu denken: Welche Nutzung wäre welchem Nutzer am liebsten – und welche Vorteile könnte man daraus ziehen? Dazu muss man erstmal eine geschichte erfinden sowie zwei Nutzertypen – nennen wir sie Al und Zelda. Er ist etwa 34 und technikorientiert, sie ist über 65 und haushaltorientiert. Zusammen sind sie daran interessiert, alle ihre Besitztümer mit Funkchips zu versehen und zu überwachen.
Soweit, so schön, doch dann setzt der Autor den Entwurf in die fiktionale „Realität“ um. Al muss eine Maske aufsetzen, die ihn älter macht als seine Zelda. Sie hat zwar einen göttlichen und stark verjüngten Body, doch wer würde ihr den jungen Gatten abnehmen, wenn sie schon Enkelkinder hat? Er spielt den Sugardaddy, der sie aushält, aber nur mit Maske. Zusammen sorgen sie dafür, dass das Haus in Tiptop-Zustand ist und alles per Funkchips überwacht wird. Al verzweifelt, hat Albträume, doch Zelda tröstet ihn: Es gibt keine Happy-Ends, Lieber, es gibt nur Methoden, mit den Dingen fertigzuwerden.
Mein Eindruck
Das Brainstorming per E-Mail zeigt eine typische amerikanische Hitschmiede, komplett mit Marketing, Programmierer, Rechtsberater, Designerin, Grafikerin und sogar einer Sozialanthropologin. Doch der ganze Prozess führt lediglich zu einem Entwurf, dessen Absurdität und Inhumanität sich sofort anhand der fiktionalen Umsetzung zeigt. Das ist Satire in Reinkultur, ohne den belehrenden Zeigefinger zu heben. Die Botschaft ist deutlich: Wer im Elfenbein entwirft, braucht sich nicht zu wundern, wenn Müll herauskommt, den niemand kaufen will, ja, der sogar antihuman ist.
8) Code (2001)
Die Gegenwart, Austin, Texas. Louis, der Hauptprogrammierer der Softwarefirma Vintelix, hat den Löffel abgegeben: Herzinfarkt. Kein Wunder bei 150 Kilo Lebendgewicht, denkt sich Van, sein wichtigster Stellvertreter. Was soll er jetzt bloß mit der Leiche machen? Da tritt das Mädchen vom Empfang ein, Julie, sie denkt praktischer: Er soll die Cops rufen. Ach ja, und den Vorstandsvorsitzenden (CEO) informieren. Aber vorher durchsuchen sie noch Louis’ massiven Schreibtisch: Bingo – Tabletten von LSD, vulgo: Acid. Sie teilen sich die 400 Trips.
Der CEO gibt ihnen frei, aufgrund besonderer psychischer Belastung. So können sie sich per Webcam und Telefon unterhalten. Julia ist wagemutig. Wie viele Trips soll sie einwerfen – vier oder fünf? Van ist eher vorsichtig und vernünftig: einer dürfte erstmal reichen. Und tatsächlich: Schon bald schüttet ihm Julia ihr Herz aus. Und wie romantisch sie ist! Liest und empfiehlt Liebesratgeber. Sie wird richtig aufgedreht. Dann muss er ins Fitness-Studio. Als er zurückkehrt, steht sie vor seiner Tür. Klar darf sie mir reinkommen. Aber sie schlafen nicht miteinander. Noch nicht.
Am nächsten Tag befördert der CEO Van zum Chefprogrammierer, was zwar mehr Aktienoptionen einbringt und einen neuen, wertlosen Titel, aber auch mehr Arbeitsbelastung. Und der Code, den Louis hinterlassen, ist ein Tohuwabohu – sein Baby. Und keiner blickt da durch. Alles auslagern, nimmt sich Van vor, bevor ihm die zwei bestellten Ehe-Ratgeber geliefert werden. „The Code“ – wertloser Schmonzes, doch „The Rules“ ist bitter und grimmig, eine wahre Gebrauchsanleitung zur Selbstbehauptung der geplagten, unterdrückten Frau gegen das brutale Regime des Mannes.
Genau das Richtige, um ein neues Betriebssystem zu schreiben und Julia zu seiner wichtigsten Mitarbeiterin zu machen, auch privat.
Mein Eindruck
Die Story könnte direkt aus einem Kapitel von Douglas Couplands Klassiker „Mikrosklaven“ stammen, so exakt werden die Arbeitsverhältnisse in der Softwarefirma beschrieben. Aber dann kommt der praktische Sterling-Touch hinzu: Wie sich menschliche Beziehungen nutzbringend mit der Arbeit verbinden lassen. Arbeit und Liebe müssen einander nicht ausschließen, ganz im Gegenteil.
(Kollaborationen)
9) The Scab’s Progress (mit Paul Di Filippo, 2001)
Nach dem Zusammenbruch der planetaren Ökosphäre und der Ölindustrie mussten die Überlebenden andere Technologien finden, um erstens Ernährung sicherzustellen und zweitens Informationstechnik. In der Verbindung aus beiden Anstrengungen entstand die fortgeschrittenste Biotechnologie, die man sich vorstellen kann.
Natürlich haben auch die Halb- und Unterwelt sowie die semilegalen Selbständigen ihren Anteil an der „Immunosance“, wie die Gesamtheit aller Bio- und Gentechniker jetzt genannt wird. Fearon und Malvern sind zwei solche halblegale „Scabs“, und als Malvern an Fearons Tür klopft, herrscht Alarmstufe Rot: In dem Slum Liberty City am Rande von Miami ist ein Biotechlabor explodiert, das ihren Kunden gehörte. Sie müssen schnell hin, um zu retten, was noch zu retten ist, bevor die Cops und Behörden Asche daraus fabrizieren, um eine Kontamination der Umgebung zu verhindern.
Wie sich schnell zeigt, ist das interessanteste Objekt bei Mixogen die Chefin. Ihr Gehirn ist, wie man an dem angeschwollenen Schädel erkennen kann, genetisch aufgemöbelt worden. Sie entnehmen dem Gehirn eine Gewebeprobe und verduften, denn schon ist der erste Cop-Späher eingetroffen. Leider ist Fearons Labor nicht in der Lage, aus der Gehirn-DANN einen Sinn herauszulesen. Deshalb schlägt Malvern, den alten Kemp Kingseed zu konsultieren. Er lebt in einer aufgelassenen Erdölraffinerie, bewacht von seiner Riesenspinne Shelon (aus „Herr der Ringe“).
Kemp Kingseed erinnert die beiden Möchtegern-Genies an jene heroischen Zeiten, als Linux, Napster und Freenet erfunden wurden – lang ists her. Aber Kemp kann die Botschaft aus der Hirn-DANN der Mixogen-Chefin lesen, mit Hilfe eines entsprechenden Raben. Demzufolge wurde die wertvollste DNA des Planeten, nämlich die der letzten Wildtiere des im Chaos untergegangenen Kontinents Afrika, in einem geheimnisvollen Gebilde namens Panspecific Mycoblastula. Sie müsse sich in Sierra Leone befinden.
Weil Fearon die Datenverbindung zu seinem gentechnisch aufgemotzten Hausschwein Weeble offengelassen hat, konnte jedoch sein härtester Konkurrent, Ribo Zombie, alles, was der Rabe sprach, mithören. Mist! Wegen Fearons Blödheit könnte ihnen der Rivale den DNS-Schatz vor der Nase wegschnappen. Kemp, der alte Kämpe, beruhigt die beiden junge Biotechkämpfer: Sein Mann vor Ort erwartet sie bereits und werde ihnen helfen.
Fearon und Malvern machen sich auf in ein Wettrennen um einen Schatz, der in einer der unzivilisiertesten Gegenden des Planeten liegt: im Herzen der Finsternis, wo unbekannte Gefahren lauern …
Mein Eindruck
Die turbulente Novelle spielt in einer radikal veränderten Welt, die vielleicht aber nur 30 oder 40 Jahre entfernt liegt und beängstigende Umwälzungen ahnen lässt. Der Treibhauseffekt hat voll zugeschlagen, die Ölindustrie ist nur noch Erinnerung, dafür hat die Biotechnologie die Informationstechnik abgelöst. Vor diesem Hintergrund rackern sich unsere zwei wackeren Helden redlich ab, um sich über Wasser zu halten – obwohl: Fearon hat mit seiner Frau Tupper, einer reichen Erbin, wirklich das große Los gezogen.
Und dennoch will er alles aufs Spiel setzen? Auf der Jagd nach etwas, was der Leser nur als eine Art MacGuffin bezeichnen kann, begegnet Fearon nicht nur Fossilien wie Kemp Kingseed und dessen afrikanischem Klon Herbie Zoster, sondern, viel schlimmer, einem Despoten, der alle Albträume von afrikanischen Tyrannen in sich vereint: menschliche DNS ist kaum noch vorhanden, sondern dominiert von Ameisen-Erbgut, ebenso wie bei seinen Untergebenen. Denn wenn eine Spezies das aufgegebene Afrika erobert hat, dann ist es die Ameise. (Diese Idee erinnert an gewisse postviktorianische „Tarzan“-Abenteuer.)
Diese Welt ist post-human, aber auch post-natürlich – komplett überarbeitet von Biotechnologie, die aus dem Ruder gelaufen ist. Die einzigen, die damit noch gut zu Rande kommen werden, sind die Kinder von Fearon und Tupper. (Siehe dazu auch die schöne Geschichte über die Nekropole von Theben.) Ach ja – Ribo Zombie! Er hat seinen großen medienwirksamen Auftritt. Mehr darf darüber nicht verraten werden.
10) Junk DNA (mit Rudy Rucker, 2003)
Silicon Valley ist auch nicht mehr das, was es mal war: das Tal der vergoldeten Träume eines digitalen Goldrauschs. Selbst Leute mit Ideen müssen sich jetzt als sterbliche Angestellte ausbeuten lassen, klagt Janna Gutierrez, die informationelle Gentechnik studiert hat. Sogar ihr Dad muss sich in der Wetware-Industrie abrackern. Der einzige Freund, den Janna abzubekommen schien, war ein Koreaner – jedenfalls solange, bis dessen Mutter eine nordkoreanische Erbin als Braut anschleppte. Die Zukunft sieht trübe aus.
Da schneit Veruschka Zipkin aus St. Petersburg in Jannas Firma herein. Obwohl Veruschkas Angebot eines gemeinsamen Gentechnikprojekts abgelehnt wird, tut sie sich doch mit ihrer neuen Freundin Janna zusammen, um eine neue Firma aufzuziehen. Veruschka zieht bei Janna und ihrem Dad ein, und als sie entdecken, dass Dad eine halbe Million Dollar für seine Rente zurückgelegt hat, dauert nicht sehr lange, bis sie den Start einer eigenen Firma finanzieren können. Alle drei sind gleichberechtigte Teilhaber.
Veros Idee besteht in folgendem: Sie kann eine formbare Biomasse mit menschlicher DNS und dem patentierten Universellen Ribosom imprägnieren und auf diese Weise süße kleine Wonneproppen erschaffen, die beliebige Eigenschaften haben können. Mit Dads Hilfe lassen sich die „Pumptis“ färben und verformen, wie es dem Benutzer gefällt. „Tamagotchis“ und „Pokémons“ sind Hühnerdreck dagegen! Das beste ist jedoch, dass die benutzte menschliche Erbsubstanz nicht diejenige ist, die einen Menschen formen – das wäre ja illegal und unmoralisch – sondern aus den unterdrückten und ungenutzten Stücken des Erbguts besteht, wie der homo sapiens sie aus seiner Evolution übrigbehalten hat: Junk-DNS. Wie sich zeigt, wird diese Art der Neuschöpfung von den Behörden genehmigt.
Nach einem vielversprechenden Start durch Straßenverkauf, Mundpropaganda und virales Marketing kommt es allerdings zu fatalen Geschäftsfehlern: Die Qualität stimmt nicht, Betrüger und Raubkopierer schnappen sich die Ideen und Profite, schon bald steht die kleine Firma Magic Pumpkins vor dem Aus. Doch wer könnte ihnen aus der Patsche helfen, wenn sich kein Risikokapitalgeber dazu bereitfindet? Die Antwort besteht in Ctenephore Industries. Janna und Vero müssen sich verkaufen – und werden nach allen Regeln der Kunst über den Tisch gezogen. Ihnen bleibt die Aussicht auf ein Angestelltengehalt mit einem nichtssagenden Titel.
Haben sie das verdient, fragen sie sich. Niemals! Dieses Unrecht schreit nach RACHE. Und Veruschkas, stets die praktische und unverwüstliche des Dynamischen Duos, hat die Lösung: Gentherapie für die beiden Feinde, Revel Pullen und Tug Mesoglea. Und nach ein paar Wochen der Rekonvaleszenz ihrer Firma – die Pumptis können auch digitale Daten empfangen, senden und verarbeiten – ist der Moment der Vergeltung gekommen. Die Wirkung ist jedoch nicht ganz die erwartete. Junk-DNS folgt eben ihren eigenen Gestzmäßigkeiten …
Mein Eindruck
Keine Angst, dieses Märchen geht wie alle Märchen gut aus, nur eben nicht auf die erwartete Weise. Denn es ist ein Silicon-Valley-Märchen, in dem Valley-Träume auf eine Russin treffen, die Erfahrung mit der russischen Mafia hat. In Russlands Genetiker-Schwarzmarkt werden die Dinge etwas anders gehandhabt als im Goldenen Westen.
Die Novelle weiß den entsprechend beschlagenen Leser, der sich mit Biotechnologie, Genetik, Mathematik und Software auskennt, mit etlichen witzigen Einfällen zu erfreuen. Dazu gehört die Idee mit der Junk-DNS, dem Universellen Ribosom und den süßen kleinen Pumptis. Der Schauplatz San Francisco ist mir bestens vertraut: Wer es hier nicht schafft, um den neuesten technischen Schnickschnack zu erschaffen, der wird es weder an der Ostküste noch in Hongkong schaffen – das sind die Orte, auf die es heutzutage ankommt. (Von Europa ist kaum die Rede, außer eben als Veruschkas Herkunft.)
Richtig bizarr sind die Ideen, die den beiden Inhabern von Ctenophore einfallen. Der eine, Pullen, will eine Hochsicherheitszone für das bürgerliche Zuhause verwirklichen; der andere will berührungsempfindliche Geldnoten entwickeln, die von ihren Benutzern DNS-Proben nehmen – wunderbar in der Verbrechens- und Terrorismusbekämpfung, oder? Zu blöd, dass heute kaum noch mit Geldscheinen bezahlt wird.
Der groteske Höhepunkt der Entwicklung, dem Janna mit Grausen entgegensieht, besteht in der Gentherapie für Tug und Revel, die beiden vermeintlichen Feinde. Hier zeigt die Junk-DNS, was sie wirklich draufhat. Mehr darf hier nicht verraten werden, um nicht das Vergnügen zu schmälern. Rudy Rucker, von Haus aus Mathematiker, lässt aber auch die Sau raus, und das gibt der Story eine unverwechselbare Note. Ich habe sie mit großem Spaß gelesen.
(Historische Fiction)
11) The Necropolis of Thebes (2003)
Am Westufer des Nils liegt die Totenstadt von Theben, und der alte Shabti-Figurenschnitzer Apepi fährt mit einem Streitwagen zum Pharaonengrab, um es wie stets seines Metalls zu berauben. Denn Apepi ist zum Steuereintreiber der Eroberer, der Hyksos, ernannt worden und muss sein Soll erfüllen. Da sein Volk aber schon längst bis zum letzten ausgequetscht ist, muss er nun auch die Toten berauben.
Das Gold ist längst fort, ebenso das Silber, aber die Shabti-Figuren wird er niemals anrühren. Nicht nur, weil sonst der Pharao niemanden hat, der ihm Jenseits dient, sondern weil die Hyksos für die ägyptischen Totenriten nur Verachtung übrig haben. Und eines Tages wird Apepis Sohn eine Shabti-Figur schnitzen, die einen Wagen und seinen Lenker zeigt und dann …
Mein Eindruck
Die Erzählung ist ein Beispiel dafür, wie der Zukunftsschock den Historiker getroffen hat, sagt der Autor in seiner Anmerkung. Die historische Erzählung zeigt nicht nur dies, sondern den Weg, wie man den Zukunftschock, den die Hyksos bedeuteten, durch eine neue Generation Kinder überwindet: Sie kennen nichts anderes. Und sie werden die neue Technologie der Eroberer dereinst gegen sie verwenden (und so geschah es auch).
12) The Blemmye’s Stratagem (2005)
Im Heiligen Land ist Jerusalem gefallen, und Saladins Krieger jagen die Kreuzritter, bis diese sich nur noch in ihren Festungen verkriechen können. Der Oberste der Assassinen, der Alte vom Berge, trägt seinen Teil dazu bei, die Christen zu verjagen, die fast 90 Jahre lang Palästina besetzten. Deshalb ist es umso bemerkenswerter, dass seine engste Vertraute eine Christin ist, die Äbtissin Hildegart. Sie ist nicht nur das Oberhaupt des Ordens der Hospitaller (nicht der Templer), sondern auch eine Kauffrau, die Investitionen von Sevilla bis Sumatra ihr Eigen nennt. Mit Zahlen kann sie viel besser umgehen als Sinan, der Assassine, doch der bessere Poet ist sicherlich er.
Beide stehen in Diensten jenes seltsamen Diplomaten und Kaufmanns, der ihnen vor vielen Jahrzehnten den Trank des langen Lebens zuteilwerden ließ: der Blemmye. Gerüchte besagen, dieses Wesen komme aus dem afrikanischen Königreich von Prester John. Es trägt keinen Kopf, sondern sein Gesicht im Oberkörper, mit Augen, Nase und Mund. Da es nicht sprechen kann, schreibt es alle Botschaften auf, und Hildegart ist die beste Leserin dieses Gekritzels. Mit seinen ausgedehnten Handelsniederlassungen verständigt sich der Blemmye per Brieftaube, genau wie es seine Diener Hildegart und Sinan tun.
Das Ende des Alien
Er hat sie zu sich gerufen, denn sein Ende sei gekommen, schreibt er. Was seine zwei Diener verstört, ist der Befehl, die Pferde zu töten – sie hätten dann kein Mittel mehr, aus der Wüstenei am Toten Meer, wo der Blemmye seine Oase geschaffen hat, wegzukommen. Doch das Rätsel wird gelöst, als er ihnen offenbaren will, was ihn all die Jahre hier gehalten hat: seine Geliebte von den Sternen und ihre Brut. Sie hat das Zeitliche gesegnet, doch ihre Brut vermehrt sich – unter anderem durch Futter in Form von Pferdefleisch. Hildegart traut sich nicht ins Innere der Bruthöhle, doch Sinan beschreibt es als eine Art Hölle, voller Skelette und Dämonen. Dämonen mit Panzern, scharfen Zangen und giftigen Schwänzen. Nach dieser Enthüllung seiner außerirdischen Herkunft begibt sich der Blemmye in die giftigen Wasser des Toten Meeres zum leeren Panzer seiner Geliebten.
Aber Hildegart hat ein gefährliches Problem erkannt: Die Dämonenbrut werde sich über die Erde verbreiten, sollte man ihr nicht Einhalt gebieten. Sinan ist ganz ihrer Meinung. Er kennt die alte Sage vom König, der zuließ, dass ein Schachbrett mit einer sich verdoppelnden Menge von Reiskörnern bedeckt wurde. Für das letzte Feld des Bretts wurde das ganze Königreich geplündert. Eine letzte Schlacht soll die Dämonenbrut vernichten. Doch wer wird sich bereitfinden, solch einen Kampf zu wagen? Eigentlich bloß die verzweifelten Glücksritter unter den Kreuzfahrern, oder? Aber Sinan hat einen Trumpf im Ärmel …
Mein Eindruck
Auf gänzlich unerwartete Weise behandelt der Autor in dieser Novelle das Problem des Fremden und des Fremdlings. Im Heiligen Land treffen die unterschiedlichsten Völkerschaften aus Okzident und Orient aufeinander, ohne einander zu verstehen. Und doch gibt es abseits der Schlachten und Gemetzel eine funktionierende Infrastruktur für die Telekommunikation: Brieftauben. Sie gehören dem Blemmye und seinen zwei Dienern. Sie ermöglichen Handel und Reichtum trotz des Krieges. Und dabei stört es gar nicht, dass der Blemmye ein Außerirdischer ist. Er kann sich immerhin wie ein Mensch verständigen.
All dies ändert sich mit dem Ende des Aliens. Der Handel bricht zusammen, die Investitionen lösen sich in Luft auf, die Ernten werden vernichtet und so weiter. Offenbar hat er geahnt, was der Welt fehlt. Kein Wunder, denn er ist selbst vor einem Krieg mit einer Alienrasse zur Erde geflohen, und seine Geliebte gehörte eben dieser Rasse an, quasi wie Romeo und Julia. Doch ihre Dämonenbrut, die eine Metapher für den fehlenden Frieden darstellt, droht nun die Welt zu verschlingen. Es liegt nahe, dass die Sachwalter des Blemmyes die Aufgabe ihrer Vernichtung übernehmen, damit der Erde wenigstens die Heimsuchung der gefräßigen Aliens erspart bleibt.
Die Erzählung ist leicht zu lesen, aber es lohnt sich, die Geschichte des Heiligen Landes und der Kreuzzüge wenigstens rudimentär zu kennen, um die zahlreichen Namen zuordnen zu können. Erstaunlich, welche detaillierte Sachkenntnis der Autor an den Tag legt, der doch früher für abegfahrene SF-Ideen bekannt war. Die Story unterhält selbst den SF-Freund und ist spannend bis zum Schluss.
13) The Denial (2005, „Die Leugnung“)
Die Türkei im 15. oder 16. Jahrhundert, nur wenige Jahrzehnte nach der Eroberung Konstantinopels. In Yusufs kleiner Stadt leben Muslime neben Juden, Katholiken und orthodoxen Christen friedlich zusammen. Nur die Gnostiker, christliche Ketzer, wurden in die Berge getrieben und fristen ein kümmerliches Dasein.
Als eine große Flut das Dorf überschwemmt, gelingt es Yusuf, den Fassmacher, seine Kinder auf den höhergelegenen Grund von Onkel Mehmets Hütte zu bringen und so zu retten. Doch seine Frau hat ihm den Gehorsam versagt und wurde von den Fluten mitgerissen. Er findet sie danach im Uferschlamm und bringt sie zurück ins Dorf. Dort schlägt sie plötzlich Augen auf und ist wieder quicklebendig. Sofort macht sie sich an den Wiederaufbau des Hauses und seines Unternehmens.
Doch Yusuf wird trotz des erneuten Aufschwungs immer unglücklicher. Diese Frau ist offensichtlich nicht seine Frau, denn die erste Frau war eine zeternde Furie, diese aber ist sanft und lieb wie ein Lämmchen. Diese Frau hier muss eine Wiedergängerin sein. Was ist zu tun? Nur der jüdische Rabbi weiß Rat: Yusuf soll die Gnostiker in den fernen Hügeln aufsuchen. Sie sind die einzigen, die sich mit Geistern auskennen.
Nachdem ihm der Pastor der Bogomil-Familie erklärt hat, wie der gnostische Glaube aussieht, rät er ihm, seiner Frau einen Pflock durchs Herz zu treiben. Das lehnt Yusuf kategorisch ab. Der Pastor erklärt, wie es sich mit der Trennung von Körper und Seele verhält und gibt ihm einen Talisman: eine hölzerne Handfessel.
Nach seiner Rückkehr führt Yusuf seine Frau auf den Gottesacker, der einzige Ort, wie sie ungestört sind. Er legt ihr die Fessel an, die sie wie verbrannt wieder abstreift – ein gutes Zeichen. Aber er legt sie sich aus Trotz ebenfalls an: keine gute Erfahrung. Denn nun schwant ihm, was er längst hätte erkennen müssen und was ihm seine tote Frau nun wütend unter die Nase reibt: Er ist nämlich in jener Flut ebenfalls gestorben. Tja, und wie kommen sie aus diesem Schlamassel wieder raus?
Mein Eindruck
Ist dies eine Geistergeschichte, fragt man sich. Möglicherweise, denn um Magie geht es ebenfalls. Aber die Wahrheit liegt tiefer: Das eigentliche Thema ist nämlich die Entfremdung von einer Unperson, die man nicht als sich selbst zugehörig wahrnimmt. Diese Entfremdung kann in tödlichen Hass umschlagen, wenn die richtigen Faktoren und Mittel hinzukommen. Aber hätte Yusuf einmal sein Herz erforscht, dann hätte er den Splitter im eigenen Auge erkannt – dass er genauso ist wie seine Frau.
Unterm Strich
Diese Erzählungssammlung des bekannten Autors und Beraters umfasst eine große Vielfalt von Themen und Stilen, aber die verschiedenen Sektionen sind folgerichtig aufgebaut. Von „Science Fiction“ geht die Fahrt zu „Fiction about Science“ und „Fiction for Scientists“. Danach widmet sich Sterling seinen Interessensgebieten, insbesondere Architektur und Design.
Nach einer Verschnaufpause im Mainstream dreht er jedoch voll auf: „Cyberfunk to Ribofunk“ heißt die Überschrift für seine zwei großen Kollaborationen mit den Kollegen Paul Di Filippo und Rudy Rucker. Diese zwei Storys sind sowohl in der Sprache als auch hinsichtlich ihres geistigen Hintergrunds höchst anspruchsvoll für den deutschen Leser.
Lediglich ihr Plot und ihre Aussage könnte simpler nicht sein. „The Scab’s Progress“ schildert eine Expedition in ein zukünftiges Afrika, und „Junk DNA“ ist ein Märchen über die biotechnische Zukunft des Silicon Valley, das bis dahin schon seine besten Tage gesehen hat. Auch wenn dies die beiden sprachlich anspruchsvollsten Texte der Sammlung sind, so haben sie mir doch am meisten Spaß gemacht: das Vergnügen des Intellektuellen an abgefahrenen Ideen.
Die letzte Sektion trägt den Titel „The Past Is a Future That Already Happened“. Hier finden sich also Erzählungen über die Vergangenheit. Neben der Geschichte über Apepi und Yusuf beeindruckte mich besonders die Novelle über die Kreuzfahrerzeit, in der ein Alien eine offenbar segensreiche Role spielt. Die Aussage lautet mehr oder weniger, dass richtig organisierte Kommunikation für ein gewisses Maß an Frieden sorgt. Ganz gleich, ob diese Kommunikation von einem unabhängigen Fremdwesen oder von einem parteiischen Menschen organisiert wird.
Unterm Strich liefert die Collection dem SF-Interessierten und dem, der neugierig auf neue Ideen ist, einen bunten Strauß von meist gelungenen Erzählungen, in denen Unterhaltung, Einfallsreichtum und vor allem Humor und Menschlichkeit (sogar bei Leuchtkäferchen) spannend und anrührend präsentiert werden. Obwohl der Preis mit 16 US-Dollar ziemlich hoch ist, so habe ich doch den Kauf zu keiner Zeit bereut.
Der Autor vergibt: 



Taschenbuch: 294 Seiten
Originaltitel: Visionary in Residence
ISBN-13: 978-1560258414
_Bruce Sterling bei |Buchwurm.info|:_
[„Inseln im Netz“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=736
[„Die Differenzmaschine“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=1339
[„Brennendes Land“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=1542
[„The Zenith Angle“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=1574