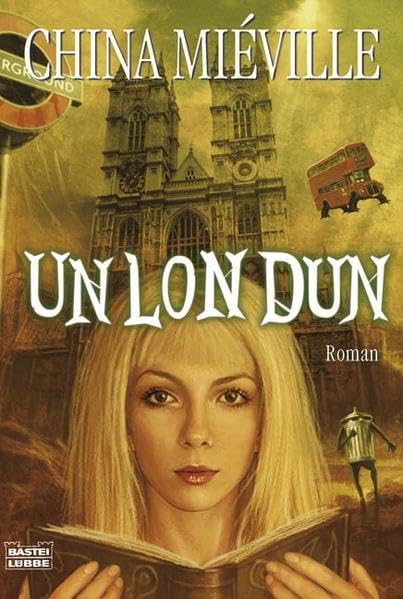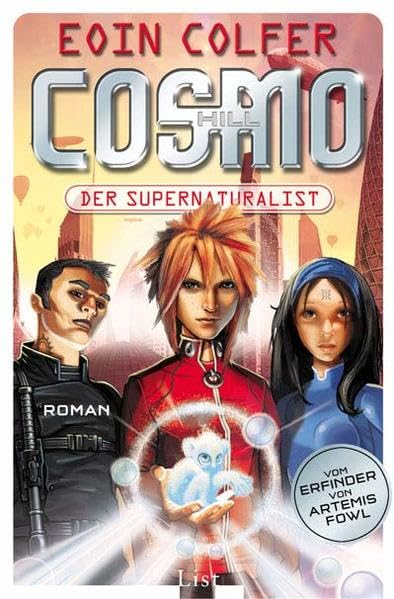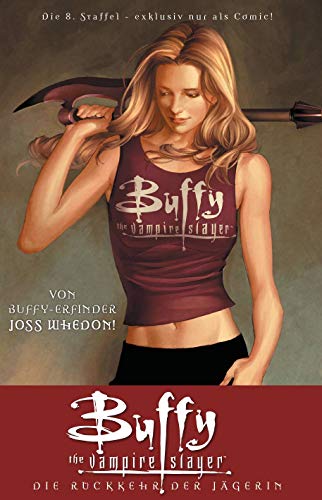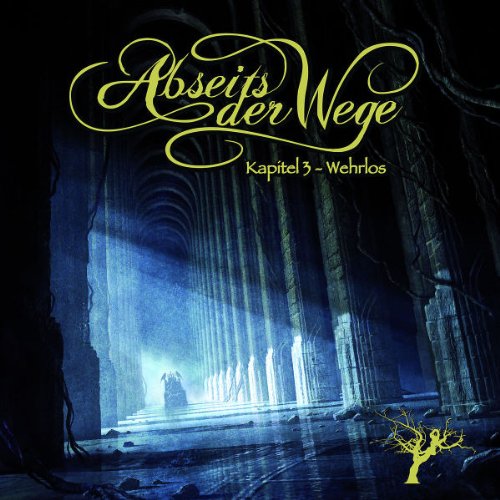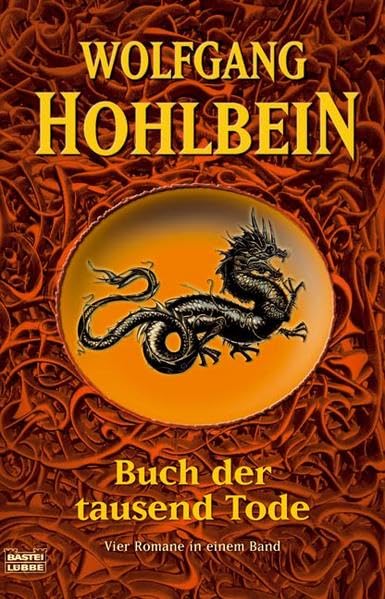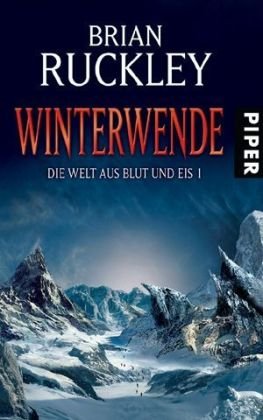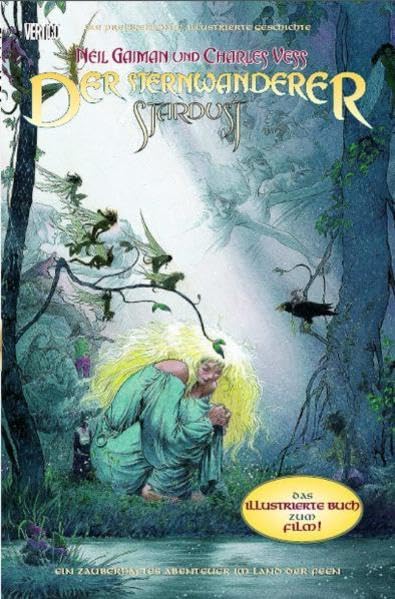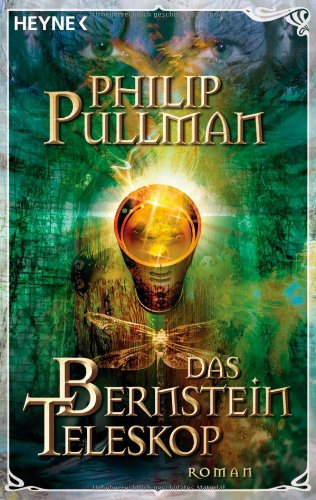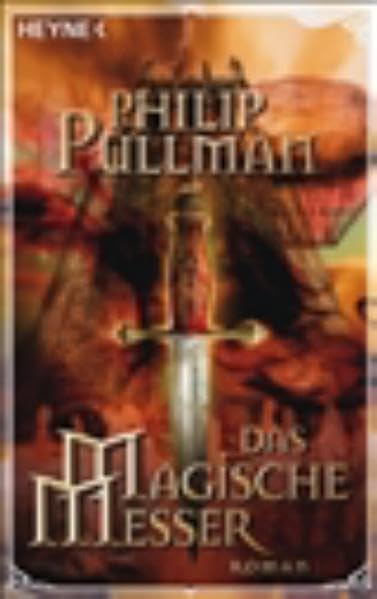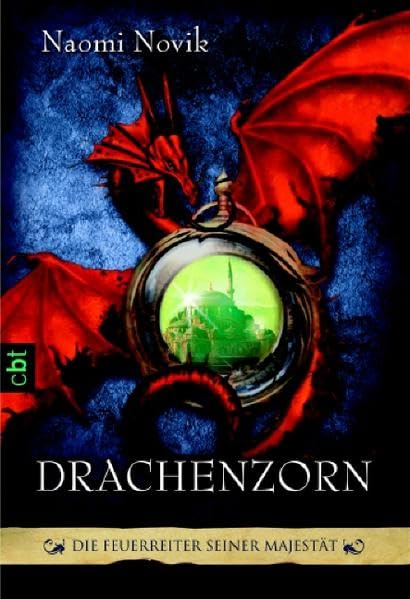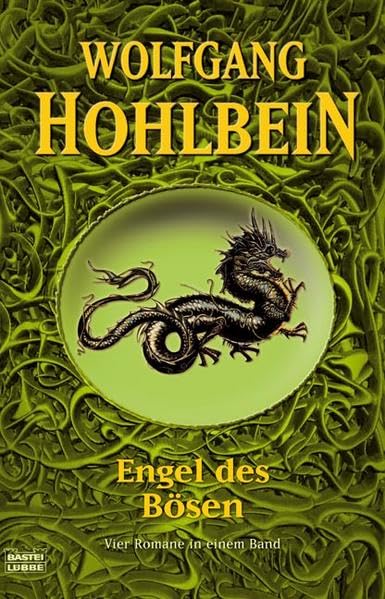Abgesehen von der Akustik sind es vor allem die Texte, die einen besonderen von einem weniger besonderen Song unterscheiden und über die sich eine Band im Musikmarkt positioniert. Wer nicht auf die zwar eingängigen, aber in der Regel oberflächlichen One-Hit-Wonders oder den Einheitsbrei von Castingbands steht, findet speziell im Sektor der etwas härteren Musik zahlreiche Künstler, die viel Wert auf ihre vermittelten Botschaften legen – und, nicht zu unterschätzen, ihre Stücke selbst schreiben. Wenn es sich nicht gerade klischeebeladene Trink- oder Machoinhalte sind, die Rock, Metal und Punk natürlich auch prägen, liegt der Fokus auf stimmungsvollen Lyrics: von metaphorischen Strophen, die viel Spielraum für eigene Interpretationen gewähren, bis hin zu ganzen Konzeptalben, die durchdacht aufgebaut eine ganze Geschichte erzählen.
Zu jenen Bands mit vielseitigen, anspruchsvollen Texten zählt die siebenköpfige Formation |Subway To Sally|, die seit 1992 mittelalterliche, historische Klänge mit harten Gitarren mischt. Die letzten Albumveröffentlichungen „Engelskrieger“, „Nord Nord Ost“ und „Bastard“ belegten vordere Chartplatzierungen, ausschweifenden Tourneen und Festivalauftritten folgte eine |Echo|-Nominierung. Den bisherigen Höhepunkt stellte die Teilnahme an Stefan Raabs |Bundesvision Song Contest| dar, den |Subway To Sally| im Februar 2008 für sich entscheiden konnte.
Obwohl Sänger Eric Fish durch seine markante Stimme und seine selbstbewusste Erscheinung im Mittelpunkt des Interessen steht, ist für das Songschreiben und damit für das wichtige Liedgut ein anderer verantwortlich: Michael Boden alias Bodenski, der seit der Bandgründung den Großteil der Texte beisteuert. Viel Material hat sich da im Laufe der Jahre angesammelt, so dass Bodenski nun in Zusammenarbeit mit dem |Egmont|- und |Schwarzer Turm|-Verlag ein Storybook konzipiert hat, das seine Arbeit als Songschreiber mit dem visuellen Medium verknüpft: Das „Subway To Sally Storybook“ enthält nämlich 19 Comics diverser Nachwuchskünstler, die sich einige der bei den Fans beliebtesten und schönsten Stücke der Folk-Rocker als Vorlage genommen und visuell umgesetzt haben.
_19 Songs, 19 Werke_
Einleitend gibt Bodenski zu jedem Comic ein paar Informationen darüber preis, wie es zu dem jeweiligen Songtext gekommen und wovon er beim Schreiben inspiriert worden ist. Obwohl nur wenige Zeilen umfassend, sind die Hinweise durchweg interessant und halten auch für langjährige Fans der Band einige neue Informationen zur Entstehungsgeschichte der einzelnen Titeln bereit. Mit den Comics haben diese einleitenden Worte aber nichts weiter zu tun, denn diese sind allein Interpretation des Zeichners – mal nah an der ursprünglichen Aussage des Textes, mal aber auch von ihr losgelöst und nur im übertragenen Sinne gezeichnet.
Sehr nah am Text hält sich Tara Starnegg mit „Unterm Galgen“, die das rund 230 Seiten dicke Buch eröffnet. Ebenso wie der Song vom „Bannkreis“-Album schildert die bebilderte Geschichte die letzten Minuten eines durch den Strick zum Tode verurteilten Menschen. Die Zeichnerin lässt den von Schaulustigen überfüllten Platz einer mittelalterlichen Stadt entstehen, konzentriert sich dabei aber vor allem auf den Ausdruck des Verurteilten. Der Wahn steht ihm ins Gesicht geschrieben, als er zum Galgen geführt wird. Immer wieder reißt er die Augen weit auf, wenn es wie im Refrain heißt: „Sterben, sterben kann ich nicht.“ Der leicht überzeichnete Mangastil wirkt passend und verleiht dem Comic eine moderne Note. Die Bilder sind in Schwarzweiß gehalten, nur sporadisch hebt Starnegg einige Motive durch leichte rote Farbtöne hervor.
So wie „Unterm Galgen“ sind auch alle anderen Comics in Schwarz, Weiß und Rot gehalten. Dadurch fällt der gesamte Band düster und, den Songtexten entsprechend, sehr poetisch aus. Nicht immer jedoch wird die rote Farbe als zusätzliche Nuance nur spärlich eingesetzt. „Feuerkind“ von Julia Schlax geizt nicht mit roten Tönen, als am Ende des Songs und damit auch dem Ende des Comics das knisternde Feuer hervorbricht. Auch Caroline Sander, die die Bilder zu „Minne“ beisteuert, offenbart ihr Faible für diese Farbe und lässt anschaulich die umworbenen Schönheiten mit blutig-roten Lippen erstrahlen.
So ähnlich wie die Farbgestaltung bei den Comics auch ausfällt und diese miteinander verbindet, so unterschiedlich sind die Zeichenstile, die das „Subway To Sally Storybook“ in diesem Band vereint. Beeindruckend plastisch kommt etwa Iona Haiducs Version der „Henkersbraut“ daher: realistische Konturen gemischt mit einem leicht japanischen Zeichenstil. Grotesk dagegen fällt die „Arche“ von Annelie Kretzschmar aus. Statt Bilderabfolgen reizt sie mit großformatigen Motiven die zur Verfügung stehenden Doppelseiten aus und füllt das Schiff, der nicht gerade bibeltreuen |Subway To Sally|-Arche angemessen, mit menschlichem Wahnsinn und Verderben. „Kleid aus Rosen“ von Katharina Niko geht wiederum minimalistisch vor, stellt vor allem die Hauptfigur des Songtextes in den Vordergrund und lässt den Hintergrund bewusst schwammig. Damit gelingt es ihr, die abschließende Pointe als zentrales Motiv ihres Comics hervorzuheben.
Nicht jeder Comic ist auf gleich hohem Niveau angesiedelt. Durch die unterschiedlichen Stile bietet der Band aber genügend Auswahl für seine eigenen Favoriten, die je nach persönlichem Geschmack unterschiedlich ausfallen dürften. Die einzelnen Interpretationen entsprechen auch nur selten den eigenen. Das ist jedoch weniger schlimm, da die eigenen Bilder beim Hörer der Stücke durch die Comics nicht zerstört werden – ganz im Gegenteil zu Filmumsetzungen, die nach der Filmbetrachtung die Lektüre guter Buchvorlagen erschweren. So ist das Storybook also vielmehr als nette Ergänzung zu verstehen, um beim Hören der Songs entspannt mitzulesen. Wer sich schon immer für die Songtexte interessiert hat und auf die visuellen Umsetzungen neugierig ist, bekommt ein schönes Buch geliefert, das jeden |Subway To Sally|-Fan und solche, die es noch werden wollen, zufriedenstellt. Obligatorisch ist es aber nicht, denn |Subway To Sallys| Musik liefert auch ohne Comic als Stütze Bilder im Kopf.
http://www.ehapa-comic-collection.de
http://www.manganet.de
http://www.subwaytosally.de