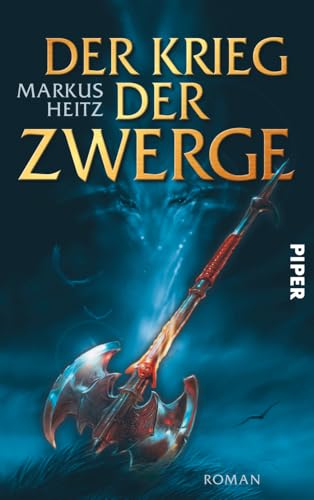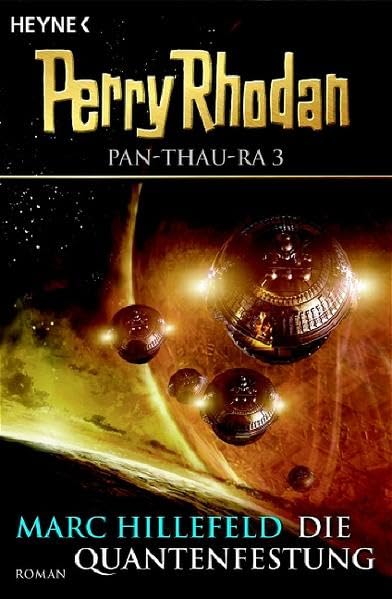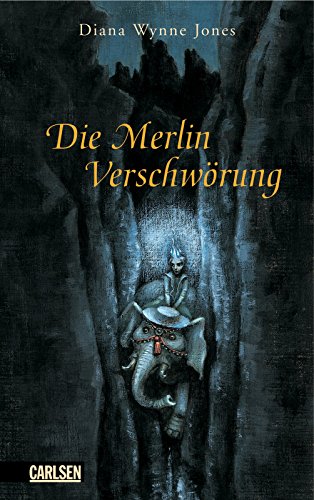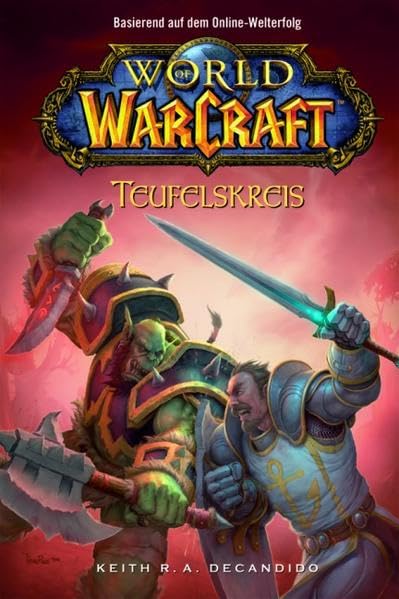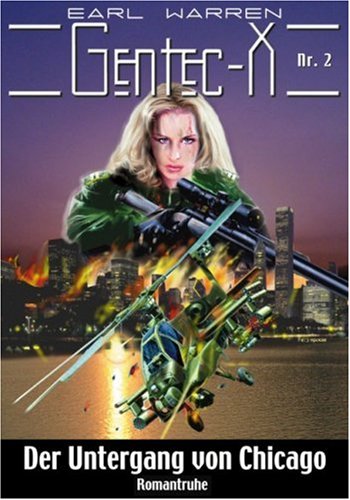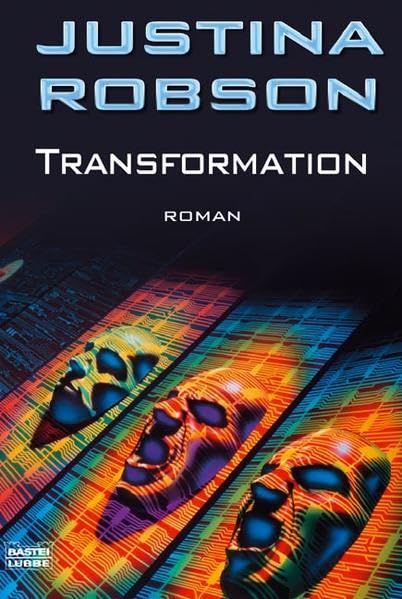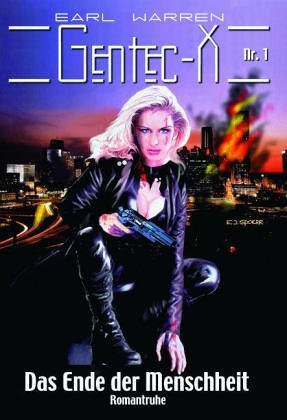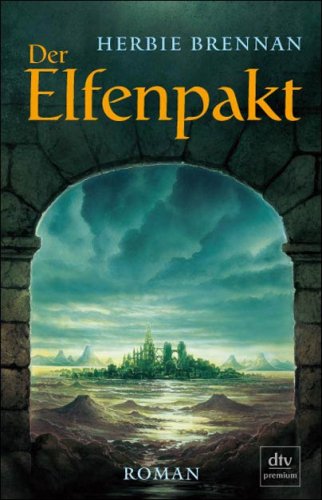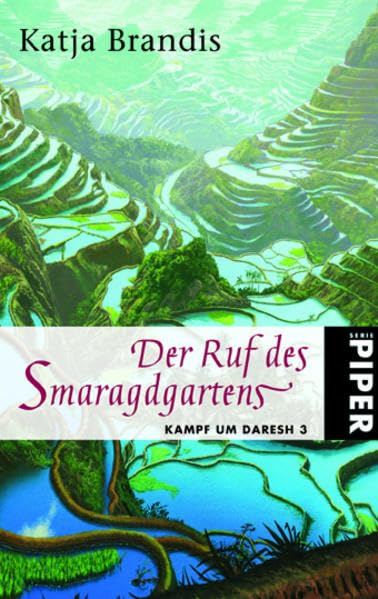Band 1: „Die Rebellin“
Band 2: „Die Novizin“
Band 3: „Die Meisterin“
Sonea hat nach ihrem Zweikampf in der Arena tatsächlich Ruhe vor Regin. Dafür belasten sie andere Sorgen: Der Hohe Lord Akkarin gibt ihr Bücher über schwarze Magie zu lesen! Allein das wäre bereits ein Verbrechen, für das die Gilde sie ausstoßen könnte. Doch zu ihrer Überraschung erfährt Sonea bald darauf die Gründe für das Geheimnis des Hohen Lords. Das lässt nicht nur ihre Vorbehalten gegen ihn schwinden, sie besteht sogar darauf, ihn dabei zu unterstützen.
Doch die Gilde hat inzwischen Akkarins Geheimnis entdeckt. Sie werden nicht nur aus der Gilde ausgestoßen, sondern auch aus den Verbündeten Königreichen verbannt. Ihnen bleibt nur der Weg nach Sachaka, dem Land, von dem nicht nur Akkarin und Sonea die größte Gefahr droht, sondern auch der Gilde und den Verbündeten Königreichen. Als Akkarin und Sonea sich endlich zum Südpass durchgeschlagen haben und wieder kyralischen Boden betreten, um den König und die Gilde zu warnen, ist es bereits zu spät …
An neuen Charakteren kommen in diesem dritten Band nicht mehr viele dazu, und die meisten bleiben eine Randerscheinung.
Als Einzige nimmt Savara etwas mehr Raum ein. Sie ist eine Sachakanerin, die Cery Hilfe gegen die Mörder anbietet, die Imardin immer wieder von neuem unsicher machen. Warum sie das tut, oder wer genau sie ist, verrät sie nicht. Aber sie ist offensichtlich eine ausgebildete Magierin, und sie kann hervorragend kämpfen. Gleichzeitig besitzt sie durchaus einen gewissen Sinn für Humor, und nebenbei wickelt sie Cery gehörig um den Finger. Die Frage ist nur: Kann man ihr trauen?
Auch Cery nimmt durch Savaras Auftauchen wieder mehr Raum in der Geschichte ein. Er ist selbstbewusster geworden, gleichzeitig hat er sich weitgehend von seinen alten Gefühlen für Sonea gelöst, wenn er auch immer noch Freundschaft und Beschützerinstinkte besitzt.
Den größten Wandel im Charakter macht Regin durch. Nicht nur, dass er nach dem Duell geradezu zahm geworden ist; nachdem die mit Sonea verbündeten Diebe ihn vor den Sachakanern gerettet haben, entschuldigt er sich bei Sonea für sein früheres Verhalten. Mir kam es allerdings seltsam vor, dass er für Sonea plötzlich Mitleid empfand, nur weil sie monatelang sozusagen Akkarins Geisel war! Kann das allein all den Hass, den er zuvor ganz offensichtlich für Sonea hegte, einfach ausgelöscht haben? Immerhin hat er ihr nicht nur ein paar kleine, fiese Streiche gespielt, er hat sie richtig gequält, und zwar mit Inbrunst! Dieser Sinneswandel erschien mir dann doch etwas dick aufgetragen …
Die Handlung ist diesmal nicht mehr so deutlich zweigeteilt wie bisher. Zwar ist Dannyl auch diesmal wieder in Elyne unterwegs, doch das Ausheben einer kleinen Rebellengruppe erscheint im Vergleich zur Handlung um Sonea und Akkarin eher nebensächlich. Dafür teilt sich die Handlung nach der Verbannung des Hohen Lords und seiner Schülerin gleich in mehrere Stränge, die letztlich alle auf den „Showdown“ in Imardin zulaufen. Das gibt ein ziemliches Um-einander-herum-Gewusel oberhalb und unterhalb der Straßen Imardins, und natürlich bleibt es nicht aus, dass im Kampf gegen die Sachakaner immer wieder einer der Beteiligten in brenzlige Situationen gerät. In der Regel werden diese Bedrohungen jedoch rasch aufgelöst, was nicht heißen soll, dass alle mit heiler Haut davonkommen. Im Gegenteil hat die Autorin keine Skrupel, einige ihrer Sympathieträger zu opfern, was dafür sorgt, dass die Spannung der verschiedenen Scharmützel nicht einfach verpufft. Was ich allerdings nicht verstehen konnte: Warum wollte Akkarin die Schutzmagie der Arenakuppel nicht benutzen? In einem Kampf, der so auf Messers Schneide stand, sollte man doch erwarten, dass die Beteiligten jede Kraftquelle nutzen würden, derer sie habhaft werden konnten!
Wie dem auch sei: Der dritte Band ist der komplexeste und auch der spannendste der drei. Dass Sonea und Akkarin sich letztlich ineinander verlieben würden, war wohl unausweichlich, immerhin war er der geheimnisvollste und faszinierendste Charakter unter den Männern und sie aufgrund ihrer Herkunft und überdurchschnittlichen Kraft ebenfalls etwas Besonderes. Andererseits hat uns die Autorin dabei zu jeder Zeit jeglichen Kitsch erspart, insofern wirkte dieses Detail nicht störend.
Dafür ist mir ein anderer Knacks deutlich aufgefallen: Als Sonea ihre Tante und ihren Onkel besucht, erfährt sie zum ersten Mal von den Morden in der Stadt. Das wunderte mich doch ein wenig, da Sonea ja erst vor zwei Jahren in die Gilde eingetreten ist. Die Morde begannen aber laut Akkarin kurz nach seiner Ernennung zum Hohen Lord, und das war bereits fünf Jahre her. Für die innere Logik des Handlungsverlaufs ist das jedoch nicht weiter von Belang, insofern sei darüber hinweggesehen.
Das Lektorat war angenehm fehlerfrei. Warum Bertelsmann allerdings zwei verschiedene Ausgaben für Erwachsene und Jugendliche herausgebracht hat, ist mir nicht ganz klar, denn Unterschiede gibt es offenbar nur in der äußeren Gestaltung, und die sind nicht besonders gravierend. Befürchtet der Verlag, Erwachsene würden die Jugendausgabe nicht lesen, wenn |cbt| draufsteht? Dann wären die potenziellen Käufer eigentlich selber schuld.
Für den Gesamtzyklus lässt sich sagen, dass er vielleicht nicht das Mitreißendste oder Fantasievollste war, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Dafür waren die meisten Figuren und Ereignisse doch ein wenig zu schablonenhaft und der Spannungsbogen hätte gelegentlich etwas mehr Straffung vertragen. Das hat sich zum Ende hin aber durchaus gesteigert, die Personen lösten sich ein wenig aus ihren Schienen, der Spannungsbogen zog tatsächlich an. Dafür musste die Autorin nicht einmal Ströme von Blut bemühen, im Gegenteil. Sowohl die beschriebenen Morde als auch der Guerillakampf in den Straßen von Imardin kommen ganz ohne rote Pfützen aus.
Alles in allem war Die Gilde der schwarzen Magier angenehme und leichte Unterhaltung. Ich würde sagen, Trudi Canavan kann problemlos vorne im großen Mittelfeld der Fantasy mithalten. Und vielleicht steigert sie sich ja auch noch. Im Hinblick auf die geplante Fortsetzung wäre Savara eine Figur mit einer Menge Potenzial …
Trudy Canavan stammt aus Australien, wo sie nach einem Studium am Melbourne College of Decoration als Designerin, Illustratorin und Kartenzeichnerin für verschiedene Verlage tätig war, ehe sie zu schreiben begann. 1999 gewann sie mit ihrer Kurzgeschichte „Whispers of the Mist Children“ den |Aurealis Award for Best Fantasy Short Story|. 2001 erschien dann ihr erster Roman, der erste Band der Trilogie |Die Gilde der schwarzen Magier|. Inzwischen hat sie mit |Age of Five| eine weitere Trilogie geschrieben, die aber bisher nur im englischsprachigen Raum erschienen ist. Derzeit arbeitet sie an „The Magician’s Apprentice“, einem Prequel zur Magiertrilogie. Auch ein Sequel soll folgen.
Taschenbuch 700 Seiten
Originaltitel: The High Lord
Deutsch von Michaela Link
ISBN-13: 978-3-570-30330-6
http://www.trudicanavan.com/
http://www.randomhouse.de/cbj/
Der Autor vergibt: