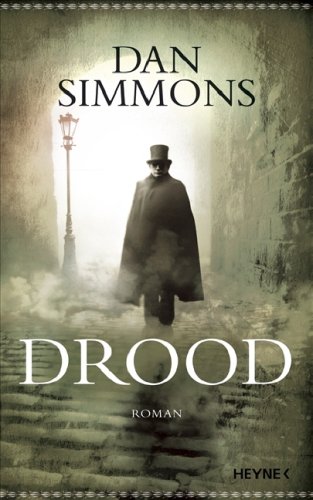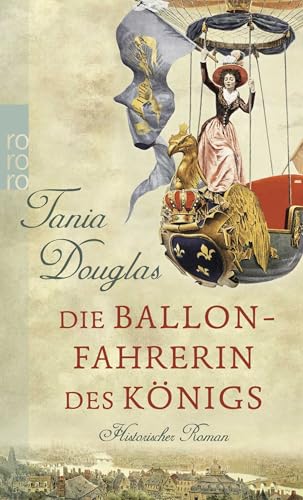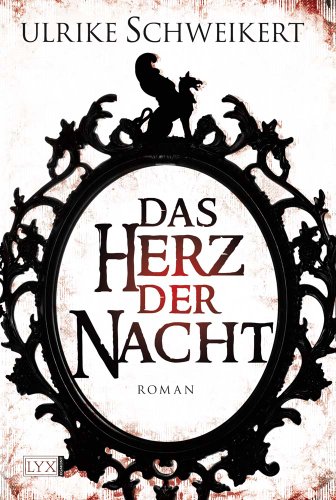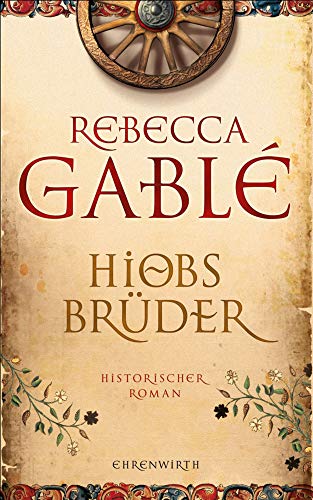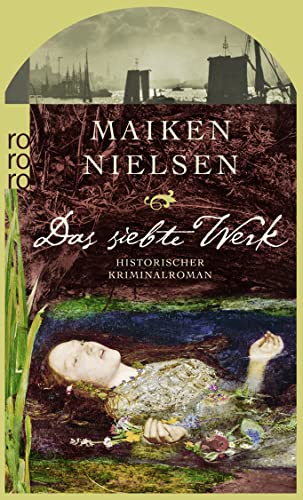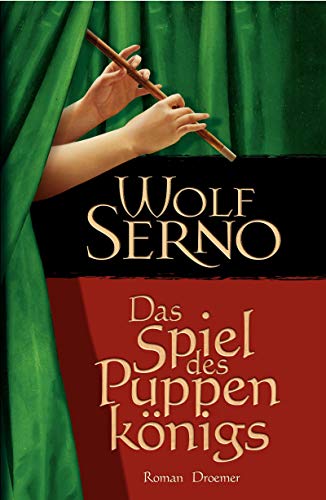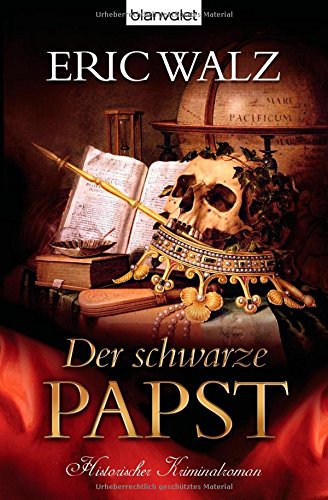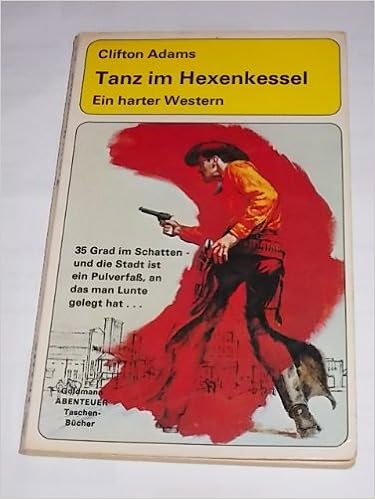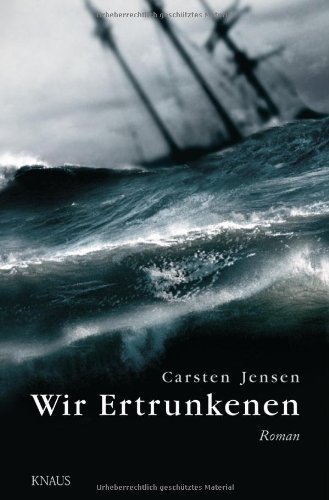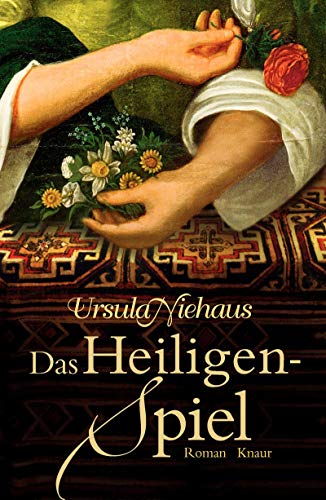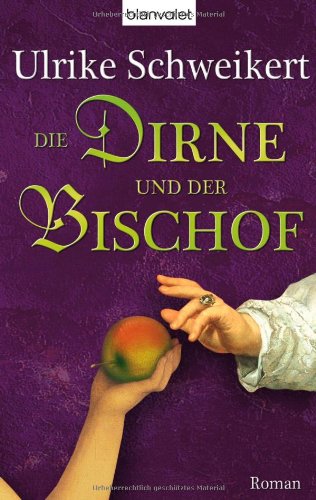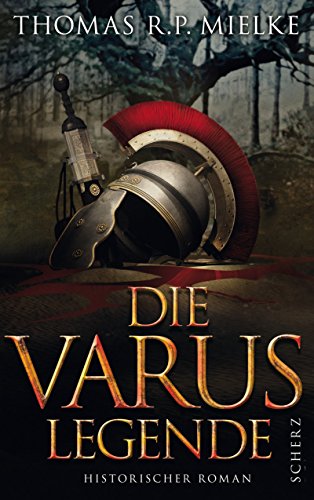1288, im südfranzösischen Dorf Cantimpré: Während Pater Guillem Aba gerade die Dorfkinder unterrichtet, stürmt ein Trupp schwarz gekleideter Männer in das Pfarrhaus, tötet einen Jungen, verletzt den Pater schwer und entführt den kleinen Perrot, von dem nur der Pater und die Mutter des Kindes wissen, dass er die Fähigkeit besitzt, andere zu heilen. Kaum hat sich Pater Aba von seinen schlimmsten Wunden erholt, macht er sich auf die Suche nach den Tätern und findet heraus, dass Perrot nur eines von vielen entführten Kindern in der Gegend ist.
In Rom führt zur gleichen Zeit ein junger Gelehrter einen Laden mit der Aufschrift „Benedetto hat auf alles eine Antwort“. Tatsächlich ist Benedetto Gui außergewöhnlich belesen, hat ein phänomenales Gedächtnis und hat bisher jedes Geheimnis entschlüsselt. Außerdem hat er ein Herz für die Armen, denen er gerne hilft.
Jetzt bittet ihn ein junges Mädchen, ihren siebzehnjährigen Bruder Rainero zu finden, der seit Tagen verschwunden ist. Rainero arbeitete im Lateranspalast für den Advocatus Diaboli – den Kirchenanwalt, der als kritische Instanz bei den Verfahren zur Heiligsprechung auftritt. Schon bald ahnt Benedetto, dass Rainero offenbar in eine groß angelegte Kirchenverschwörung geraten ist und dass es einen Zusammenhang zu den Kindesentführern gibt, die Pater Aba verfolgt …
_Schon sein Bestseller_ [„Das dreizehnte Dorf“ 276 spielte im 13. Jahrhundert, sodass Romain Sardou mit der Zeit des Hochmittelalters gut vertraut ist und mit einzelnen Orten und Personen eine Verbindung herstellt, auch wenn es sich um keine direkte Fortsetzung handelt.
|Spannung und Dramatik|
Kirchenverschwörungen sind ein dankbares Thema für Historienthriller und schon gleich zu Beginn wird der Leser mit der machtgierigen und verräterischen Welt des Vatikans konfrontiert. Die Handlung wechselt immer wieder zwischen zwei Strängen: Da ist einmal Benedetto Gui, der sich auf die Suche nach Rainero begibt und dabei den Intrigen des Laterans gefährlich nahe kommt. Sein Weg führt ihn in Skriptorien, zu hilfreichen Verbündeten, lässt ihn in Verkleidungen schlüpfen und immer wieder um sein Leben fürchten. Auch Pater Aba reist zeitweise inkognito und immer neue Enthüllungen verändern die Zusammenhänge. Die Geschichte spielt nicht nur in Rom und in Cantimpré, sondern auch durch Böhmen, Latium, Umbrien und Ancona, bis alle Fäden wieder in Rom zusammen laufen. Spannend sind vor allem die Fragen, ob Rainero noch am Leben ist, ob er fliehen musste oder beiseite geschafft wurde, ob Pater Aba den kleinen Perrot retten kann und was genau hinter der Entführung der Wunderkinder steckt. Mehrfach sterben Menschen, von denen es man nicht unbedingt erwartet hätte, sodass ein guter Ausgang nicht gewährleistet ist, und es gibt Wendungen, die manch einen Charakter als anders präsentieren, als man zunächst dachte. Interessant sind nicht nur die Machtspielchen der hohen Würdenträger, sondern auch die Thematiken rund um die Wunderkinder und um die Heiligenverehrung, die schon damals die Lager spalteten.
|Gelungene Charaktere|
Benedetto Gui ist die erste Hauptfigur des Romans und ein sehr sympathischer Zeitgenosse. Mit stoischer Gelassenheit kommt er jedem Rätsel auf die Spur und er genießt unter der Armenbevölkerung Roms eine ehrfürchtige Bewunderung. Er befasst sich hauptsächlich mit Testamentsstreitigkeiten, Verträgen mit für Laien undurchschaubaren Klauseln und verschlüsselten Nachrichten und komplizierten Übersetzungen, hat aber auch ein detektivisches Gespür. Bei all seiner Gelehrsamkeit besitzt er auch über eine gesunde Portion Humor, die ihn immer wieder zu augenzwinkernden Bemerkungen verleitet und den Leser rasch für ihn einnimmt. Lange Zeit im Dunkeln bleibt dagegen seine Vergangenheit, immer wieder nur vage angedeutet durch die Trauer über seine verstorbene Frau, der er immer noch treu ist und auch wenn man im weiteren Verlauf der Handlung ein bisschen mehr darüber erfährt, wird dieser Aspekt nie ausgiebig thematisiert. Mit seinem fofografischen Gedächtnis und seiner Kombinationsgabe, die ihn ausgerechnet beim wichtigsten Fall seines Lebens, der Aufklärung des Mordes an seiner Frau, im Stich lässt, erinnert er die Leser womöglich ein wenig an die Titelfigur der Krimiserie „Monk“, ohne allerdings über dessen Schrullen zu verfügen.
Ein gelungener Gegenpart zu ihm ist der Protagonist der Parallelhandlung, Pater Guillem Aba. Zu Beginn des Geschehens ist er ein beliebter Geistlicher von fast engelhafter Schönheit, dessen Leben sich binnen weniger Minuten schlagartig wandelt. Die vermummten Eindringlinge töten nicht nur ein Kind vor seinen Augen und entführen ein weiteres, sondern verletzen ihn auch noch so schwer, dass er tagelang ums Überleben kämpfen muss. Vom Überfall trägt er ein von Narben gezeichnetes Gesicht davon und sein Auge muss ihm in einer schmerzhaften Operation entfernt werden. Am stärksten verletzt ist aber seine Seele, denn nur Perrots Mutter weiß, dass der entführte Junge tatsächlich sein Sohn ist. Der Versuch, Perrot wieder zu finden wird zu Abas Lebensinhalt, der gerne bereit ist, sein Leben aufs Spiel zu setzen, und die Verwandlung vom friedfertigen Geistlichen zum düsteren Racheengel ist trotz 180-Grad-Wandlung überzeugend.
|Kleine Schwächen|
Wer sich auf Einblicke in das Kirchenwesen des Mittelalters freut, wird mit Sicherheit zufrieden gestellt – wer aber das Alltagsleben der Zeit kennenlernen möchte, wird unter Umständen enttäuscht. Der Roman verbringt nicht viel Zeit damit, dem Leser Details zu präsentieren, die nicht unmittelbar wichtig für die Handlung sind. Sei es nun, dass man erfahren möchte, was die Menschen damals gegessen haben, wie sie ihren Berufen nachgingen, wie sie eingerichtet sind, das alles wird nur angedeutet oder gar nicht näher beleuchtet. Schade ist das beispielsweise, wenn mehrfach Medizin hergestellt wird, über deren genaue Zusammensetzung der Leser aber nichts erfährt. Das führt dazu, dass das Bild des Mittelalters abseits des Kirchenwesens ein wenig blass bleibt. Das Ende kommt ein bisschen überhastet daher im Vergleich zur vorherigen Handlung. Die Hintergründe des Kompolotts werden so zusammen gefasst, dass dem Leser keine Fragen offen bleiben, allerdings erscheint diese kompakte Präsentation der Zusammenhänge zu gerafft, als habe die Zeit für das letzte Kapitel gefehlt. Stilistisch fällt der übertrieben häufige Gebrauch der Formulung „er erbleichte“ auf, was gerade bei vergleichsweise harmlosen Szenen zu aufgesetzt wirkt. Ein Schnitzer unterlief dem Autor außerdem bei einer Formulierung, in der Pater Aba sich etwas „vor seinen Augen auftat“ – obwohl er doch zu diesem Zeitpunkt nur noch über ein Auge verfügt, was auch noch auf der gleichen Seite eine Rolle spielt.
_Als Fazit_ bleibt ein unterhaltsamer Historienthriller, der im Spätmittelalter spielt. Die Handlung überzeugt vor allem durch die beiden Hauptfiguren und Spannung, der Lesegenuss wird allerdings durch ein paar Kleinigkeiten geschmälert. Empfehlenswert für alle, die Kirchenkrimis aus dem Mittelalter mögen.
_Der Autor_ Romain Sardou wurde 1974 in Boulogne-Billancourt als Sohn des Sängers Michel Sardou geboren. Er arbeitete an der Oper, am Theater und als Drehbuchautor in Los Angeles, ehe er sich dem Romanschreiben widmete. 2004 gelang ihm gleich mit seinem Debütwerk „Das dreizehnte Dorf“ der internationale Durchbruch. Weitere Werke sind: „Salomons Schrein“, [„Kein Entrinnen“ 4566 , „Der kleine Weihnachtsmann“ und „Rettet Weihnachten“.
|Gebundene Ausgabe: 448 Seiten
ISBN-13: 978-3896673688
Originaltitel: Delivrez-nous du mal
Deutsch von Hanna van Laak|
http://www.romainsardou.com/