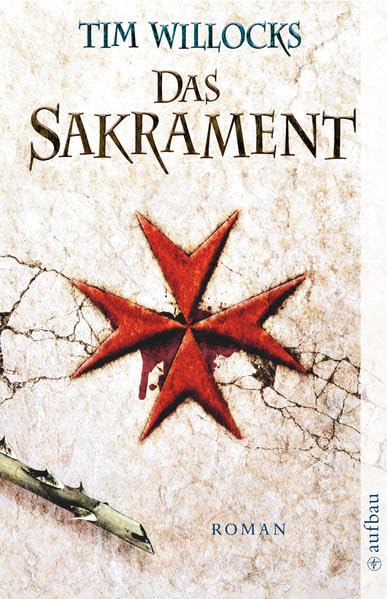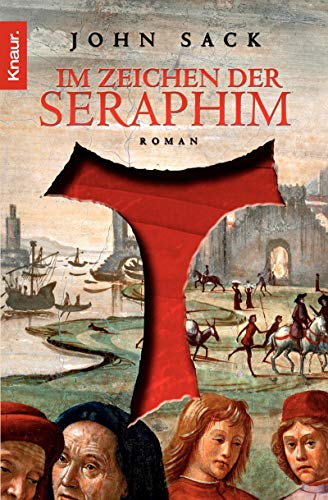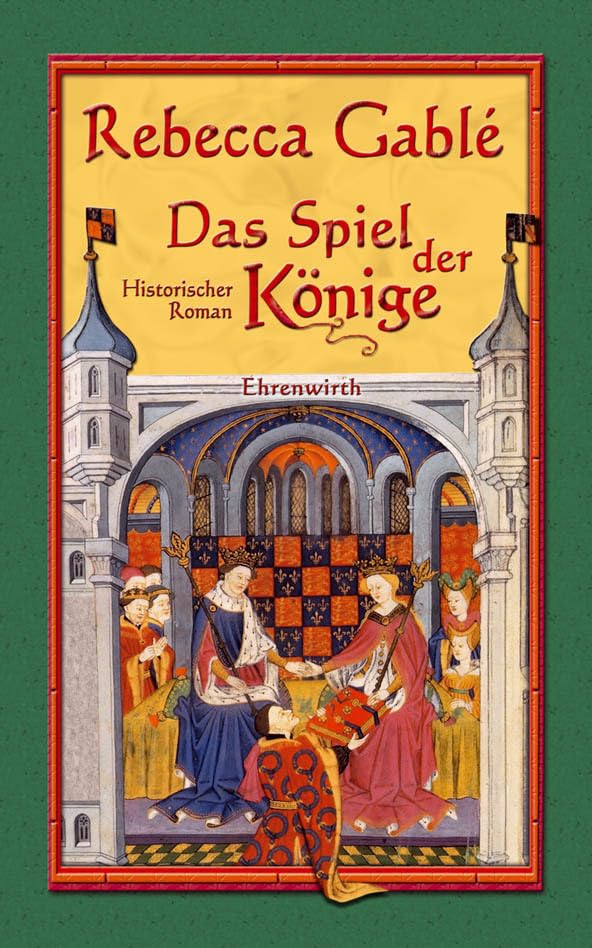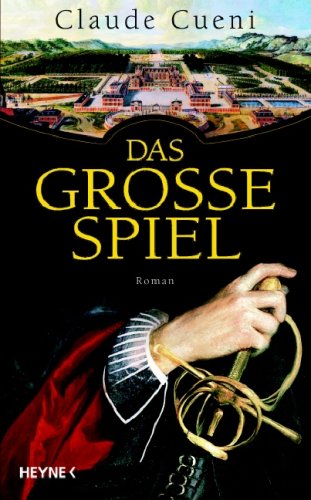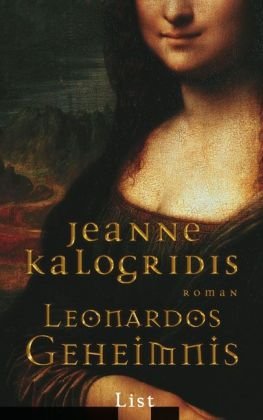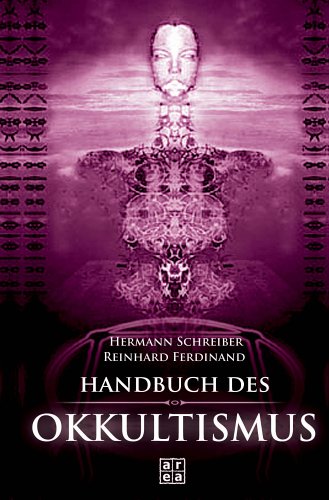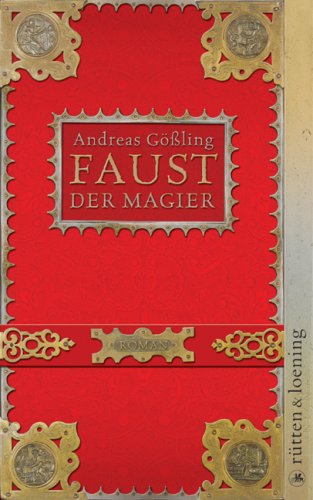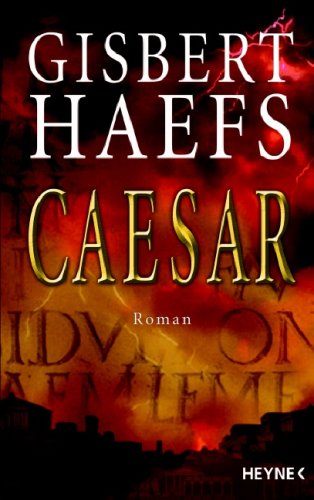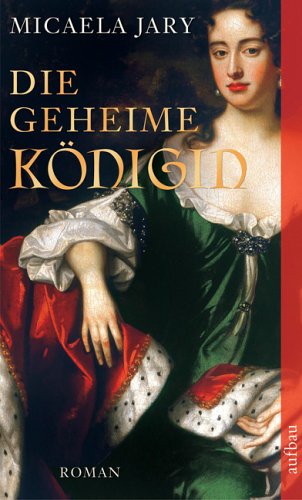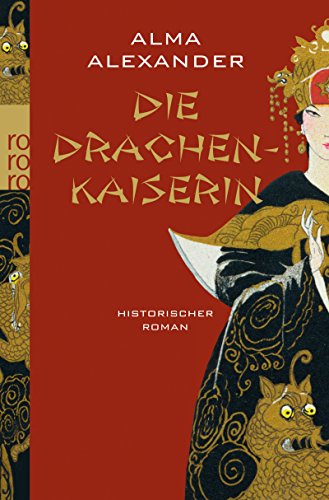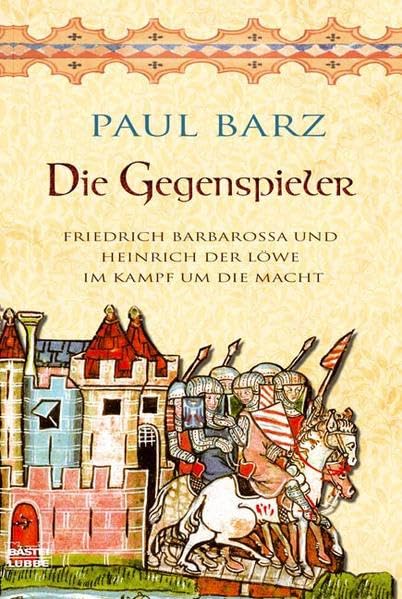Malta: Etwas weiter im Süden Europas gelegen als das italienische Sizilien, findet man diese Insel im Mittelmeer. Malta war immer schon ein strategisch wichtiges Bollwerk für eine Vielzahl von Völkern und Kulturen. Phönizier, Römer und auch die Spanier bauten die Insel zu einer scheinbar uneinnehmbaren Festung aus. Rund um die Küstenlinie säumen Festungen und Schanzen die Grenze zum Meer.
„Das Sakrament“ von Tim Willocks schildert die Belagerung Maltas im Jahre 1565. Auf der Insel haben die Ritter vom Johanniterorden, später bekannt als der Malteserorden, ihren Stützpunkt errichtet. Nach dem Verlust und der Vertreibung von der griechischen Insel Rhodos sind sie nicht gewillt, den Osmanen die letzte Grenze Europas kampflos zu überlassen.
_Die Geschichte_
Matthias Tannhäuser, der Sohn eines sächsischen Schmiedes, dessen Familie in die Karpaten ausgewandert ist, muss mit ansehen, wie seine Schwester und Mutter von den eindringenden Türken vergewaltigt und ermordet werden. Mit dem Mut und dem Schock, die ihn umfangen, imponiert er einem General, der ihn osmanisch erzieht und Matthias zu einem Janitscharen formt. Die Janitscharen waren die Elitetruppe und persönliche Leibwache des Sultans. Rekrutiert wurden diese zumeist aus eroberten Ländern. Griechen, Bulgaren, Serben und viele andere Christen wurden islamisch umerzogen und bis zum 24. oder 25. Lebensjahr ausgebildet.
Doch Matthias entsagt später dem osmanischen Glauben und sagt sich los, desillusioniert und egoistisch baut er sich in Sizilien ein legales und ein illegales Handelsnetz auf. Tannhäuser ist politisch vollkommen neutral und nur am Profit interessiert. Zugleich respektiert und gefürchtet, macht ihn das für den Johanniterorden außerordentlich interessant. Mit einer List versuchen die Ritter vom Orden der Johanniter, Matthias für sich zu gewinnen. Seine Kenntnisse als erfahrener und kampferprobter Janitschare könnten dabei helfen, die Festung Malta vor den anrückenden Osmanen zu stärken.
Die List kommt daher in Form einer schönen Frau des Wegs, der Contessa Carla, die ihn bittet, ihren vermissten Sohn, den sie nach der Geburt nie wieder gesehen hat, auf der Insel zu finden und zurückzubringen. Matthias willigt ein unter der Voraussetzung, die Contessa später zu heiraten, da ihm dann ein Adelstitel zustünde. Ein reines Geschäft für den Kaufmann, der zusammen mit seinem britischen Partner Bors von Carlisl aufbricht, um sich diesen Titel zu verdienen.
Zusammen mit der Contessa und ihrer Dienerin Ampara machen sie sich auf den Weg nach Malta. Tannhäuser findet sich schnell inmitten der Schlacht um Malta wieder, aber nicht nur diese wird ihren Tribut fordern. Malta ist schon längst von hohem politischem Interesse geworden für den Vatikan und den Spaniern. Der „Botschafter“ und Inquisitor Ludovico, den Tannhäuser kennt und verabscheut, hat persönliche Interessen daran, dass Malta als Bastion Christi entweder fällt oder aber durch seine Hilfe und seinen Einfluss gerettet wird. Tannhäuser ist dies alles recht egal, er hat seine eigenen Pläne, weiß aber auch, dass die Konfrontation mit Ludovico stattfinden wird, schließlich hat dieser einen seiner Freunde und Gelehrten auf den Scheiterhaufen gebracht und als Ketzer verbrannt.
Es kommt schließlich, wie es kommen muss und sollte. Der Plan der Johanniter geht auf und Tannhäuser findet sich auf dem Schlachtfeld wieder. Die Osmanen rücken mit 30.000 Soldaten an, dieser Streitmacht stehen nur 700 Ordensritter und etwa 8.500 Malteser entgegen. Der Großmeister Jean de la Vallette, ein grandioser, aber auch skrupelloser Taktiker, sieht sich gezwungen, die Insel mit allen Mitteln zu verteidigen. Für jeden Tag der Belagerung wird ein Moslem auf der Festungsmauer vor den Augen der Osmanen gehängt., egal, ob dieser nun ein Kriegsgefangener ist oder früher schon auf der Insel gelebt hat. Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt, und das nehmen alle Beteiligten mehr als nur ernst.
Tannhäuser macht sich auf, den Sohn der Comtessa zu suchen, und was er findet, wird seine Opfer fordern …
_Kritik_
Tim Willocks legt hier mit seinem Genre-Debüt „Das Sakrament“ einen großartigen historischen Roman vor. Willocks Gespür für die historische Komplexität ist brillant und verleiht dem Roman eine eindrucksvolle Atmosphäre von der ersten bis zur letzten Seite. „Das Sakrament“ ist ein klassisches Drama mit viel Sinn fürs Detail. Willocks beschreibt alle Situationen in allen Facetten. Nicht nur die vielen Kämpfe werden in ihrem Ablauf und historischen Detailreichtum einwandfrei erzählt, auch nimmt sich der Autor viel Raum und Zeit, um die schönen Insel, die Natur und die Ortschaften zu beschrieben.
Der Leser fiebert förmlich mit Willocks Hauptpersonen mit und hat stets das Gefühl, selbst am Geschehen beteiligt zu sein. Das ist emotional absolut ansprechend geschrieben. Die Protagonisten sind stark beschrieben und überaus durchdacht angelegt. Matthias Tannhäuser als Hauptfigur wird nicht nur einseitig dargestellt, auch seine Entmenschlichung und seine egoistische Seite werden detailliert geschildert. Er ist ein Wanderer zwischen den Welten; osmanisch erzogen und nun wieder mehrere Jahre in der christlichen Welt lebend, fühlt er sich hin- und hergerissen zwischen Verstand und Gefühl.
Die Contessa Carla und ihre hellsichtige Dienerin Amparo bestechen zunächst durch ihre Attraktivität. Aber auch diese erfahren im Laufe der Handlung eine Wandlung, der sie sich nicht erziehen können. Tannhäusers Gegenspieler, der Inquisitor Ludovico, ist durchtrieben und grausam genug für einen mächtigen Mann der Kirche. Auch aus der ‚zweiten Reihe‘ heraus hat er viel Einfluss auf die politische Lage und das Schicksal der Menschen, die nur an Gott glauben wollen und sich eigentlich beschützt und behütet wähnen. Das Schicksal der Charaktere ist dabei nicht unbedingt vorgezeichnet. Tim Willocks hat viele kleine Überraschungen in seine Geschichte eingebaut, die das Buch umso lebendiger machen.
Der reale Hintergrund wie auch die historischen Charaktere bilden die Basis des Romans. Schon allein, wie die Ritter und die Malteser auf den Festungsmauern stehen, kämpfen und sterben, erobern und zurückgeschlagen werden, wird zwar blutig und detailreich geschildert, gehört aber zur Handlung unmittelbar dazu, gerade weil die Hauptpersonen mit all ihren Ängsten und Hoffnungen daran teilnehmen müssen.
Die Kampfszenen sind drastisch und glaubwürdig, aber es sind die Szenen im Hospital, die Verwundeten, Sterbenden, die im Gedächtnis bleiben. Die Contessa Carla opfert sich beinahe auf und macht es sich zur Aufgabe, die Opfer zu pflegen oder sie sanft in den Tod zu begleiten. Sie wird vom egoistischen unnahbaren Charakter zu einer starken, aufopfernden Frau.
Die Tragik der Geschichte findet sich wieder in der Person von Ludovico. Auch dieser wandelt sich, muss sich wandeln, und das ganz überraschend. Entgegen aller Klischees eines klassischen Bösewichts gibt es um diese Figur zutiefst bewegende Szenen.
Der Roman bietet eindringliche Porträts historischer Figuren, unter anderem das des Jean de la Vallette, Hochmeister des Malteserordens. Vallette ist brillanter Taktiker, dessen Strategien gegen jedes Kriegsrecht auch seiner Zeit verstoßen; ein korruptionsfreier und integerer Mann, der einen Kardinalshut ablehnt, aber völlig unfähig ist, im Frieden zu leben, und mit seinem Fanatismus furchteinflößender ist als so mancher korrupte, aber verhandlungsfähige Politiker.
_Fazit_
Es gibt einige Romane, welche die Belagerung von Malta durch das Osmanische Reich schildern, und der hier vorliegende gehört zum Besten, was ich zu dieser Thematik bisher gelesen habe. „Das Sakrament“ ist ein spannender und zutiefst bewegender Roman, für Freunde und Leser historischer Romane ein wahrer Leckerbissen und ein rundum gelungenes Werk, das man nur sehr ungern aus der Hand legen wird.
Es wird eine Fortsetzung mit den überlebenden Figuren geben – in welche Richtung diese verlaufen wird, vermag man bis dato noch nicht zu erahnen.
_Der Autor_
Tim Willocks wurde 1957 in Manchester geboren und begann bereits mit zehn Jahren zu schreiben. 1983 promovierte er in London, wo er Medizin und Psychologie studierte. Bis 2003 arbeitete er als Psychologe und behandelte vor allem drogenabhängige Patienten. Vor Jahren hat er mehrere erfolgreiche Thriller geschrieben. Dann entdeckte ihn der Agent von Ken Follett, der ihm auf unbegrenzte Zeit seine Villa in Florida zur Verfügung stellte, damit er sein Buch „Das Sakrament“ vollenden konnte, seinen ersten historischen Roman,
http://www.aufbauverlag.de/