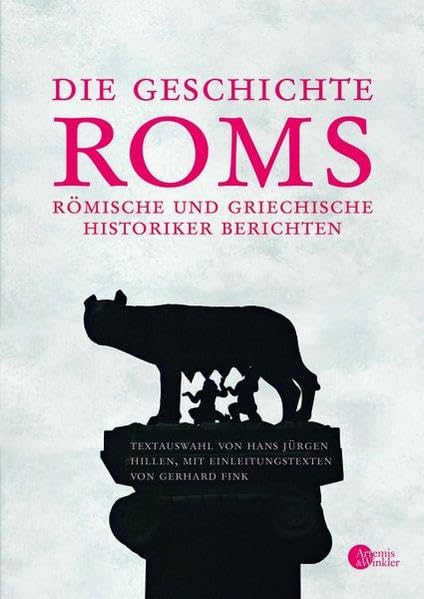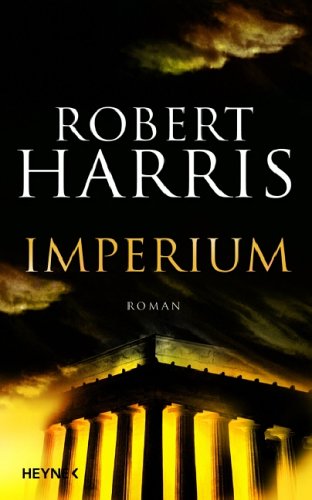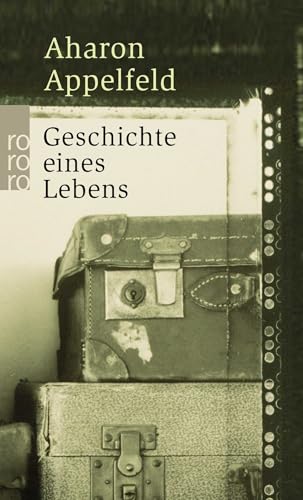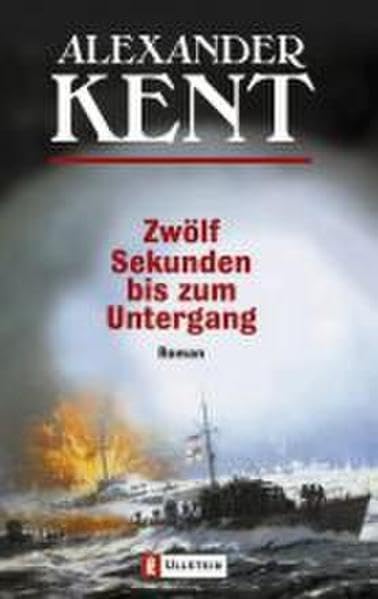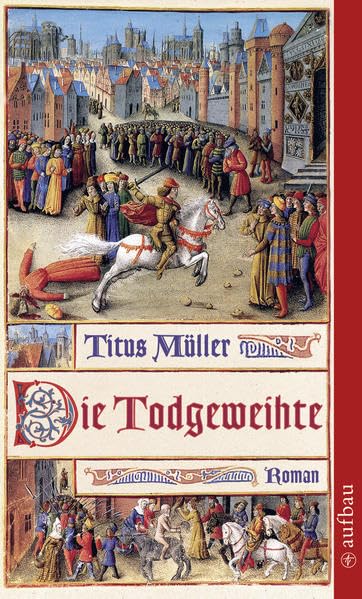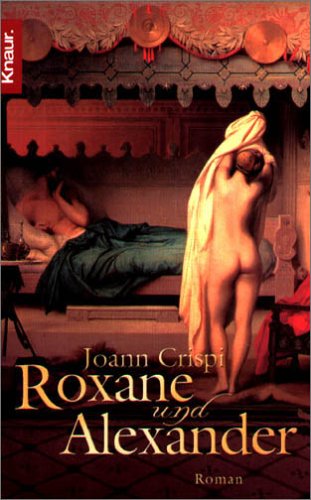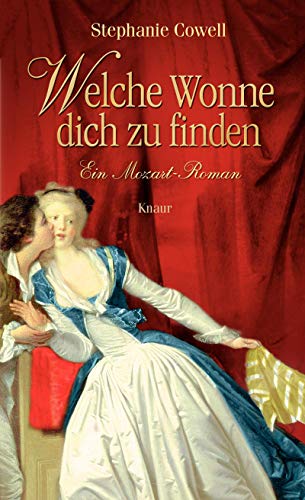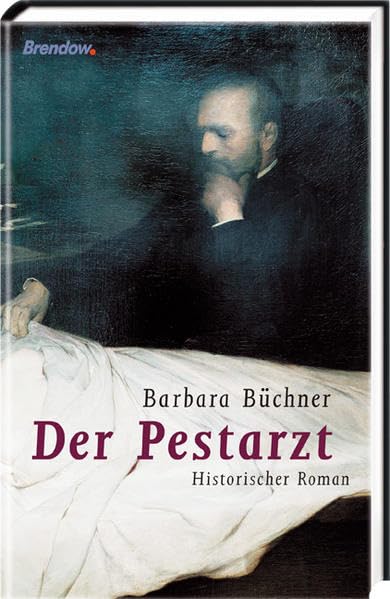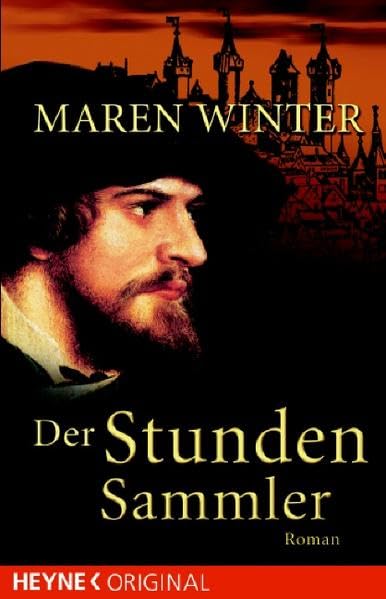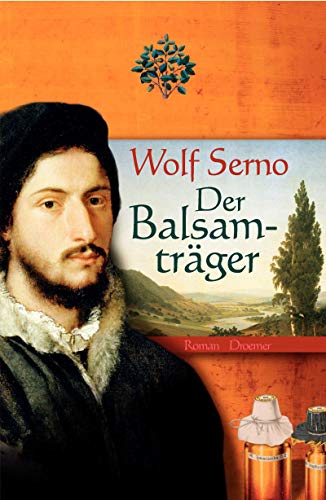An einem Maitag des Jahres 1855 verlässt der ehemalige Walfänger „Narwhal“ den Hafen der Südstaaten-Metropole Virginia. Mit hehren Zielen ist man gen Arktis in See gestochen, will der seit acht Jahren verschollenen Expedition des Entdecker-Helden Sir John Franklin auf die Spur kommen, die polarnahe Natur erforschen und womöglich die lange gesuchte Nordwestpassage finden, die es angeblich ermöglicht, den nordamerikanischen Kontinent per Schiff im Norden zu umrunden. Ja, Zecheriah Vorhees, der charismatische, erst 26-jährige Kommandant der „Narwhal“, versteht es außerordentlich, für sich und seine Sache die Werbetrommel zu rühren!
Aus ganz anderem Holz geschnitzt ist sein väterlicher Freund und zukünftiger Schwager Erasmus Darwin Wells. Mit seinen 40 Jahren sieht er sich selbst als im Leben Gescheiterter. Einst schien die Welt dem begabten und belesenen Naturforscher offen zu stehen. Doch er wurde um die Forschungsergebnisse jener Weltreise geprellt, die ihm den Weg in eine wissenschaftliche Karriere ebnen sollte. Von diesem Schlag hat sich Wells nie erholt. Als kurze Zeit darauf auch noch seine Braut starb, versank Erasmus in Lethargie, ließ sich treiben und hat sich in einen verbitterten Eigenbrötler voller Ängste und Frustrationen verwandelt. Vorhees’ Einladung, an Bord der „Narwhal“ auf eine neue Reise zu gehen, sieht er als letzte Gelegenheit, seinem Leben wieder einen Sinn zu geben.
Doch die Expedition steht unter keinem guten Stern. Vorhees zeigt sich seinem Amt nur bedingt gewachsen. Die für die Wissenschaft so wichtige Dokumentation langweilt ihn. Er will Entdeckungen machen, um berühmt zu werden! Seinen Visionen haben sich Besatzung und Passagiere gefälligst unterzuordnen. Während Letztere ihrem Kommandanten lange hilflos gegenüberstehen, wächst unter Ersterer der Widerstand, so dass die „Narwhal“ schließlich nicht nur hart am Rande des bedrohlichen Packeises, sondern auch einer Meuterei steht, während sie vom zusehends größenwahnsinnigen Vorhees immer weiter in den Norden getrieben wird, bereit, den Weg seines Vorbildes Franklin bis zum bitteren Ende zu gehen.
Die Fahrt der „Narwhal“ endet in einer Katastrophe. Das Schiff, von Vorhees wider alle Vernunft zu lange an der Rückfahrt gehindert, wird vom Eis eingeschlossen. Mannschaft und Passagiere erleben einen fürchterlichen Kälte- und Hungerwinter, den nicht alle überleben. Dessen ungeachtet drängt Vorhees auf weitere Erkundungen. Als sich seine Begleiter weigern, zieht er allein in die Polarwüste und verschwindet spurlos. Erasmus soll die wenigen Überlebenden dorthin führen, wo Rettung zu erwarten ist. Diese Flucht über das Eis entwickelt sich zum tödlichen Albtraum, der Erasmus und die wenigen Überlebenden schrecklich zeichnet. Zudem waren alle Qualen umsonst: Nach der Rückkehr stellt sich heraus, dass Vorhees die „Narwhal“ in ein Gebiet lenken ließ, das längst erforscht wurde … Statt gefeiert zu werden, muss sich Erasmus als Versager und Feigling beschimpfen lassen. Doch sein Leidensweg hat nicht einmal begonnen, denn eines Tages kehrt Zeke Vorhees aus dem Eis zurück – ein ruhmreicher Held, beladen mit den Ergebnissen eigener Forschungen, von denen Erasmus genau weiß, dass sie zu schön sind, um wahr zu sein. Doch ihm fehlen die Beweise, und so muss er ohnmächtig mit ansehen, wie der betrügerische Vorhees sich skrupellos seinen Platz in der Geschichte verschafft …
„Jenseits des Nordmeers“ gehört wohl eindeutig zu den wenigen historischen Abenteuerromanen, die in den letzten zehn Jahren das meiste Kritikerlob und (was gleichzeitig normalerweise unmöglich ist) die ungeteilte Aufmerksamkeit des lesenden (und denkenden) Publikums auf sich lenken konnten. Nur wenige Seiten Lektüre geben deutlich Aufschluss über den Grund: „Jenseits des Nordmeers“ ist schlicht und ergreifend ein in Inhalt und Form verdammt gutes Buch!
Der Kraftausdruck sei im Positiven Ihrem Rezensenten gestattet, der sonst an dieser Stelle mit Zorn, Frustration und Resignation die meisten der so genannten „historischen“ Romane geißelt, für die guter Wald abgeholzt wird, statt der Sauerstofferzeugung vorbehalten zu bleiben. Geschichte auf TV-Seifenopern-Niveau ist es, die meist im (fadenscheinigen) Gewand des Krimis auf die Leser losgelassen wird. Das Gespür für vergangene Zeiten erschöpft sich gar zu oft darin, die Figuren in ulkige Gewänder zu stecken oder eine feurige Prä-Feministin gegen klotzköpfige Kirchenfürsten antreten zu lassen.
Ganz anders dagegen Andrea Barrett. Ihr ist nicht nur eine spannende Geschichte eingefallen, was an sich bereits eine anerkennenswerte Leistung und die halbe Autorenmiete ist: Sie wird auch noch so mitreißend erzählt, dass selbst einem alten Lesekämpen wie Ihrem Rezensenten mehr als 400 Seiten wie im Fluge vergehen; eine leider Gottes seltene Erfahrung, wenn der Buchberg eines Leserlebens Himalaja-Höhen erreicht hat.
Die Grundkonstellation ist denkbar einfach, aber viel erprobt und immer noch funktionstüchtig, wenn man die Gebrauchsanweisung kennt: Versammle einige Personen möglichst unterschiedlichen Charakters an einem Ort, von dem sie nicht fliehen können (hier das gute Schiff „Narwhal“), schicke sie dann auf eine gefährliche Reise und warte ab, was geschieht! Geht es jetzt mit einem recht primitiven Gefährt hinauf in das eisige Oberstübchen unseres Globus‘, ist das abenteuerliche Element schon einmal sichergestellt!
Jetzt zu den Hauptpersonen unseres Dramas. Treffen wir an Bord der „Narwhal“ die sprichwörtlichen dreizehn Mann auf des toten Mannes Kiste (mit ’ner Buddel voll Rum), d. h. gesichtslose und austauschbare Gestalten, die dem einzigen Zwecke dienen, neben dem eigentlichen Helden vom Mast zu stürzen, sich die Pest einzufangen oder in einen Haifisch-Rachen zu stürzen? Oh nein, echte Individuen hat Barrett mit Sachkenntnis und Liebe zum Detail in ihre Romanwelt gestellt. Helden gibt es übrigens auch nicht, sondern nur Menschen. An ihrer Spitze steht Erasmus Darwin Wells, eine traurige Gestalt, die aus einer gescheiterten Existenz hinaus auf die See flüchtet, um dort die Erfahrung zu machen, dass ungelöste Probleme mit ihren unglücklichen Besitzern zu reisen pflegen. Mit dieser Erkenntnis und den Folgen bleibt Erasmus nicht allein; mit seltenem Geschick und düsterer Konsequenz schildert Barrett eine hehre Mission, die weniger an den Unbilden der Natur als an menschlichem Versagen erst krankt und dann scheitert.
Ähnlich dürfte es der Expedition Sir John Franklins ergangen sein, auf dessen Spur sich die Crew der „Narwhal“ gesetzt hat. Dieses reale Rätsel der Entdeckungsgeschichte bildet den idealen Rahmen für Barretts Drama. Mit viel Vorschusslorbeeren und in einem sehr modern anmutenden Medien-Gewitter war der von seinen britischen Landsleuten verehrte und weltweit anerkannte Polar-Pionier im Mai 1845 mit zwei Schiffen gen Nordpolarmeer aufgebrochen, um endlich die sagenhafte Nordwestpassage zu finden. Eigentlich war Franklin schon viel zu alt und auch nicht gesund genug für eine solche Expedition, doch wie Zecheriah Vorhees versessen darauf, den eigenen Ruhm weiter zu mehren. So ersetzte ein regelrechter Ausrüstungs-Overkill eine realistische Planung des Unternehmens, das in einem schrecklichen Fiasko endete: Die Schiffe gingen verloren, und alle 135 Männer kamen grausam zu Tode; verirrt, erfroren, verhungert oder gar vergiftet durch die eigenen, mit Blei (!) schlampig verschweißten Konserven.
Es dauerte 140 Jahre, bis der Großteil dieser traurigen Wahrheit ans Licht kam. Als Erasmus Wells in See stach, herrschte dagegen noch Hoffnung. Lady Jane, John Franklins Gattin, drängte unermüdlich jeden Seemann und Entdecker, in den Norden zu dampfen oder zu segeln, um dort auf die Suche zu gehen. Sie war viele Jahre sehr überzeugend, zumal immer wieder Relikte der verschollenen Expedition entdeckt wurden. Die „Narwhal“ reiht sich deshalb unauffällig in die Flotte echter Schiffe ein, die zwar nie John Franklin fanden, aber immerhin das Wissen um den hohen Norden entscheidend zu mehren wussten.
Wenn sie denn ihre Abenteuer überlebten. „Jenseits des Nordmeeres“ verzeiht die Natur keine Schwächen, das macht uns der gleichnamige Roman eindrucksvoll klar. Dabei ist die Arktis keine tödliche Eishölle, sondern ein Ort, an dem es sich durchaus leben lässt, solange man bereit ist, sich den Verhältnissen anzupassen. Barrett schildert präzise den Zwiespalt, der die Entdecker des 19. Jahrhunderts immer wieder in selbst verschuldeten Krisen untergehen ließ: Sie kamen nur scheinbar in fremde Landstriche, um zu lernen, während sie unterbewusst davon überzeugt waren, schon alles Wissenswerte zu kennen. Barrett beschreibt, was Erasmus Wells in den Laderäumen der „Narwhal“ verstaut; mindestens die Hälfte ist in der Arktis völlig nutzlos und fehl am Platze, während wirklich Wichtiges oft fehlt. Aber: Ein Gentleman reist halt so, und außerdem muss er vor den „Wilden“ die Überlegenheit der weißen Rasse demonstrieren!
Nur Erasmus und sein neuer Freund, der Schiffsarzt, entwickeln einen echten Sinn für die Schönheit der Welt, die sie bereisen. Durch ihre Augen sieht der Leser dank Barretts Talent den hohen Norden in seiner ganzen Pracht. Während sich minder begabte Autoren gern vor Landschaftsbeschreibungen drücken oder in bleierne Langeweile abrutschen, entwickelt Barrett eine Wortgewalt, die einfach mitreißend ist. Hierin gleicht sie tatsächlich dem im Klappentext als Wink mit dem Zaunpfahl genannten Herman Melville [(„Moby Dick“), 1144 ohne ihn jedoch jemals zu imitieren. „Jenseits des Nordmeers“ ist ein absolut eigenständiges Werk, ein moderner Klassiker des Genres Reiseabenteuer, ein Literaturkapitel, das man oft schon für abgeschlossen hält, da doch die Welt inzwischen bis in die letzten Winkel erforscht ist. Aber so ist es nicht, und selten macht es so viel Spaß, vom Gegenteil überzeugt zu werden!
Und als Erasmus Wells in die Zivilisation zurückkehrt, ist gerade die Hälfte des Romans gelesen! Jetzt geht es erst richtig los: Als ob sie die Eiswüste nie verlassen hätten, setzen Wells und Vorhees ihr auf der „Narwhal“ begonnenes Duell mit unverminderter Härte fort. Vorhees verkörpert dabei die dunkle Seite der noch heute meist ohne Einschränkung verehrten Heldengestalten der Entdeckungsgeschichte. Doch die Männer, die das Neue suchten, benahmen sich in der Fremde nicht selten wie die sprichwörtliche Axt im Walde. Besonders im Umgang mit den Ureinwohnern der besuchten (oder besser eroberten) Gebiete geschah vieles, das in den offiziellen Forschungsberichten lieber verschwiegen wurde. Barrett nennt diese Dinge beim Namen, und siehe da: Diese zweite Hälfte, die in der Tat „Jenseits des Nordmeers“ spielt, gibt der ersten in Sachen Dramatik und Spannung nicht das Geringste nach!
PS: Famos übersetzt wurde das Werk auch noch!