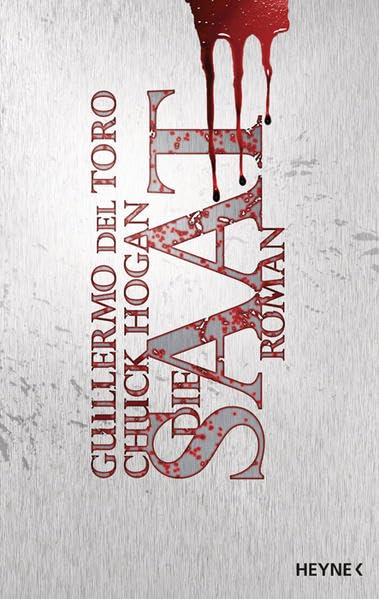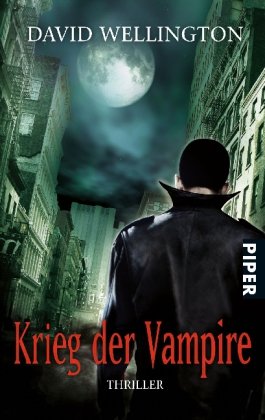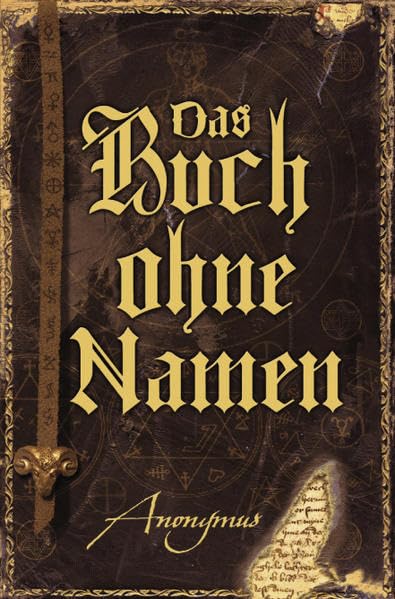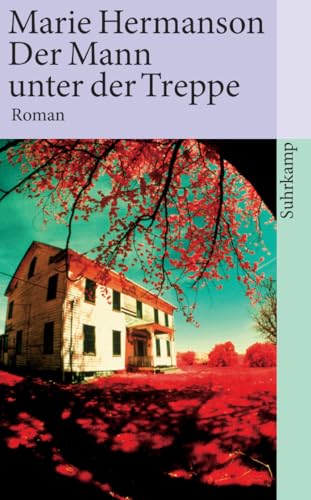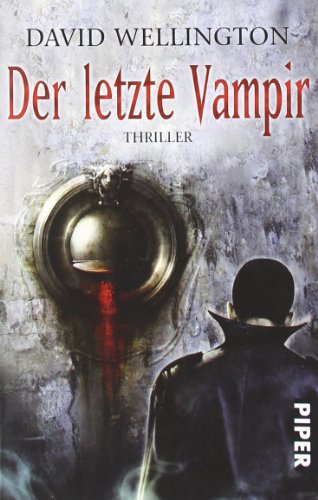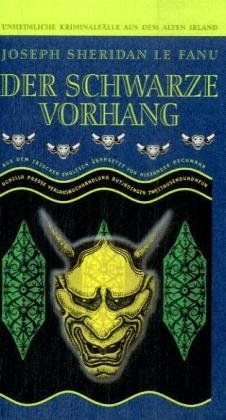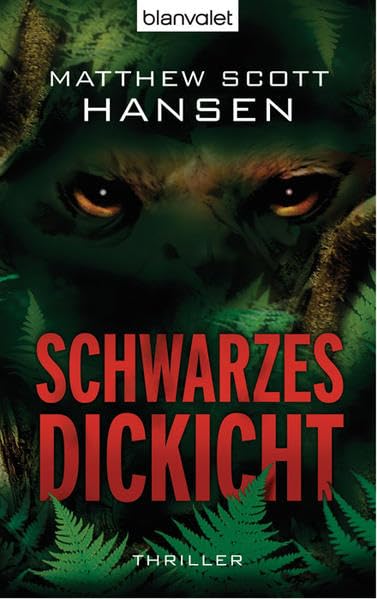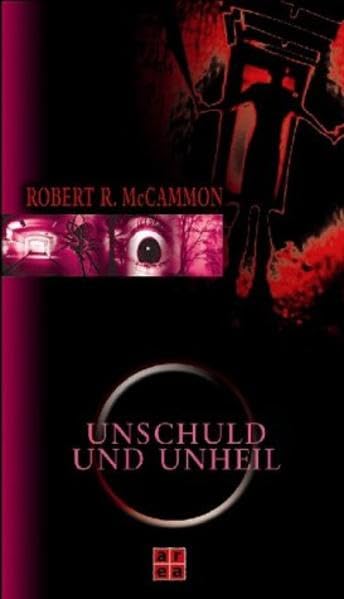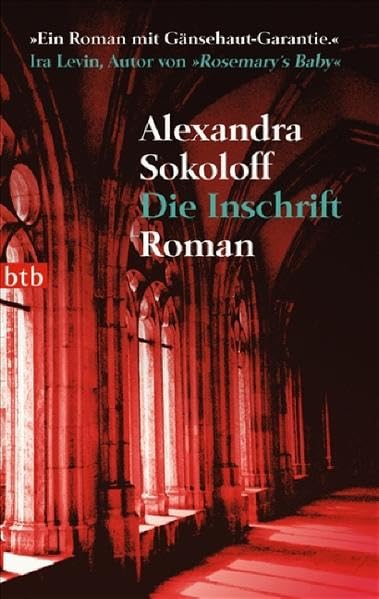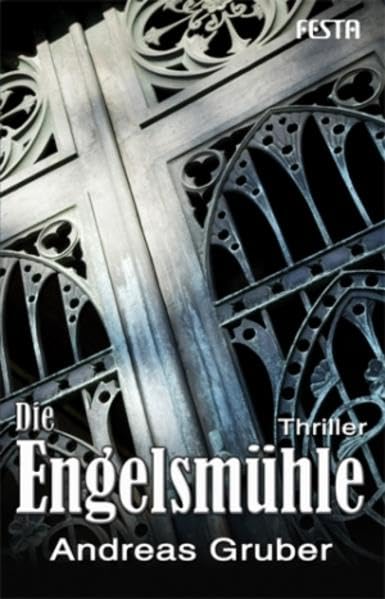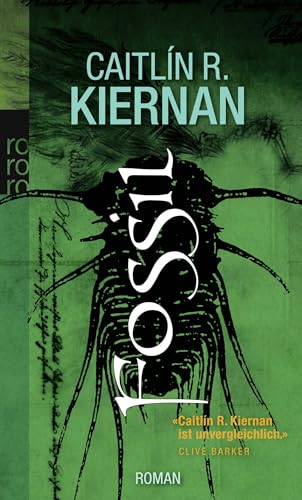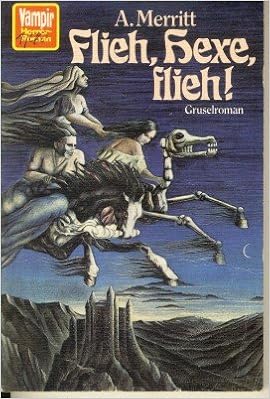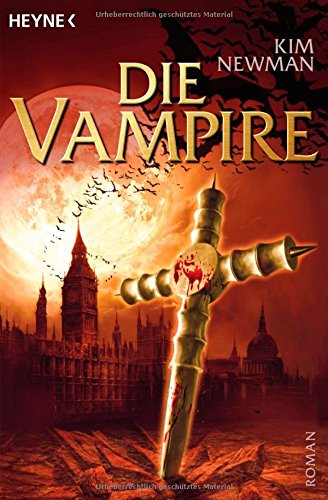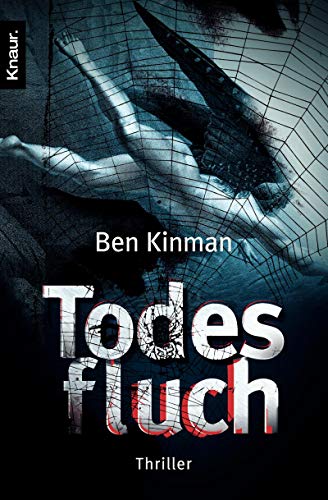Die Autoren des kürzlich im |Heyne|-Verlag erschienenen Romans „Die Saat“ sind uns wohlbekannt. Erster des Duos, Guillermo del Toro aus Mexiko, ist als Regisseur durch Filme wie „Pans Labyrinth“, „Blade II“, „Hellboy“ oder durch die derzeitige Verfilmung des Klassikers „Der kleine Hobbit“ nach dem Buch von J.R.R. Tolkien inzwischen in die Riege der bedeutendsten Filmemacher aufgestiegen.
„Die Saat“ ist der erste Roman einer geplanten Trilogie, die er zusammen mit Chuck Hogan, einem international erfolgreichen Autor („Mördermond“, „Endspiel“), verfasst hat.
_Inhalt_
Der John F. Kennedy International Airport in New York ist einer der größten der Welt. Eines Nachts landet auf der Rollbahn des Flughafen eine Boeing 777, eines der größten Passagierflugzeuge der Welt mit Platz für bis zu mehr mehr als 500 Passiere, mit über 200 Fluggästen an Bord. Flug 753 war planmäßig von Berlin gestartet, um Stunden später in seinem Zielort New York anzukommen.
Nach der ruhigen Landung geschieht Merkwürdiges: Auf Anfragen vom Kontrolltower reagiert der Pilot nicht und alle Lichter an der schweren Passagiermaschine erlöschen, keine Positionslichter an den Tragflächen, die Sonnenblenden an den ovalen Fenstern sind alle komplett heruntergezogen. Es ist so, als wäre ein toter Wal am Strand angespült worden. Die Fluglotsen und Sicherheitsmitarbeiter sind schockiert, niemand reagiert im Inneren der Maschine auf Funksprüche, auch gibt es kein Signal aus dem Flugzeug, das auf Probleme im Innenraum hinweist.
Auf dem Rollfeld in unmittelbarer Nähe der „toten“ Maschine herrscht Sorge bei den Sicherheitskräften. Ist das Flugzeug in der Hand von Terroristen und gab es in der Maschine ein schreckliches Blutbad? Entschlossen fällt die Entscheidung, sich gewaltsam Zugang zu verschaffen, denn alle Zu- und Notausgänge sind verriegelt, so dass nur die Alternative übrigbleibt, das Flugzeug mittels Schneidbrenner aufzuschneiden.
Ephraim Goodweather, Chef der Seuchenschutzbehörde CDC in New York, genießt gerade sein Wochenende mit seinem Sohn Zack, als sein Handy Alarm schlägt. Der Anrufer identifiziert sich mit der ID JFK QUARANTÄNE. Der Direktor des CDC teilt Ephraim mit, dass es sich um einen Ernstfall handelt, denn alle Passagiere an Bord der Boeing sind tot.
Als Ephraim und Nora, seine Assistentin, noch in der Nacht die Maschine betreten, präsentiert sich den beiden Ärzten ein gespenstisches und tragisches Bild. Vor ihnen sitzen angeschnallt in ihren Sitzen Leichen, ganze Reihen von Leichen, aber keine Anzeichen deuten auf einen gewalttätigen Tod hin, kein Zeichen von irgendwelchen Traumata zeigt sich. Handys klingeln gedämpft in Taschen und Jacken – die einzigen Töne, die in der Dunkelheit zu vernehmen sind. Offenbar sorgen sich die Angehörigen und versuchen verzweifelt, ihre Angehörigen im Flugzeug zu erreichen.
Währenddessen verfolgt ein alter Mann in seiner beengten Pfandleihe die Nachrichten. Abraham Setrakin, ein ehemaliger Professor für osteuropäische Literatur und überlebender des Holocaust, sitzt wie versteinert vor dem Fernseher und reist gedanklich in Vergangenheit, als er noch jung war, als ihm das Böse in Gestalt begegnete. Er ist hier … Er ist hier …
Ephraim und seine Kollegen von CDC sind inzwischen dabei, die vielen hundert Leichen auf die verstreuten medizinischen Institute zu verteilen. Eine Sektion soll die Rätsel um dieses Massensterben lösen und beantworten können. Aber doch gibt es Überlebende, ganze vier Personen haben nicht an Bord der Boeing den Tod gefunden, und diese werden zu den wichtigsten Zeugen der Katastrophe, aber zuerst werden die vier auf Isolierstationen untersucht.
Ephraim steht vor einer ganzen Anzahl von Fragen, aber langsam kriecht die Angst in ihm hoch, als würde er etwas spüren, das alle, wirklich alle bedroht. Die ersten Untersuchungsergebnisse weisen erschreckende Details an den Toten auf, denn trotz ihres physischen Todes verändern sich ihre inneren Organe und ihre Eigenschaften.
Als eine Sonnenfinsternis eintritt, wird das dumpfe Gefühl von langsam aufsteigernder Angst immer beklemmender, und als der Tag zur Nacht wird, wird Ephraim klar, dass das Böse bereit ist, New York heimzusuchen, und es könnte das Ende der Menschheit bedeuten …
_Kritik_
„Die Saat“ hat mit einer romantischen und erotischen Vampirgeschichte rein gar nichts zu tun. Die Autoren Guillermo del Toro und Chuck Hogan bedienen sich vornehmlich der düsteren, aber auch klassischen Elementen des Vampirismus und auch einiger geläufiger Klischees.
Der vorliegende Roman ist der Auftakt einer Trilogie, und schon nach den ersten Kapiteln wird dem Leser vor Augen geführt, dass es unmöglich bei diesem einen Buch bleiben wird. Vielmehr fungiert „Die Saat“ als Einleitung; hier wird das Grundgerüst um die Protagonisten aufgebaut, und es wirkt recht stabil, auch wenn manche Figuren eher stereotyp sind.
Besonders atmosphärisch gelungen ist dem Autorenduo das erste Drittel der Geschichte. Die Landung des ‚toten‘ Flugzeuges, das verzweifelte Nicht-verstehen-können der Fluggesellschaft und der Sicherheitskräfte vor Ort und schließlich die Beschreibung des gewaltsamen Öffnens und Erkundens der gestrandeten Boeing sind spannend und realistisch anmutend erzählt. Über New York bricht das Grauen ein, aber nicht auf erwartet dramatische Weise wird die Stadt überrollt, sondern die Autoren konzentrieren sich eher auf die langsame Entwicklung der Handlung.
Parallel zum Hauptplot kommen vielerlei andere Perspektiven zum Vorschein. Allen voran der ältere Professor, gefolgt von den vier Überlebenden und schließlich auch dem Architekten dieser vampirischen Pandemie. Ephraim Goodweather ist nicht der Schlüssel der Geschichte, vielmehr ist er der zweifelnde und einfache Charaktertyp, der erst noch zeigen muss, was er kann. Viel interessanter und vielschichtiger ist dagegen die Figur des Professors Abraham Setrakian, denn er kennt das Böse und dieses ihn. Eine Auseinandersetzung, die nur die Folgerung zulässt, dass einer den Kampf verlieren wird.
Die Einführung von Ephraim wirkt anfangs ein wenig verstörend, erst später wird dem Leser bewusst, warum einzelne Passagen mit viel Feingefühl eingestreut wurden. Del Toro sagt selber von sich in einem Interview, er wäre seit frühester Jugend ein begeisterte Leser von Vampirromanen, und genau das merkt man am Stil der Autoren, auch inhaltlich.
Bram Stokers „Dracula“ gilt als Urfassung der heutigen Vampirlitaratur, und wer diesen Roman gelesen hat, wird schnell feststellen, dass „Die Saat“ reichliche Parallelen aufweist. Jonathan Harker ist Ephraim Goodweather, ein naiver, in sich verlorener und manchmal unsicherer Charakter, auch in seinem privaten Umfeld, während an seiner Seite Professor Abraham Setrakian auftaucht, ein weiser, älterer und besonnener Charakter der vorbereitet und allwissend zu sein scheint, und der vor allem weiß, was oder wer New York einen Besuch abgestattet hat. Jedem ist sofort klar, dass hier die Inkarnation Dr. van Helsings zu sehen ist. Und selbst der frauliche Part ist abgedeckt mit einer Mina Harker oder einer Lucy, die Opfer von Dracula wurde.
Das sind nur die charakterlichen Verwandtschaften, aber kommen wir nun zu den anderen Punkten, die auch nicht wirklich viel Neues bereithalten. Die Boeing, die leblos und dunkel auf dem JFK liegt, war in Bram Stokers Roman das Segelschiff |Demeter|, deren Besatzung verschwunden war, und die als Gespensterschiff dennoch sicher in Londons Hafen einfuhr.
Die Vampire dagegen sind bösartige Kreaturen; jedenfalls im Anfangsstadium ihrer Entwicklung ist keinerlei menschliche Intelligenz zu finden, vielleicht Instinkte, angeborenes Verhalten, aber im Großen und Ganzen sind sie nichts anderes als hungrig.
Diese Beziehungen zu dem Urvater aller Vampirromane ist also offensichtlich, doch ist und bleibt „Die Saat“ ein origineller und überwiegend spannender Vampirroman, der den Horror um das Böse eher anfacht und entwickelt als verklärt oder romantisiert. Del Toro wird, so liegt die Vermutung nahe, „Die Saat“ auch verfilmen, und wie schon bei seinen anderen filmischen Werken wird es erschreckende Szenen geben, die uns ein Grauen entlocken werden. Somit hat das Autorenduo den netten Nebeneffekt geschaffen, neben einem Roman zugleich das Drehbuch konzipiert zu haben.
Vieles bleibt nach dem ersten Teil dieser Trilogie offen; zwischen Menschen und Vampiren ist ein Krieg entfacht worden, aber es wird noch eine dritte Partei in diese tödliche Konfrontation eingreifen, und es zeichnet sich klar ab, dass es noch spannender zugehen wird.
_Fazit_
„Die Saat“ ist ein solider Roman aus dem Genre Horror, der besonders im ersten Drittel spannend erzählt wird. Als Kritikpunkt sei vorrangig zu erwähnen, dass es zwar einige neue Ideen gibt, aber im Grunde vieles nicht neu ist. Das ist bedingt entschuldbar, denn welcher Roman schafft schon einen völlig neuen modernen Vampir? Auch wenn der Roman inhaltliche Längen aufweist und manches Mal die Perspektiven der Protagonisten allzu stark wechseln, die Neugierde auf den zweiten Teil, der wahrscheinlich nächstes Jahr erscheint, wird sehr groß sein.
„Die Saat“ ist überzeugend, wenn auch manchmal in seiner Konzeption angeschlagen, und so wird der Leser sich doch auf den nächsten Teil freuen.
|Originaltitel: The Strain
Originalverlag: Harper Collins
Aus dem Amerikanischen von Jürgen Bürger, Kathrin Bielfeldt
Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 528 Seiten
ISBN-13: 78-3-453-26639-1|
http://www.heyne.de/diesaat