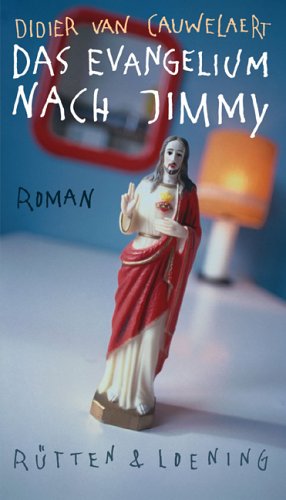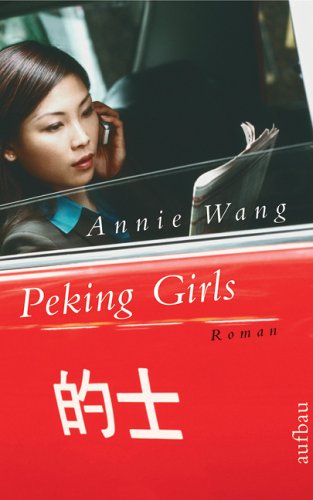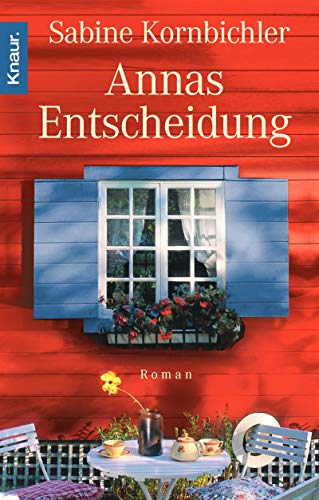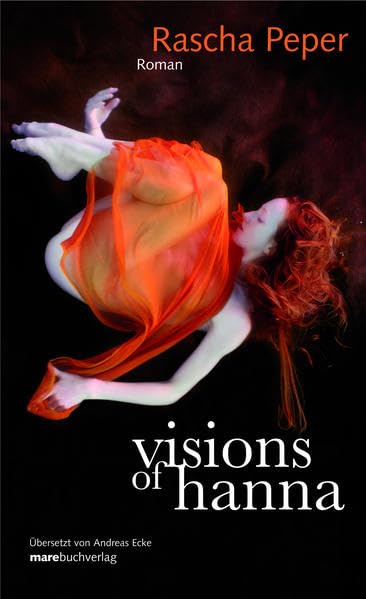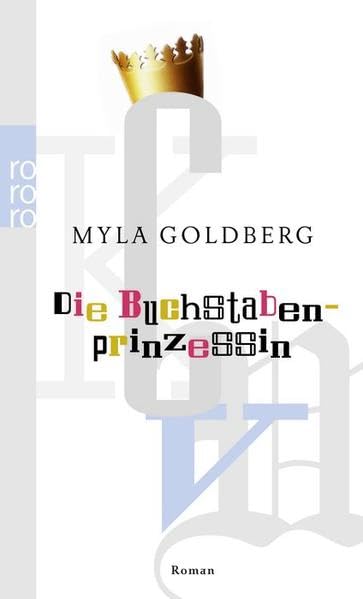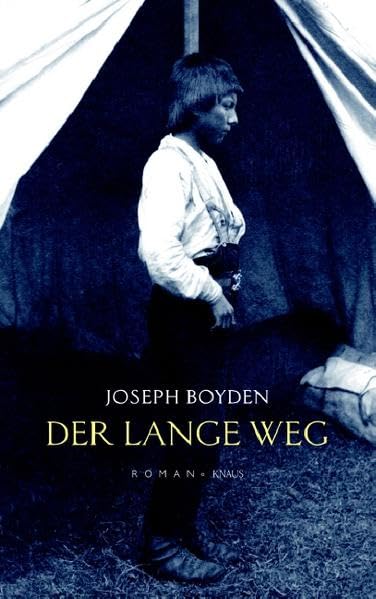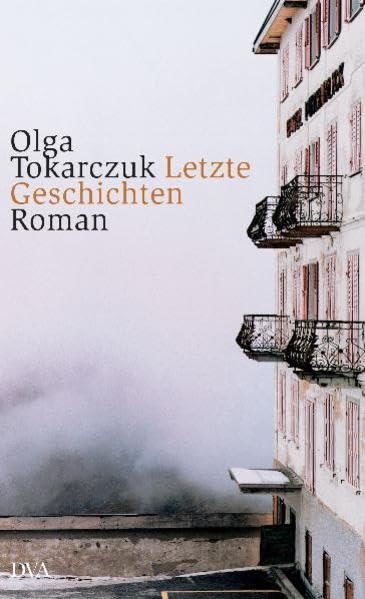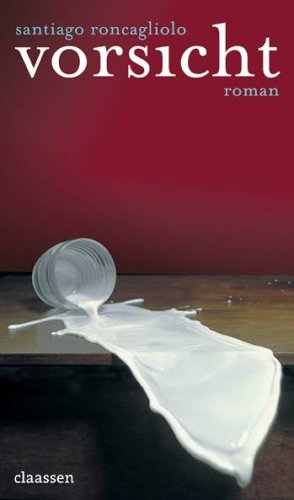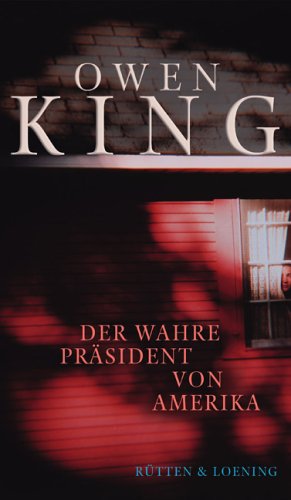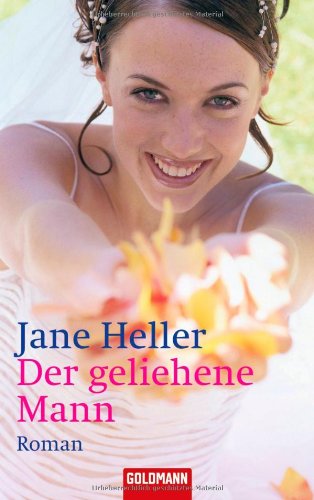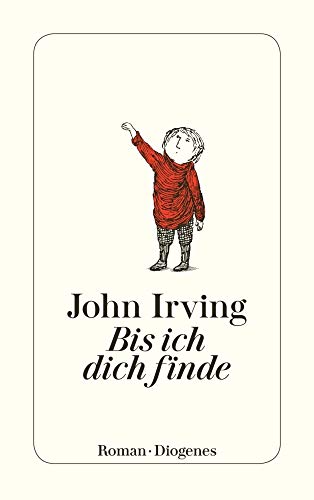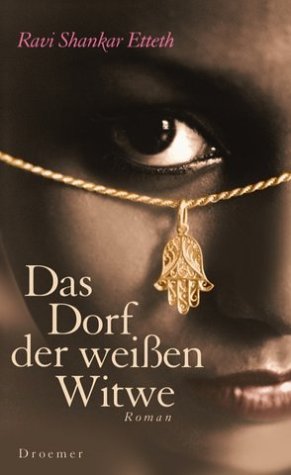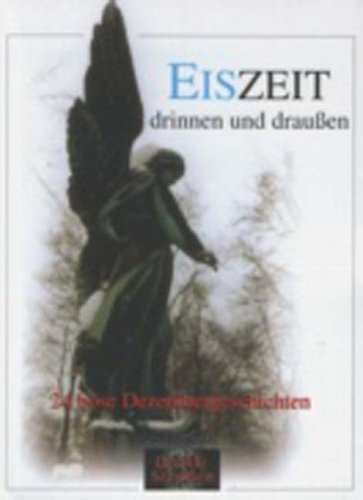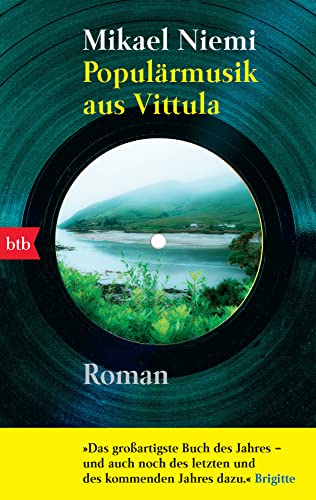Man stelle sich vor, jemand würde heutzutage auf die Idee kommen, einen Menschen zu klonen. Nicht einfach irgendeinen Menschen, sondern eine Schlüsselfigur der Geschichte, die auch heute noch polarisiert. Nicht Napoleon oder Stalin, Hitler schon gar nicht – nein, Jesus! Nicht nur nach wissenschaftlichen Kriterien für uns absolut unvorstellbar, sondern auch ethisch höchst zweifelhaft. In Didier van Cauwelaerts Roman „Das Evangelium nach Jimmy“ wird dieses geradezu gruselige Szenario Realität und liefert die Kulisse für eine unterhaltsame, bitterböse Satire.
Jimmy Wood ist 32 Jahre alt und repariert die Swimmingpools der Gutbetuchten von Connecticut. Er glaubte stets, ein Waise zu sein, bis ihn drei Abgesandte des Weißen Hauses eines Besseren belehren. Eines Tages stehen ein Arzt, ein Priester und ein Jurist bei ihm auf der Matte und überbringen ihm eine Nachricht, die Jimmys Leben Kopf stehen lässt: Jimmy ist ein Klon von Jesus, der mit Hilfe von Blutproben aus dem Turiner Grabtuch hergestellt wurde.
Jimmy braucht eine Weile, bis er diese Neuigkeit verdaut hat, denn das ist wahrlich ein schwerer Brocken. Doch zur Muße bleibt ihm wenig Zeit, denn das Weiße Haus hat Großes vor. Eine ganze Heerschar von Stylisten, Psychologen, Geistlichen und Ernährungsberatern steht bereit, um Jimmy auf seine zukünftige Rolle als Messias vorzubereiten. Jimmy lässt sich schließlich darauf ein und beginnt langsam an sich zu glauben.
Jimmy vollbringt seine ersten Wunder und legt damit seine letzten Zweifel am messianischen Blut in seinen Adern ab. Er sorgt für eine wundersame Donutvermehrung, gibt einem Blinden das Augenlicht zurück und lässt gar einen Toten auferstehen. Doch je mehr Jimmy in seine Rolle als Reinkarnation des Messias hineinwächst, desto mehr gerät die Sache auch außer Kontrolle. Sein Auftritt im Vatikan wird zum Fiasko, seine Wunderheilung in Lourdes endet hochdramatisch und sein Auftritt in der Show eines Fernsehpfarrers sorgt für den medialen Höhepunkt, an dessen Ende alle nur noch eins wollen: Jimmy ans Kreuz schlagen.
Mein Eindruck
Schon der Inhalt offenbart, dass Didier van Cauwelaert einen absolut respektlosen und bitterbösen Roman abgeliefert hat – eine Satire, von der Menschen mit allzu empfindlichen religiösen Gefühlen wohl besser die Finger lassen sollten, um nicht ganz aus ihrem religiösen Gleichgewicht gebracht zu werden.
Doch „Das Evangelium nach Jimmy“ ist nicht einfach eine Religionssatire. Vielmehr liefert van Cauwelaert eine hervorragende Gesellschaftssatire ab. Es geht viel mehr um das, was die moderne Gesellschaft aus dem neuen Messias macht, als um seine Figur an sich. Natürlich bleibt Jimmy als Reinkarnation des Messias Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, doch geht es van Cauwelaert eben offensichtlich besonders auch um die Reaktionen, die sein Auftreten hervorruft. Und dabei scheint sich am Ende die Geschichte zu wiederholen – nur eben diesmal mit Internetabstimmung und Liveübertragung im TV.
Welche Auswüchse dieses Höllenspektakel hat, ist fantastisch anzusehen. So manches Grinsen huscht einem bei der Lektüre über das Gesicht, und so manches mal möchte man lauthals loslachen. Van Cauwelaert beginnt seine Geschichte in der Gegenwart, in der Ära Bush, der ganz nebenbei auf diese Weise auch noch sein Fett wegbekommt. Der zukünftige Präsident (ein schwuler Republikaner, man mag es kaum für möglich halten) setzt aber selbst auf eine Figur wie Bush noch einen drauf.
Van Cauwelaerts Buch dürfte so manchen stockkonservativen Amerikaner an den Rand des Herzinfarkts treiben, aber die gehören wohl ohnehin nicht zur Zielgruppe. Inszenierte schon DBC Pierre in [„Jesus von Texas“ 1336 ein haarsträubendes, abgedrehtes Medienspektakel, so setzt van Cauwelaert dem noch die Krone auf, indem er das Ganze in einen religiösen Kontext einbindet. Er wandelt dabei sicherlich an der Schmerzgrenze, aber ich denke, darüber ist sich der Autor im Klaren. Im Prinzip löst er die Sache zum Ende hin aber so gut auf, dass der Plot in sich stimmig ist und der anstößige, religiöse Kern der Geschichte in einem etwas anderen Licht erscheint.
Was man kaum für möglich halten mag, ist, dass die Kirche bei van Cauwelaert eigentlich gar nicht so schlecht davonkommt, wie man in Anbetracht der Thematik meinen möchte. Das Hauptaugenmerk der Kritik liegt eher auf skrupellosen Wissenschaftlern und der medialen Ausschlachtung, die mit Jimmy als zentraler Figur inszeniert wird. Jimmy wird eigentlich nicht gefragt, sondern einfach zu einer Rolle gedrängt, der er sich zu fügen hat.
Und so fällt auch der Blick auf die Figur des Jimmy wesentlich menschlicher aus als der Rest des Romans. Van Cauwelaert gibt Jimmy Raum für seine Selbstzweifel, lässt ihn an seiner Berufung zweifeln und verzweifeln. Jimmy bleibt trotz all der Inszenierung rund um seine Person ein Mensch, und diese Differenzierung zwischen knallharter Satire und einem persönlichen, menschlichen Blick auf die Hauptfigur gelingt van Cauwelaert ganz gut.
Van Cauwelaerts Stil liest sich dabei gleichermaßen locker wie unterhaltsam. Er formuliert gewitzt, mit einem Blick für skurrile Details und einem humorvoll-ironischen Unterton. Er schafft es, die Geschichte mit einer Prise Spannung auszustatten und bleibt bei allem Spaß und aller Satire auch immer noch menschlich.
Fazit: Wer Lust auf eine herrlich respektlose Satire hat und auch schon Spaß an Romanen wie „Jesus von Texas“ hatte, auf dessen Wellenlänge dürfte auch der Franzose Didier van Cauwelaert mit seinem Roman „Das Evangelium nach Jimmy“ liegen – respektlos, bitterböse, absolut fantastisch und schön zu lesen.
Gebunden: 406 Seiten
ISBN-13: 9783352007330
https://www.aufbau-verlage.de/ruetten-loening