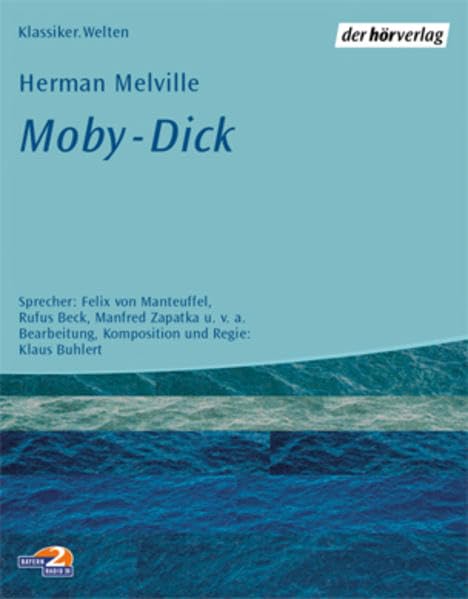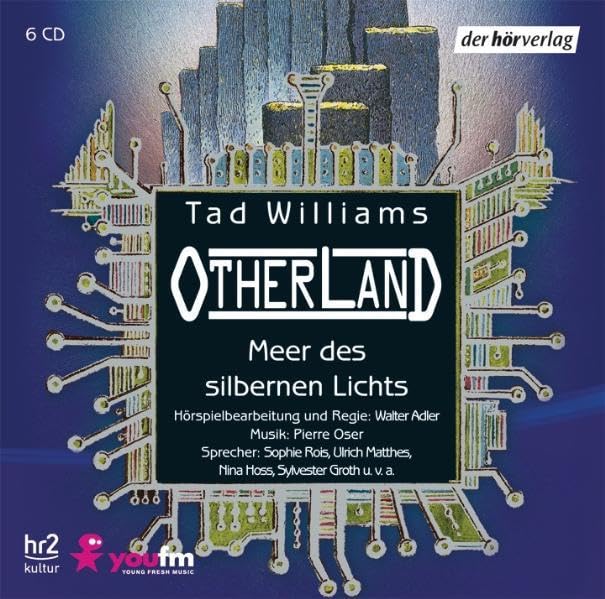
_von Bernd Perplies
mit freundlicher Unterstützung unseres Partnermagazins http://www.ringbote.de/ _
Tad Williams – Otherland 4: Meer des silbernen Lichts weiterlesen
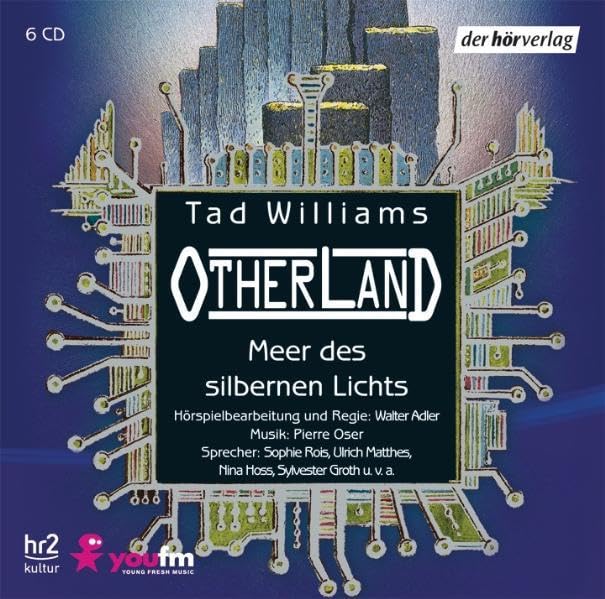
_von Bernd Perplies
mit freundlicher Unterstützung unseres Partnermagazins http://www.ringbote.de/ _
Tad Williams – Otherland 4: Meer des silbernen Lichts weiterlesen
Eine Pfarrerstochter wird von dem Vormund zweier engelsgleicher Kinder als Gouvernante eingestellt. Der in London als Lebemann logierende Herr will mit den Blagen offensichtlich nichts zu tun haben und beauftragt die Gouvernante, die seinem Charme sofort erliegt, ihm nie und nimmer zu schreiben, ihn nicht um Rat zu fragen und alle Probleme selbst zu lösen. Fürstlich entlohnt, entsendet er die junge Frau auf den Landsitz Bly, wo die Kinder recht einsam leben.
Auf Bly angekommen, wird die Gouvernante zunächst aufs Herzlichste von der Haushälterin Mrs Grose und den Geschwistern Flora und Miles begrüßt. Sie schließt die liebenswerten Kinder sofort ins Herz, fühlt sich prompt ins Paradies versetzt und bezeichnet die beiden fortan als „meine Kinder“. Doch die Idylle soll bald gestört werden. Der zuckersüße und wohlerzogene Miles ist von seiner Schule verwiesen worden und die Gouvernante zerbricht sich den Kopf darüber, was er, der kein Wässerchen trüben kann, wohl angestellt haben mag. Gleichzeitig fängt sie an, Geister zu sehen. Zuerst den ehemaligen Leibdiener des Vormunds, Peter Quint, später dann auch noch dessen vermutliche Geliebte Ms Jessel.
Es gilt, die Kinder vor dem verruchten Einfluss der beiden zu schützen. Doch nach und nach kommen der Gouvernante Zweifel: Sind die beiden wirklich so unschuldig, wie sie vorgeben? Oder ist all dies nur Fassade, um hinter verschlossenen Türen mit den Toten zu kommunizieren und die arme Gouvernante zu hintergehen? Sie jedenfalls ist entschlossen, die Kinder vor der Korruption durch Quint zu beschützen, doch wie soll ihr das gelingen, wenn sie plötzlich alle gegen sich sieht?
Die Situation spitzt sich immer mehr zu, und zusammen mit der bodenständigen Haushälterin Mrs Grose ist man sich nie ganz sicher, ob die bösen Geister nun tatsächlich existieren oder nur ein Produkt der überbordenden Fantasie der Gouvernante sind.
Literarisch versierteren Hörern wird die Erzählung „Die Unschuldsengel“ wohl eher unter dem eigentlichen Titel „Die Drehung der Schraube“ (engl. „The Turn of the Screw“) ein Begriff sein. Erstmals 1898 in Fortsetzung erschienen, gehört „Die Drehung der Schraube“ zu Henry James‘ Meistererzählungen. Der 1843 in Amerika geborene James verbrachte einen Großteil seines Lebens in Europa und wurde 1915, ein Jahr vor seinem Tod, sogar englischer Staatsbürger. Seine über 100 Erzählungen, 20 Romane und nicht zuletzt seine theoretischen Arbeiten zur „Kunst des Romans“ haben den modernen Roman maßgeblich beeinflusst. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei in der Bedeutung des Bewusstseins im Gegensatz zu den hinter ihm zurücktretenden äußeren Ereignissen. Diese Problematik wird auch in „Die Drehung der Schraube“ stark thematisiert. Die Gouvernante, in der englischen Provinz mit den sie überfordernden Problemen praktisch allein gelassen, wird ihrer Vorstellungskraft nicht mehr Herr. Die beiden Kinder vor der moralischen Korruption (in was auch immer diese genau bestehen mag) durch die in Unzucht (un)lebenden Geister zu beschützen, wird ihr persönlicher Kreuzzug. Dabei ist die Erzählweise der besondere Kniff: Wir erfahren den Ablauf der Handlung durch die Gouvernante selbst und so wird nie ganz klar, ob es sich um eine reale Bedrohung durch Geister (und damit um eine klassische Geistergeschichte) oder um eine neurotische Reaktion der nervlich überreizten Gouvernante (und demnach um eine psychologische Erzählung) handelt. „Die Drehung der Schraube“ stützt mal die eine, mal die andere Theorie und die Unsicherheit im Hinblick auf das tatsächliche Geschehen ist die Crux der Geschichte. Auch als Leser bzw. Hörer ist man stetig hin- und hergerissen, der Gouvernante oder den Kindern zu glauben, eine eindeutige Lösung wird allerdings nie präsentiert.
Das Hörspiel schafft es wunderbar, diesen Tanz auf dem Drahtseil aufrecht zu erhalten. Mal erscheint die Gouvernante vollkommen hysterisch. An anderer Stelle geben sich Miles und Flora dagegen durchaus dämonisch und man möchte an die Existenz der zerstörerischen Geister glauben. Das Hörspiel von |Titania Medien| lebt damit besonders von den drei Protagonisten: Rita Engelmann als Gouvernante, Charlotte Mertens als Flora und Lucas Mertens als Miles. Unterstützt wird die beklemmende Wirkung durch die atmosphärische Klaviermusik, die vor dem geistigen Auge prompt karge englische Landschaften heraufbeschwört, über die ein hartnäckiger Nebel hinweggeistert.
|Titania|-Mastermind Marc Gruppe hat sich mit „Die Drehung der Schraube“ an ein literarisches Meisterwerk gewagt. Das hätte auch schief gehen können, doch zielsicher bewahrt das Hörspiel die Mehrdeutigkeit der Erzählung und damit deren größten Reiz. Ob es sich nun tatsächlich um eine Geister- oder gar Gruselgeschichte handelt, muss jeder für sich entscheiden, kann „Die Drehung der Schraube“ doch ebenso als eine Metapher für das Wirken der Literatur im Allgemeinen gelesen werden. Das Geheimnis der Geschichte entzieht sich dem Leser, sobald er meint, es fassen zu können. Und gerade daraus, nicht aus den imaginären oder realen Geistern, zieht James‘ Erzählung ihre Faszination.
Bei Henry James‘ „Die Drehung der Schraube“ handelt es sich um ein Muss im Bücherschrank eines jeden Liebhabers. Und jetzt gilt dieses Muss auch für’s CD-Regal!
_Das |Gruselkabinett| auf |Buchwurm.info|:_
[„Carmilla, der Vampir“ 993 (Gruselkabinett 1)
[„Das Amulett der Mumie“ 1148 (Gruselkabinett 2)
[„Die Familie des Vampirs“ 1026 (Gruselkabinett 3)
[„Das Phantom der Oper“ 1798 (Gruselkabinett 4)
[„Die Unschuldsengel“ 1383 (Gruselkabinett 5)
[„Das verfluchte Haus“ 1810 (Gruselkabinett 6)
[„Die Totenbraut“ 1854 (Gruselkabinett 7)
[„Spuk in Hill House“ 1866 (Gruselkabinett 8 & 9)
[„Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ 2349 (Gruselkabinett 10)
[„Untergang des Hauses Usher“ 2347 (Gruselkabinett 11)
[„Frankenstein. Teil 1 von 2“ 2960 (Gruselkabinett 12)
[„Frankenstein. Teil 2 von 2“ 2965 (Gruselkabinett 13)
[„Frankenstein. Teil 1 und 2“ 3132 (Gruselkabinett 12 & 13)
[„Die Blutbaronin“ 3032 (Gruselkabinett 14)
[„Der Freischütz“ 3038 (Gruselkabinett 15)
[„Dracula“ 3489 (Gruselkabinett 16-19)
[„Der Werwolf“ 4316 (Gruselkabinett 20)
[„Der Hexenfluch“ 4332 (Gruselkabinett 21)
[„Der fliegende Holländer“ 4358 (Gruselkabinett 22)
[„Die Bilder der Ahnen“ 4366 (Gruselkabinett 23)
[„Der Fall Charles Dexter Ward“ 4851 (Gruselkabinett 24/25)
[„Die liebende Tote“ 5021 (Gruselkabinett 26)
[„Der Leichendieb“ 5166 (Gruselkabinett 27)
Im zweiten Teil der „Titania Special“-Reihe widmet sich das junge Hörspiel-Label einem literarischen Klassiker, nämlich der Geschichte um den kleinen Lord Cedric Errol, die im Original von Frances H. Burnett stammt und schon seit einer halben Ewigkeit junge und alte Leser begeistert. Nach der Buchvorlage und verschiedenen TV-Auflagen gibt es die Angelegenheit nun auch als Hörspiel, und wiederum hat man eine sehr prominente Riege aktueller Synchronsprecher auftreiben können, um dieses 100-minütige Projekt zu verwirklichen. Dementsprechend ist die Liste der beteiligten Personen auch geradezu ein Who-is-Who der Szene und liest sich wie folgt:
Lucas Mertens als Cedric Errol
Friedrich Schoenfelder (u. a. dt. Stimme von Alec Guiness) als Earl of Dorincourt
Christian Rode (Sean Connery) als Rechtsanwalt Havisham
Evelyn Maron (Kim Basinger) als Mrs. Errol
Dagmar von Kurmin als Lady Lorridaile
Heinz Ostermann als Silas Hobbs
Matthias Deutelmoser (Orlando Bloom) als Dick Tipton
Regina Lemnitz (Kathy Bates) als Mrs. Dawson
Arianne Borbach (Helen Hunt) als Minna Tipton
David Nathan (Christian Bale, Johnny Depp) als Mr. Higgins
_Story_
Der kleine Cedric Errol lebt mit seiner verwitweten Mutter in New York. Sein bester Freund ist der Gemischtwarenhändler Silas Hobbs, den Cedric auch jeden Tag besucht. Dort träumt Cedric davon, als Präsident der Vereinigten Staaten zu regieren – oder aber den Laden von Mr. Hobbs zu übernehmen. Der Traum, ein ganz Großer zu werden, soll ihm dann eines Tages tatsächlich erfällt werden: Ein gewisser Havisham sucht den aufgeweckten Jungen auf und bittet ihn, zusammen mit seiner Mutter nach England zu kommen, um die Position des Lords im Schloss seines Großvaters einzunehmen. Obwohl Cedric an seiner aktuellen Wohngegend hängt und sich eigentlich gar nicht von Mr. Hobbs und dem Schuhputzer Dick Tipton trennen möchte, reist er schließlich nach England und lernt dort seinen griesgrämigen Großvater kennen. Seine Mutter begleitet ihn, darf aber nicht mit ihm im Schloss wohnen, weil das Verhältnis zwischen ihr und dem Earl seit jeher gespalten ist – und das nur, weil sie Amerikanerin ist.
Cedric ist noch gar nicht lange vor Ort, da stellt er auch schon alles auf den Kopf. Der kleine Lord bringt eine Menge Lebensfreude mit und kann somit auch recht schnell das vorher scheinbar versteinerte Herz des Earls gewinnen. Doch gerade, als der alte Herr sich dem Jungen geöffnet hat und auch bereit ist, seine Mutter näher kennen zu lernen, taucht eine gewisse Minna Tipton auf und behauptet, den älteren Bruder von Cedrics Vater geheiratet und daher eher einen Anspruch auf den Thron zu haben. Doch bevor das letzte Wort in dieser Angelegenheit gesprochen ist, melden sich plötzlich Cedrics Freunde aus New York zu Wort, denen die suspekte, herrschsüchtigen Dame bestens bekannt ist …
Ähnlich wie auch das erste „Titania Special“ ist auch „Der kleine Lord“ eine sehr herzliche Geschichte mit liebevollen Charakteren, einer sehr schönen, mit sehr viel Moral versehenen Handlung und einem trotz des nahezu vorhersehbaren Endes guten Spannungsaufbau. Mit anderen Worten: Völlig zu Recht handelt es sich bei dieser Erzählung um einen Kinderbuch-Klassiker, der schon seit vielen Generationen immer wieder bemüht wird, dennoch aber nichts von seiner lebensfrohen Ausstrahlung verloren hat.
Es ist die Geschichte von einem kleinen, ganz gewöhnlichen Jungen, der bereit ist, die Welt zu verändern und mit seiner freundlichen und aufgeweckten Art weitaus mehr bewegen kann als andere Personen mit Reichtum und Macht. Cedric ist eine Person, die man einfach lieb haben muss, sei es nun, weil er so bodenständig, so intelligent, so vorlaut ist oder aber auch, weil er einfach für das steht, was den Begriff Liebe ausmacht. So gelingt es ihm während dieser Geschichte, den Earl und Mr. Hobbs von ihrer jeweiligen Abneigung gegen Amerika bzw. die Aristokratie abzubringen, den unsinnigen Streit zwischen seiner Mutter und dem sturen Großvater zu schlichten, die Liebe eines sonst so herzlosen Menschen zu gewinnen und sein ganzes Umfeld mit Freude zu erfüllen – egal ob nun am Hofe oder aber im Gemischtwarenladen von Silas Hobbs. Schließlich ist es dann auch noch seine Gutmütigkeit, die das klassische Stück so wertvoll macht und zu einer der schönsten Erzählungen der Weltliteratur hat werden lassen.
Das hier veröffentlichte Hörspiel verdient aber trotzdem noch einmal ein Extralob, weil es den verschiedenen Sprechern sehr schön gelungen ist, die Geschichte lebendig zu gestalten und auch die verschiedenen Stimmungen und Emotionen richtig schön herüberzubringen. Gerade Lucas Mertens in der Rolle des kleinen Lords gibt eine fabelhafte Figur ab und spielt den vorlauten kleinen Bengel sehr gekonnt. Sein Kontrapart in Sachen Stimmung steht ihm da in nichts nach: Friedrich Schönfelder als mies gelaunter Earl erzielt die gewünschte abschreckende Wirkung und verkörpert die zunächst herzlose Person ebenfalls mit deutlicher Hingabe. Doch genau das trifft hier zum wiederholten Male auf alle Beteiligten zu, weshalb ich mich auch gerne dazu hinreißen lasse, eine Behauptung wie „auf Titania Medien ist in Sachen Hörspiele Verlass“ in den Raum zu stellen. Wie auch schon der Vorgänger „Fröhliche Weihnachten, Mr. Scrooge“ ist diese Doppel-CD definitiv eine Anschaffung wert!
Als ich den Titel zum ersten Mal sah, dachte ich, dass es sich bei „Die Helden von Muddelerde“ um eine Kindererzählung mit starken Parallelen zu „Herr der Ringe“ handeln würde. Der Name der Welt und Charaktere wie der verrückte Zauberer Randalf legen ebenfalls nahe, dass Paul Stewart und Chris Riddell die berühmte Vorlage von Tolkien bemüht und für ihr farbenfrohes Märchen genutzt haben. Am Ende lösen sich diese Vergleiche allerdings in Luft auf, sieht man mal davon ab, dass sich hier auch einige Gefährten auf den Weg machen, um ihre Heimat zu retten – nur eben, dass die beiden Autoren das Ganze etwas durchgeknallter gestaltet haben.
_Story_
Muddelerde ist in Gefahr und braucht dringend einen Helden – ansonsten wird der grauenhafte Dr. Knuddel sehr bald die Herrschaft an sich reißen. Der ziemlich zerstreute Magier Randalf der Weise sieht sich deswegen in der Pflicht und zaubert einen Helden dabei. So findet sich der ganz normale Schuljunge Joe Jefferson urplötzlich in einer fremden Welt statt in seiner Schuklasse wieder – und seinen Hund Henri hat er auch direkt mitgebracht.
Das Team von der Erde hat jedoch nicht lange Zeit, sich großartig auf die neue Umgebung umzustellen, denn auch wenn Randalf von seinem seltsamen Helden nicht gerade begeistert ist, verlangt er von ihm, dass er als Heldenkrieger „Joe, der Barbar“ das große Zauberbuch beschafft und Dr. Knuddel und seine Besteckarmee von ihren schrecklichen Plänen abhält.
Gemeinsam mit dem Zauberer, dem trotteligen Oger Norbert, dem vorlauten Wellensittich Veronika und seinem Gefährten Henri macht sich Joe schließlich auf den Weg, um die für ihn völlig fremde Welt vor ihrem dunklen Schicksal zu retten …
_Meine Meinung_
Nachdem mir bereits die erste Folge der [„Klippenland-Chroniken“ 1936 von Paul Stewart und Chris Riddell sehr gut gefallen hatte, konnte mich nun auch die Geschichte aus Muddelerde von Anfang bis Ende begeistern. Wiederum hat Stewart eine wunderschöne und sehr humorvolle Geschichte inszeniert, der Riddell auf dem Cover und im gleichnamigen Buch mit verschiedenen bunten Illustrationen noch den letzten Feinschliff verpasst.
Erneut hat das Team sehr vielseitige Charaktere kreiert, die sich in ihren Eigenschaften kaum größer unterscheiden könnten, sich aber gerade deshalb auch so gut ergänzen. So sind coole Dialoge, witzige Kommentare und vor allem auch jede Menge Action garantiert. Doch bei „Die Helden von Muddelerde“ ist es auch die Landschaft, die uns des Öfteren zum Schmunzeln verleitet. So stoßen unsere Helden zum Beispiel auf ihrem Weg nach Koboldingen auf den verzauberten See, der allerings über der Erde schwebt. Desweiteren führt sie ihr Weg durch das Müffelgebirge, das seinen Namen aus eben jenem Grund, den manche hier vermuten werden, trägt. Es sind genau solch simple Wortwitze, die diese Erzählung auszeichnen und den besonderen und kinderfreundlichen Humor von Stewart ausmachen – und so auch aus „Die Helden von Muddelerde“ ein weiteres Muss für Freunde des modernen (Fantasy-)Märchens werden lassen.
Das Hörbuch zu „Die Helden von Muddelerde“, das wiederum vom einmaligen Volker Niederfahrenhorst erzählt wird, hat bei einer Spielzeit von 318 Minuten sogar genügend Freiraum, um die drei Kapitel des Buches detailreich und lückenlos wiederzugeben, und wiederum gelingt es dem Erzähler dabei, der Handlung seinen eigenen Stempel aufzudrücken und sie letztendlich komplett zum Leben zu erwecken. So hat man reichlich seinen Spaß, wenn Niederfahrenhorst dem ziemlich dummen Oger Norbert seine Stimme leiht, im nächsten Moment die schrille Stimme des Wellensittichs erklingen lässt und dann wiederum so weise klingt, wie die Rolle des Zauberers Randalf es erfordert. Und selbst die Kinderstimme von Joe bekommt er prima hin, und das war wohl mitunter eine der schwersten Aufgaben.
Ein irrwitziges Abenteuer – der Text auf dem Backcover verspricht nicht zu viel. Wie bereits gewohnt, beschert das Team Stewart & Riddell seinem Zielpublikum eine eigenartige, außergewöhnliche, aber dennoch sehr spannende und dringend lesens- bzw. in diesem Fall hörenswerte Geschichte, die in der gesamten Spielzeit nie langweilig wird und uns selbst nach mehr als fünf Stunden noch zum Lachen bringt. Wollen wir hoffen, dass die Fabelwesen aus Muddelerde und die Helden aus dieser Geschichte irgendwann wieder einen gemeinsamen Auftritt haben werden, denn das hier Gehörte schreit nach mehr. Eine sehr empfehlenswerte Angelegenheit, und das für alle Altersklassen!
_Details_
Erzähler: Volker Niederfahrenhorst
Musik: Barbara Buchholz
Ton: Ansgar Machalicky und Georg Niehusmann, Sonic Yard Studio, Düsseldorf
Bearbeitung und Regie: Dirk Kauffels
Illustrationen: Chris Riddell
http://www.patmos.de/
„Die Klippenland-Chroniken“ – da denkt man sofort an Fantasy, doch genau dies steckt nicht hinter dieser Geschichte von Paul Stewart und Chris Ridddell. Vielmehr haben die beiden Autoren ein recht modernes Märchen mit witzigen Hauptfiguren, einer recht einfachen (und daher auch für Kinder geeigneten) Handlung und klassischen Genre-Elementen gezaubert, über dessen Hauptfigur man im Laufe der Erzählung noch das ein oder andere Mal wird lachen können. Keine schwere Kost, aber eben auch kein voreilig inszeniertes Projekt – die Geschichte um den jungen Troll Twig, der auszieht, um die Welt zu entdecken, bietet Spaß für Jung und Alt!
_Story:_
Twig lebt bei seiner Familie im Reich der Waldtrolle, die mit dem jungen Tolpatsch allerdings nicht so viel anfangen können. Selbst diejenigen, die Twig anfangs für seine Freunde hält, stellen sich ihm in entscheidenden Situationen in den Weg und lassen ihn fallen. Als seine Mutter Spelda ihm dann auch noch eröffnet, dass er ein Findelkind ist, scheint die Katastrophe perfekt. Doch kurz vor seinem 13. Geburtstag, dem Tag, an dem man als Waldtroll erwachsen wird, schickt ihn Spelda fort, damit ihn die gefürchteten Himmelspiraten nicht holen können. Sie erklärt ihm noch den Weg durch den Dunkelwald und fordert ihren Stiefsohn auf, diesen Pfad niemals zu verlassen, doch dann lässt sie Twig auch schon losziehen, damit er sich in Sicherheit bringen kann.
Und so zieht Twig auf seinem einsamen Weg los, verläuft sich aber alsbald und trifft fortan auf immer seltsamere Gestalten. Da begegnet ihm der gefährliche Schwebewurm, dem er gerade noch so entkommen kann, er trifft auf einen fiesen Schlächter, dem er das Leben rettet, entwischt Skalpell und Bluteiche, eilt einem Banderbären zur Hilfe und lebt eine Zeit lang als Schoßhündchen bei den Höhlenfurien.
Twig sammelt eine Menge Erfahrungen, doch seine Abenteuerlust treibt ihn schließlich genau zu den Menschen, vor denen er sich eigentlich verstecken soll. Und so stößt er eines Tages auf das wohl prächtigste Piratenschiff, das je den Himmel befuhr …
„Die Klippenland-Chroniken“ und ihre Hauptfigur Twig sind in ganz Deutschland beliebt. Bereits 10.000 Leser haben sich dafür entschieden, zusammen mit Twig durch die gefährliche Welt des Dunkelwaldes zu reisen, was schließlich dazu führte, dass man die Geschichte auch als Hörbuch auflegte. Und hier, wo die Story jetzt zum Leben erweckt wird, fängt der Spaß erst richtig an, was hauptsächlich auch daran liegt, dass die Erzählstimme von Volker Niederfahrenhorst wirklich einmalig ist. Von einem Moment auf den nächsten wechselt er von der hohen in die tiefe Stimmlage und übernimmt einen völlig anderen Charakter. Der Mann verfügt tatsächlich über einen enormen Stimmumfang und lässt den Dunkelwald von der ersten bis zur letzten Sekunde mit all seinen Stimmungen aufleben.
In der Geschichte selber bekommt der Erzähler allerdings auch genügend Anlässe geboten, um sich richtig auszutoben, sei es nun bei der Begegnung mit dem Schlächter oder im Reich der Höhlenfurien, beim Anblick des Piratenschiffes oder beim traurigen Abschied von der Stiefmutter. Niederfahrenhorst durchlebt den Charakter des jungen Waldtrolls in der Erzählung, und das verhilft diesem Hörbuch natürlich auch zu einem großen Teil zu seiner Klasse.
Die Handlung an sich ist jedoch auch sehr schön. Natürlich finden sich viele Parallelen zu anderen Märchen (Thema: ein Junge wird verstoßen und kommt auch noch vom rechten Weg ab …), stellenweise auch zu bekannter Fantasy-Literatur, was aber kaum Einfluss auf den sehr eigenwilligen Charakter dieser Erzählung hat. Mit viel Wortwitz und nicht wenigen flotten Sprüchen begegnet Twig seinen neuen Freunden und Bekannten und kann so die Traurigkeit über sein trostloses Leben leicht überspielen. Aus dem eigentlich ernsten Stück wird so eine bunte, teils schillernde und allseits fröhliche Geschichte, deren Darsteller man sofort lieb gewonnen hat. Auf der ereignisreichen Reise durch den Dunkelwald findet man eine Menge Spaß, so dass die drei CDs mit einer Gesamtspielzeit von 215 Minuten wie im Flug vergehen. Kein Wunder also, dass der erste Teil der „Klippenland-Chroniken“ bereits einige Kritikerpreise hat einheimsen können – vor allem dank Volker Niederfahrenhorst. Von meiner Seite aus gibt es aber auch eine richtig dicke Empfehlung für dieses farbenfrohe und effektreiche (sehr schöne Sounds von Percussionist Olaf Normann) Märchen!
Wer sich einmal einen kleinen Eindruck verschaffen möchte, kann sich [hier]http://www.patmos.de/title/23/349124073/mode/quick/singleBook.htm eine kurze Hörprobe zu Gemüte führen.
_Details:_
Erzähler: Volker Niederfahrenhorst
Percussion & Sounds: Olaf Normann
Ton: Georg Niehusmann, Sonic Yard Studio, Düsseldorf
Illustrationen: Chris Riddell
aus dem Englischen von Wolfram Ströle
CD 1
1. Die Schnappholds
2. Der Schwebewurm
3. Die Schlächter
4. Das Skalpell
CD 2
1. Die Bluteiche
2. Der Banderbär
3. Der Faulsauger
4. Die Höhlenfurien I
CD 3
1. Die Höhlenfurien II
2. Garble, Plapperdrude und der Herzzauber
3. Die Himmelspiraten
4. Der Schleimschmeichler
5. Jenseits des Dunkelwaldes
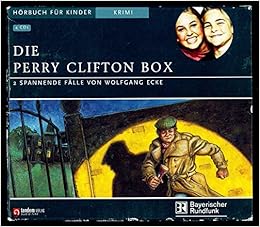
Inhalt
CD1
„Der silberne Buddha“
Ein berüchtigtes Verbrechertrio plant einen großen Coup. Die drei Komplizen haben es auf den goldenen Buddha abgesehen, das wertvollste Ausstellungssstück des Hartford-Hauses. Am Morgen nach dem Einbruch ist jedoch der silberne Buddha verschwunden. Meisterdetektiv Perry Clifton hat gleich zwei Rätsel auf einmal zu lösen: Warum haben die Diebe nicht den goldenen Buddha gestohlen? Und wieso sind sie zweimal in das Gebäude eingedrungen?
„Der Mann in schwarz“
Ein groß angelegter Diebstahl in einem französischen Hotel. Irgendjemand muss an der Fassade des Gebäudes herumgeklettert sein und dabei in verschiedenen Zimmern wertvolle Schätze gestohlen haben. Perry Clifton kann seinen Frankreich-Trip nur für kurze Zeit genießen und macht sich zusammen mit den heimischen Kollegen auf die Suche nach dem Täter.
CD 2
„Spionagering Rosa Nelke“
Heimtückische Spione treiben ihr Unwesen in England. Wer ist der Kopf der Bande? Könnte es sein, dass Perry schon einmal mit diesem gefährlichen Verbrecher zu tun hatte? Perry Clifton weiß: In dieser geheimen Mission darf ihm nicht der kleinste Fehler unterlaufen …
CD 3
„Das Geheimnis der weißen Raben“
Rätselhafte Dinge ereignen sich auf Schloss Catmoor in Schottland: Ein Brand bricht aus, Gegenstände verschwinden auf unerklärliche Weise, und nachts ertönt in den Räumen des Schlosses markerschütterndes Rabengeschrei … Perry Clifton wird beauftragt, das Geheimnis der weißen Raben zu lüften.
CD 4
„Das unheimliche Haus von Hackston“
Als Tom Harder, ein Freund Perry Cliftons, die Zeitungsmeldung über den Unfall liest, erinnert er sich: Den Wagen, von dem hier die Rede ist und neben dem man zertrümmerte bunte Geigen fand, hat er schon gesehen. Und zwar in jenem geheimnisvollen Hof in Hackston, wohin sich Tom kürzlich im Nebel verirrt hatte … Alles ist sehr mysteriös. Der Privatdetektiv Perry Clifton greift den Fall auf und steht bald vor nahezu unlösbaren Fragen. Was hat es – zu Beispiel – mit den bunten Geigen auf sich, die in dem unheimlichen Haus in Hackston hergestellt werden? Der Fall ist schwieriger und gefährlicher als erwartet – und seine Lösung verblüfft alle!
Die Geschichten des berüchtigten Meisterdetektives Perry Clifton sind in etwa vergleichbar mit „Die drei ???“, zumindest was Aufbau, Dramatik, Spannungsbogen und die kompakte Vertonung anbelangt. In kürzester Zeit gelingt es Wolfgang Ecke, die einzelnen Themen vorzustellen, den Detektiv in die Handlung einzugliedern und den jeweiligen Fall zu einem Mysterium zu machen. Dabei stechen die beiden Stücke „Der silberne Buddha“ und „Spionagering Rosa Nelke“ besonders hervor, weil Ecke hier ein Szenario kreiert hat, dessen dichte Atmosphäre sich dem Hörer quasi aufdrängt, und dessen individuelle Gestaltung dazu führt, dass der Hörer bis zuletzt kaum Motiv und Täter erahnen kann.
Im Gegensatz dazu fällt das neue Stück „Der Mann in schwarz“ erheblich ab. Zum einen ist die Geschichte und das Erzähltempo viel schneller, und zum anderen werden hier die einzelnen Fakten zu zügig aufgedeckt. Spannung ist jedenfalls nur ganz kurz (wenn überhaupt) aufzufinden. Wer also schon die vier regulären Hörspiele erworben hat, braucht eigens wegen des neuen Stücks nicht über eine eventuelle Anschaffung der Krimibox nachzudenken. Alle anderen täten aber gut daran, sich mit diesem opulenten Werk auseinanderzusetzen, zumal es hier eine Reihe exzellent arrangierter und mit wirklich sehr guten Darstellern ausstaffierter Hörspiele zu bewundern gibt, die in der Gesamtheit ihrer Spielzeit sehr kurzweilige und exzellente Unterhaltung bieten.
Als Letztes sei noch darauf hingewiesen, dass die Geschichten um Perry Clifton und seinen kleinen Hilfsdetektiv Dick für sämtliche Altersklassen geeignet sind. Weder brutale Inhalte noch anstößige Kommentare gibt es in den fünf kurzen Erzählungen zu hören, und das obwohl die Sprecher des Öfteren eine sehr lockere Zunge haben und redlich darum bemüht sind, die Kriminalgeschichten nicht mit altbackenen Redewendungen zu füllen. Das hält die Sache frisch und sollte schließlich auch eines der wichtigsten Argumente sein, die für ein Hereinschnuppern in diese 4-CD-Sammlung sprechen.
www.maritim-studioproduktionen.de
_Ein Großvater unter den Geisterhäusern._
Shirley Jacksons „Spuk in Hill House“ hat seit seinem Erscheinen 1959 schon einige Wiedergeburten hinter sich gebracht, unter anderem die beiden Verfilmungen „Bis das Blut gefriert“ (1963) und „Das Geisterschloss“ (1999). 2005 also hat sich [Titania Medien]http://www.titania-medien.de/ des Klassikers angenommen und ihn auf zwei CDs in ein melancholisch düsteres Klanggewand gehüllt.
Seinen Klassiker-Status hat „Spuk in Hill House“ nicht umsonst, finden sich doch darin all die Elemente, die noch heutzutage mannigfaltig variiert werden, um dem Gruselsüchtigen eine viktorianische Gänsehaut zu verpassen; Jacksons Roman ist geradezu ein Archetyp der Geisterhaus-Geschichte:
Hill House ist ein uraltes Herrenhaus, in dem sich nachts niemand aufzuhalten wagt; selbst die beiden Haushälter Dudley kehren vor Anbruch der Dämmerung in den Ort zurück, um den Spukerscheinungen des Gemäuers nicht ausgesetzt zu sein.
Das ist für Dr. John Montague ein gefundenes Fressen. Der Professor der Philosophie und Anthropologie ist brennend an der Erforschung übernatürlicher Phänomene interessiert, er erhofft sich von der psychischen Aktivität des Hauses Ergebnisse, die seinen zweifelnden Kollegen das Hohnlachen vom Gesicht wischen sollen. Zu diesem Zweck hat er zwei Versuchspersonen um sich geschart, die mit ihm die Nächte in Hill House verbringen sollen: Theodora, eine quirlige Exzentrikerin, die in dem Ruf steht, telepathische Fähigkeiten zu haben, und Eleanor Vance, eine sensible junge Frau, die mit Poltergeist-Phänomenen in Verbindung gebracht wird.
Mrs. Gloria Sanderson, die aktuelle Eigentümerin von Hill House, zeigt sich mit dem Vorhaben von Dr. Montague einverstanden, knüpft allerdings die Bedingung daran, dass ihr Neffe Luke ebenfalls in die Forschergruppe aufgenommen wird. Ein charmanter Tunichtgut sei er, erklärt sie dem Doktor, der mit sinnvoller Beschäftigung von seinem Dandy-Dasein abgebracht werden soll.
Als dann die erste Nacht heranbricht, haben sich zwischen den Teilnehmern bereits sympathische Bande geknüpft und das ist auch gut so: Schon jetzt beginnt sich unheimliches Leben in dem Haus zu regen …
_Ein Hauch von Moder._
Eine solche Story klingt heutzutage natürlich etwas staubig, aber andererseits auch nostalgisch und charmant. „Spuk in Hill House“ ist eine Wanderung in die Tiefe: Je tiefer die Forschungsgruppe in die Vergangenheit des Hauses taucht, desto tiefer taucht der Zuhörer in die Vergangenheit der Figuren. Besonders die verletzliche Seele von Eleanor Vance arbeitet sich schärfer heraus, ebenso wie die düsteren Seiten ihrer selbst. Aber auch die Beziehungen der Figuren untereinander differenzieren sich aus, sie entwickeln eine eigene Dynamik, die von den Phänomenen in Hill House vorangetrieben werden.
Das ist dann auch der entscheidende Unterschied zu Jan de Bonds Interpretation „Das Geisterschloss“: Auch wenn sich die Verfilmung ziemlich nah am Original hält, stehen dort die Geistererscheinungen von Hill House im Mittelpunkt; die Quelle dieser Erscheinungen wird ergründet, während die Figuren zwar wichtig sind, aber bei weitem nicht den Stellenwert einnehmen, wie sie es in dieser Hörspiel-Adaption tun.
Aus diesem Gruselgeschichten-Blickwinkel mag der Zuhörer dann vielleicht etwas enttäuscht sein, denn wo „Das Geisterschloss“ den Erscheinungen Namen gibt, bleiben die Ursachen in dieser Version verborgen; der Hörer muss sich mit den Spekulationen begnügen, die sich die Forschungsgruppe erarbeitet.
Über das Finale möchte ich hier natürlich nicht allzu viele Worte verlieren, aber so viel sei gesagt: Von der abgerundeten Konstruktion der 1999er Verfilmung ist es weit entfernt. Ob das nun gut oder schlecht ist, muss der geneigte Hörer entscheiden, beide Versionen befriedigen, wie ich finde, nicht völlig.
_Ohrenkino der Oberliga._
Tontechnisch haben |Titania Medien| hier eine exzellente Leistung vollbracht. Die Musik und die Sounds sorgen für genau die Atmosphäre, die diese Geschichte braucht: ruhig, düster und melancholisch. Man kann das Holz und das Kaminfeuer fast riechen, ständig entstehen Bilder im Kopf und das Echo der Hill House´schen Hallen scheint sich bis ins Wohnzimmer auszubreiten. Wer sich nicht auf mein Wort verlassen möchte, mag sich auf die Homepage von |Titania| begeben, dort nämlich gibt es eine Hörprobe zum kostenlosen Download.
Auch die Wahl der Sprecher ist hervorragend: |Titania Medien| haben für ihre Hörspiele hauptsächlich illustre Stimmen verpflichtet und diese zudem perfekt auf die zu sprechenden Figuren ausgewählt: Da haben wir die freche und selbstbewusste Theodora (Arianne Borbach, u. a. Sprecherin für Catherine Zeta Jones), die schüchterne Eleanor (Evelyn Maron, die u. a. Kim Basinger ihr hauchendes Organ leiht), den sympathisch eloquenten Luke (David Nathan, u.a. Johnny Depp & Christian Bale) oder Dr. John Montague (Christian Rode, u. a. Sean Connery), dessen herrlich knorriges Organ den weisen Wissenschaftler gibt, wie ihn wohl kaum ein anderer hinbekommen hätte.
Zwar kommt, wie gesagt, die Story mit einem Hauch von Gilb und einem schwächelnden Finale daher, aber diese professionelle Produktion lässt einen darüber locker hinweghören. „Spuk in Hill House“ lädt einfach dazu ein, sich behaglich in den Sessel fallen zu lassen, um sich durch eine ruhig erzählte Geschichte tragen zu lassen. Ein wunderbares Mittel gegen die schon jetzt aufkeimenden Ausläufer der Winter-Depression, und ein passender Zeitvertreib für verregnete Abende.
Das „Grusel Kabinett“ von Titania sollte man jedenfalls weiterhin im Auge behalten!
|Infos und Bestellmöglichkeit bei amazon.de:|
[Teil I]http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3937273131/powermetalde-21
[Teil II]http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/393727314X/powermetalde-21
_Das |Gruselkabinett| auf |Buchwurm.info|:_
[„Carmilla, der Vampir“ 993 (Gruselkabinett 1)
[„Das Amulett der Mumie“ 1148 (Gruselkabinett 2)
[„Die Familie des Vampirs“ 1026 (Gruselkabinett 3)
[„Das Phantom der Oper“ 1798 (Gruselkabinett 4)
[„Die Unschuldsengel“ 1383 (Gruselkabinett 5)
[„Das verfluchte Haus“ 1810 (Gruselkabinett 6)
[„Die Totenbraut“ 1854 (Gruselkabinett 7)
[„Spuk in Hill House“ 1866 (Gruselkabinett 8 & 9)
[„Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ 2349 (Gruselkabinett 10)
[„Untergang des Hauses Usher“ 2347 (Gruselkabinett 11)
[„Frankenstein. Teil 1 von 2“ 2960 (Gruselkabinett 12)
[„Frankenstein. Teil 2 von 2“ 2965 (Gruselkabinett 13)
[„Frankenstein. Teil 1 und 2“ 3132 (Gruselkabinett 12 & 13)
[„Die Blutbaronin“ 3032 (Gruselkabinett 14)
[„Der Freischütz“ 3038 (Gruselkabinett 15)
[„Dracula“ 3489 (Gruselkabinett 16-19)
[„Der Werwolf“ 4316 (Gruselkabinett 20)
[„Der Hexenfluch“ 4332 (Gruselkabinett 21)
[„Der fliegende Holländer“ 4358 (Gruselkabinett 22)
[„Die Bilder der Ahnen“ 4366 (Gruselkabinett 23)
[„Der Fall Charles Dexter Ward“ 4851 (Gruselkabinett 24/25)
[„Die liebende Tote“ 5021 (Gruselkabinett 26)
[„Der Leichendieb“ 5166 (Gruselkabinett 27)
_Der Schöpfer der utopischen Insel_
Thomas Morus gilt als einer der größten Freidenker der britischen Geschichte und wird als einer der wichtigsten Philosophen und Schriftsteller seiner Zeit eingeordnet. Erasmus von Rotterdam sagte über Morus (dessen eigentlicher Name Thomas More war), dass |“dessen Seele reiner war als der reinste Schnee, dessen Genius so groß war, wie England nie einen hatte, ja nie wieder haben wird, obgleich England eine Mutter großer Geister ist“|.
Morus wurde am 7. Februar 1477 oder 1478 (nicht genau bekannt) in London geboren und genoss nach der Erziehung am Hofe des Lordkanzlers und Erbischofs von Canterbury, Jorn Morton, ein Studium am Canterbury College. 1492 kehrte er für ein Jahr nach London zurück, um dort eine juristische Ausbildung zu absolvieren. Sieben Jahre später trifft er zum ersten Mal auf Erasmus von Rotterdam. Kurze Zeit später verwirft Morus seine Pläne von einem Leben als Priester im Kloster und wird Mitglied des Parlaments. Dort macht er 1510 zunächst als Vertreter des Sheriffs in Rechtsangelegenheiten (in London) und später als Sprecher des Parlaments Karriere. 1529 schließlich tritt Morus die Nachfolge des abgesetzten Lordkanzlers Thomas Wolseys an, legt diesen Posten jedoch aus Protest gegen die antipäpstliche Politik von König Heinrich VIII. wieder nieder. 1535 wird Thomas Morus im Tower von London enthauptet.
Genau 400 Jahre später, nämlich 1935, wird Thomas Morus von Papst Pius XI. heilig gesprochen.
_Der Klassiker_
Das lateinische Urwerk „Utopia“ wurde von Thomas Morus 1516 veröffentlicht und diente dem Zweck, die zeitgenössische Politik in der Heimat durch fiktive Überspitzung anzuprangern. Erst 16 Jahre nach seinem Tod wurde das Buch in der englischen Sprache herausgegeben.
_Wohlstand und leichte Arbeit für alle …_
…, ein Liebesleben ohne Konflikte und Kultur von Kindesbeinen an – dies sind nur einige wenige der revolutionären Gedanken, die Morus in „Utopia“ erdachte. Morus erzählt in seinem zweiteiligen Buch die Geschichte des seefahrenden Philosophen Raphael Hythlodaeus, der zufällig auf die Insel Utopia gestoßen ist und diesen Ort als besonderen Hort der Harmonie kennen gelernt hat – dies alles zu einer Zeit, in der seine britischen Zeitgenossen von Krieg und Armut bedrängt waren.
Morus hat insgesamt eine überaus satirische Fassung des modernen Lebens erschaffen und in diesem Sinne auch keinen Unterpunkt des zwischenmenschlichen Miteinanders oder der gängigen Kultur ausgelassen. So beschreibt er in Person des Raphael Hythlodaeus die zu dieser Zeit revolutionäre Regierungsform, die gerechte Arbeitsteilung sowie Nichtigkeiten wie Ehebruch und Verbrechungen in relativ kurzen Abhandlungen und widmet sich weitaus detailreicher der Tugend und der Lust sowie dem Umgang mit den Staatseigentümern, dem Kriegswesen und dem Wert der Religion für die Beziehungen der Menschen auf Utopia.
Morus formuliert in „Utopia“ seine Idealvorstellung einer Gesellschaft, die nicht in einzelne Kasten aufgeteilt ist, sondern stattdessen mit gleichen Rechten, gleichen Voraussetzungen und einem hohen Maß an Lebenslust ausgestattet ist. Gleichermaßen betont Morus, dass diese Gesellschaftsform trotz der zu befürchtenden Konflikte problemlos funktioniert und Schändlichkeiten wie Verbrechen oder aber Neid nur in ganz wenigen Fällen auftreten und daher quasi als ’nicht existent‘ betrachtet werden dürfen.
Auf der anderen Seite äußert der Autor dadurch, dass er beschreibt, was „Utopia“ nicht ist, die Kritik an der Regierungsform und der Klassengesellschaft im Europa des 16. Jahrhunderts, ganz besonders in seinem Heimatland England. Dies war damals ein gewagter und natürlich von vielen kritisierter Schritt, den sich Morus aber als gebildeter Freidenker, einflussreicher Politiker und Idealist erlauben durfte. Leider konnte der Mann den Ruhm seines Werkes zu Lebzeiten nicht mehr ernten, der Wert des Inhalts ist aber dennoch bis heute unumstritten genial.
_Das Hörspiel_
Die hier vorgestellte Version ist nicht die einzige ihrer Art. Erst kürzlich hat es eine 4-CD-Version, gelesen von Hans Eckhardt, gegeben, die sich mit dem Gesamtwerk „Utopia“ beschäftigte. Die über den LIDO-Verlag erschienene Neuversion hingegen läuft unter dem Kommentar ’sorgsam gekürzte Fassung‘ und enthält in 173 Minuten nur das zweite Besuch, also die eigentliche Charakterisierung der Insel Utopia und ihrer Menschen. Ulrich Matthes als Vorleser wirkt zunächst noch ein wenig blass, weil er stets in derselben Tonlage spricht und – so meint man zunächst – die Vorlage nur so herunteredet, um die Zeit zügig abzuarbeiten. Doch genau dieses Trockene und Emotionslose zeichnet diese Lesung schließlich auch aus. „Utopia“ ist nämlich ein Bericht und keine spannende Erzählung. Und als Reisebericht vom Besuch einer seltsamen Insel, auf der die Welt so wunderbar und schön ist wie nirgendwo anders, auf der die Menschen frei von Problemen sind und wo man sich keine Sorge um das Durchstehen des nächsten Tages machen muss, eignet sich Ulrich Matthes‘ Stil wirklich perfekt.
_Der Vorleser_
Ulrich Matthes wurde in Berlin geboren. Nach ein paar Semestern Germanistik und Anglistik entschied er sich für die Schauspielerei. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den renommierten Gertrud-Eysoldt-Ring. Zuletzt war er in der Rolle des Joseph Goebbels im Kinoerfolg „Der Untergang“ sowie in Volker Schlöndorffs Film „Der neunte Tag“ zu sehen, für den er als bester Hauptdarsteller für den Deutschen Filmpreis 2005 nominiert wurde.
_Unterm Strich_
Leider liegt mir die andere oben angesprochene Hörbuch-Version von „Utopia“ nicht vor, um einen direkten Vergleich vorzunehmen. Unabhängig davon kann ich dieses 2-CD-Set nur wärmstens weiterempfehlen; zum einen, da es sich ausschließlich auf den Kern der Handlung beschränkt, und zum anderen, weil Vorleser Matthes mit seinem Vortrag dieses Klassikers der Weltliteratur eine tadellose Vorstellung gibt.
Linktipp: [Digitale Reproduktion]http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/more/utopia/ der Baseler Ausgabe von 1518.
John Sinclair sollte absolut keinem Hörspiel-Fan unbekannt sein, immerhin zählt die erfolgreiche Serie um den mysteriösen Geisterjäger schon 34 Episoden (von denen die Folgen 31-34 im November & Dezember erscheinen werden). Abseits davon gibt es aber auch zwei Sondereditionen, von denen mir die erste, „Der Anfang“, nun zur Rezension vorliegt. Dieses besondere Hörspiel beschäftigt sich mit den Anfängen des jungen Inspektors von Scotland Yard sowie mit seinem ersten Kontakt mit übersinnlichen Erscheinungen.
Als Einführung in die Welt von John Sinclair ist „Der Anfang“ daher sowieso esenziell, doch auch im Bezug auf die Handlung ist dieses Hörspiel ein absolutes Klassewerk, das den ’normalen‘ Episoden aus dieser Reihe in nichts nachsteht.
_Story:_
In einer kleinen Gemeinde in Schottland ist ein junges Mädchen gestorben. Das Ehepaar Winston hat die gemeinsame Tochter gerade betrauert, da bricht auch schon der nächste Schock über sie herein. Kaltblütig wird die Mutter von einer sonderbaren Gestalt zur Strecke gebracht, während ihr Mann im Wohnzimmer des Hauses eingenickt ist. Nach dem bösen Erwachen sammelt Ronald jedoch zügig seine Gedanken und eilt seinen Kindern, die ebenfalls von dieser Erscheinung bedroht werden, zur Hilfe. Mit letzter Kraft gelingt es ihm, das mysteriöse Wesen zu erledigen, doch der sich ihm bietende Anblick ist noch schockierender als die Vision seiner verstorbenen Frau: Ronald sieht in dem Wesen den Geist der verstorbenen Tochter, der nach seinem Angriff zu Staub zerfällt.
Bei der ortsansässigen Polizei glaubt Ronald natürlich niemand, und so wird der Familienvater des Mordes an seiner Frau angeklagt, zumal ihn seine sprachlosen und noch immer schockierten anderen Kinder nicht entlasten können. Andererseits findet Winston bei den Behörden auch einen Fürsprecher, der nicht daran glaubt, dass der Mann zu einem solchen Verbrechen fähig ist. Als die jüngste Tochter dann die Geschichte ihres Vaters bestätigt, kommt für diesen schon jede Hilfe zu spät: Ronald hat sich im Gefängnis erhängt.
Hilfesuchend wendet sich der zuständige Polizeibeamte an Scotland Yard, woraufhin Inspector John Sinclair sich des Falles annimmt. Sinclair, eigentlich ein kühler Analytiker, der in der Regel seine Fälle durch rationales Denken und mit Hilfe seiner Berufsroutine löst, muss vor Ort jedoch schnell feststellen, dass hinter den Verbrechen mehr steckt, als sich der Normalsterbliche vorzustellen vermag. Die Spur führt ihn zu einem Schloss, von dem die ebenfalls frisch angereiste Klatschreporterin Ann Baxter nicht mehr zurückgekehrt ist, geradewegs in die Hände des russischen Professors Ivan Orgow. Doch Sinclair bleibt nicht viel Zeit, um neue Bekanntschaften zu machen; Orgow hat nämlich ein teuflisches Mittel entdeckt, um die Toten wieder auferstehen zu lassen, und dessen bedient er sich nun mittels eines Mediums, um somit durch die Unterstützung wandelnder Leichen die Weltherrschaft an sich zu reißen. Der Inspektor von Scotland Yard ist trotz der unglaublichen Geschehnisse dazu gezwungen, Ruhe zu bewahren, doch als eine Schar lebendiger Toter durch die Straßen der kleinen Stadt wandelt und gleichzeitig ein verheerendes Zugunglück den Ort erschüttert, verliert der ansonsten ruhige Beamte langsam aber sicher die Nerven …
Die Inszenierung der Handlung ist von den Machern dieses Hörspiels wirklich perfekt arrangiert worden. Beständig schwebt man als Hörer zwischen den Gedanken, ob es sich hier um reine Fiktion oder doch um die Realität handelt, denn immer wieder finden die ermittelnden Charaktere rationale Erklärungen für die seltsamen Geschehnisse, die sich in dem kleinen schottischen Dorf abspielen. Ergänzt wird diese Spannung durch die gruseligen Effekte, die ihre Wirkung selten verfehlen und den Hörer so manches Mal aufzucken lassen; das ist eben beste Gruselspannung und nicht zu Unrecht Teil einer Klassiker-Serie!
Einen noch größeren Anteil am Gelingen dieses Hörspiels haben aber die zahlreich involvierten Sprecher (über 30 an der Zahl), denen man deutlich anmerkt, dass sie die Geschichte nicht nur mit ihrer Stimme begleiten, sondern den Inhalt wirklich leben. Besonders im Falle des von Joachim Tennstedt (Stimme von John Malkovich, Dustin Hoffman, Michael Keaton) gesprochenen Kommissars Brad Jones und des gemeinen Ivan Orgow (gesprochen von Tilo Schmitz, der Stimme von Ron Perlman), aber natürlich auch beim Hauptdarsteller John Sinclair, dem Frank Glaubrecht (Stimme von Pierce Brosnan, Kevin Costner, Jeremy Irons, Richard Gere, Al Pacino, Christopher Walken und vielen mehr) wie immer seine Stimme geliehen hat, fällt dies sehr positiv ins Gewicht und verstärkt die enorm düstere Atmosphäre. Hier haben Idealisten gearbeitet, für die „Der Anfang“ nicht nur ein weiterer Job war! Aber – und da darf ich jetzt gerne eine fast schon klischeebehaftete, aber in der Tat allgemeingültige Aussage machen – Perfektion wird bei John-Sinclair-Hörspielen seit jeher groß geschrieben.
Andererseits sollte aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass dieses Hörspiel wohl eher erst ab dem fortgeschrittenen Jugendalter zu empfehlen ist, denn die Geschichte mit ihren zahlreichen Morden und den teilweise blutrünstigen Charakteren ist in Sachen Brutalität schon ziemlich harter Tobak; gerade bei „Der Anfang“ geht es, um es einmal umgangssprachlich zu formulieren, ziemlich zur Sache. Die Action ist ständig im Gange, und wenn dann mal ein kurzer musikalischer Zwischenpart eingeflochten wird, dann auch nur, um die düstere Stimmung der Handlung nachhaltig zu unterstreichen.
Das Fazit zu „Der Anfang“ könnte also kaum besser sein: In 77 Minuten und über 30 Kapiteln entwickelt sich hier eine spannende, düstere und nicht gerade leicht verdauliche Story, die auf ständigen erzählerischen Höhepunkten aufbaut und nicht eine Minute Zeit zum Durchatmen lässt. Veredelt wird das Ganze übrigens vom rockigen Titelsong der Rockband BLACKMAIL, der zum Schluss für spürbare Entspannung sorgt. Dieses Hörspiel sollte man gehört haben, am besten noch bevor man sich so richtig an das Thema John Sinclair heranbegibt.
http://www.sinclairhoerspiele.de/
_|Geisterjäger John Sinclair| auf |Buchwurm.info|:_
[„Der Anfang“ 1818 (Die Nacht des Hexers: SE01)
[„Der Pfähler“ 2019 (SE02)
[„John Sinclair – Die Comedy“ 3564
[„Im Nachtclub der Vampire“ 2078 (Folge 1)
[„Die Totenkopf-Insel“ 2048 (Folge 2)
[„Achterbahn ins Jenseits“ 2155 (Folge 3)
[„Damona, Dienerin des Satans“ 2460 (Folge 4)
[„Der Mörder mit dem Januskopf“ 2471 (Folge 5)
[„Schach mit dem Dämon“ 2534 (Folge 6)
[„Die Eisvampire“ 2108 (Folge 33)
[„Mr. Mondos Monster“ 2154 (Folge 34, Teil 1)
[„Königin der Wölfe“ 2953 (Folge 35, Teil 2)
[„Der Todesnebel“ 2858 (Folge 36)
[„Dr. Tods Horror-Insel“ 4000 (Folge 37)
[„Im Land des Vampirs“ 4021 (Folge 38)
[„Schreie in der Horror-Gruft“ 4435 (Folge 39)
[„Mein Todesurteil“ 4455 (Folge 40)
[„Die Schöne aus dem Totenreich“ 4516 (Folge 41)
[„Blutiger Halloween“ 4478 (Folge 42)
[„Ich flog in die Todeswolke“ 5008 (Folge 43)
[„Das Elixier des Teufels“ 5092 (Folge 44)
[„Die Teufelsuhr“ 5187 (Folge 45)
[„Myxins Entführung“ 5234 (Folge 46)
[„Die Rückkehr des schwarzen Tods“ 3473 (Buch)
„Das Phantom der Oper“ ist das vierte Hörspiel aus der kultigen „Guselkabinett“-Reihe mit den miesen Coverbildern und den höchst unterhaltsamen Inhalten. Beim „Phantom der Oper“ denkt jeder zwangsläufig an Andrew Lloyd Webber, Kahnfahrten in unterirdischen Gewölben und schmachtende Opernduette. Dagegen anzukämpfen, ist nicht leicht, doch in gewohnt überzeugender Manier liefern |Titania Medien| unter der Leitung von Marc Gruppe ein schauerliches Hörspiel in Starbesetzung.
Die Handlung ist wohl in den groben Zügen bekannt: Die junge Christine Daaé (gesprochen von Marie Bierstedt) fristet ihr Dasein als Chormädchen an der Pariser Oper, bis das geheimnisvolle Phantom (Torsten Michaelis) sie unter seine Fittiche nimmt und unterrichtet. Selbiges Phantom ist von Geburt an entstellt und lebt, zynisch und Menschen verachtend, unter der Oper, um zur abendlichen Vorstellung heraufzuklettern und in Loge 5 die Musik zu genießen (denn zufällig ist er auch noch ein sehr guter Sänger UND Architekt). Die neue Leitung der Oper sieht dieses Arrangement gar nicht gern, schließlich ist Loge 5 eine der teuersten des Hauses und könnte auch anderweitig verkauft werden. So entbrennt ein Machtkampf zwischen dem Opernmanagement und dem Phantom, während dieser Christine fördert und die Operndiva La Carlotta (Ursula Heyer) zum Gespött des Publikums macht. Dann betritt auch noch Christines Jugendfreund Raoul (Patrick Winczewski) die Bühne und Christine findet sich plötzlich zwischen zwei Männern wieder, von denen einer nicht davor zurückschrecken wird, den Rivalen zu töten …
Das Hörspiel kann wie immer mit wunderbaren Soundeffekten garantieren, sodass der geneigte Zuhörer prompt in die richtige Stimmung gebracht wird. Im Hintergrund breiten sich orchestrale Klangteppiche aus und erschaffen überzeugend die Illusion, sich in einer Oper zu befinden. Doch das Hörspiel steht und fällt mit der Darstellung des Phantoms, und Torsten Michaelis (Stimme von Wesley Snipes und Sean Bean) macht seine Sache ausgesprochen gut. Sein Phantom pendelt zwischen dem Bedürfnis nach Zuneigung und Freundschaft und dem Wunsch, die Menschen, die ihm das Leben so schwer machen, möglichst genussvoll zu zerstören. Er kann liebenswert und hilfsbereit, aber auch rachsüchtig und gnadenlos sein. Ob man nun Mitleid mit dem Phantom hat oder ihm dem Tod wünscht, bleibt also dem Zuhörer überlassen – eine leichte moralische Entscheidung ist es auf keinen Fall.
Hinter Torsten Michaelis‘ brillanter Darstellung müssen die anderen Sprecher zwangsläufig zurückstehen. Gerade des Phantoms Gegenspieler Raoul, gesprochen von Patrick Winczewski (wohl eher bekannt als Synchronstimme von Tom Cruise und Hugh Grant), bleibt im direkten Vergleich blass, naiv und uninteressant. Einzig die zickige Diva La Carlotta kann mit dem Phantom mithalten, da Ursula Heyer sich schwer ins Zeug legt und wohl über vier Oktaven schreit, zickt, meckert und generell ziemlich unerträglich ist.
Gaston Leroux’s „Das Phantom der Oper“, das 1910 erstmals erschien, hat bis heute nichts von seiner Faszination eingebüßt. Angelehnt an die Geschichte von der Schönen und dem Biest, spricht die romantische Handlung immer noch Menschen aller Couleur an. Wohl auch darum wird der Stoff immer wieder neu verarbeitet. Schon 1925 gab es die erste Verfilmung des Romans und erst 2004 kam die vorerst letzte in die Kinos. Am bekanntesten ist sicherlich die Musical-Adaption von Andrew Lloyd Webber. Und Marc Gruppes Hörspielversion reiht sich nahtlos in die lange Geschichte des Stoffes ein.
Der versprochene Grusel ist hier allerdings eher ein angenehmer Schauer, der sich ausbreitet, wenn man mit Christine die unterirdischen Gewölbe der Oper erkundet und die Gegenspieler des Phantoms in meisterlichen Spiegelkabinetten gefangen sind. Im Vordergrund steht die dem Untergang geweihte unglückliche Liebesgeschichte zwischen Christine und dem Phantom. Es lässt sich also ausgesprochen gut schmachten bei diesem Hörspiel aus dem |Titania|-Programm und romantische Gemüter werden am Ende sicherlich die eine oder andere Träne wegwischen müssen.
[Titania Medien]http://www.titania-medien.de hat sich innerhalb kürzester Zeit mit seiner Gruselkabinett-Reihe bei Hörern und Kritikern nach vorn gebracht. Bereits im Frühjahr dieses Jahres konnte |Titania| den Kritikerpreis der Hörspiel-Awards abstauben und auch dieses Jahr ist das Label gleich bei zwei Awards nominiert. Zu einem echten Kauf-mich-Preis bringt Marc Gruppe klassische Texte der Horrorliteratur auf den Silberling, jedes Mal mit bekannten Sprechern und tollen Klangeffekten. Da macht das Reinhören immer wieder aufs Neue Spaß.
_Das |Gruselkabinett| auf |Buchwurm.info|:_
[„Carmilla, der Vampir“ 993 (Gruselkabinett 1)
[„Das Amulett der Mumie“ 1148 (Gruselkabinett 2)
[„Die Familie des Vampirs“ 1026 (Gruselkabinett 3)
[„Das Phantom der Oper“ 1798 (Gruselkabinett 4)
[„Die Unschuldsengel“ 1383 (Gruselkabinett 5)
[„Das verfluchte Haus“ 1810 (Gruselkabinett 6)
[„Die Totenbraut“ 1854 (Gruselkabinett 7)
[„Spuk in Hill House“ 1866 (Gruselkabinett 8 & 9)
[„Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ 2349 (Gruselkabinett 10)
[„Untergang des Hauses Usher“ 2347 (Gruselkabinett 11)
[„Frankenstein. Teil 1 von 2“ 2960 (Gruselkabinett 12)
[„Frankenstein. Teil 2 von 2“ 2965 (Gruselkabinett 13)
[„Frankenstein. Teil 1 und 2“ 3132 (Gruselkabinett 12 & 13)
[„Die Blutbaronin“ 3032 (Gruselkabinett 14)
[„Der Freischütz“ 3038 (Gruselkabinett 15)
[„Dracula“ 3489 (Gruselkabinett 16-19)
[„Der Werwolf“ 4316 (Gruselkabinett 20)
[„Der Hexenfluch“ 4332 (Gruselkabinett 21)
[„Der fliegende Holländer“ 4358 (Gruselkabinett 22)
[„Die Bilder der Ahnen“ 4366 (Gruselkabinett 23)
[„Der Fall Charles Dexter Ward“ 4851 (Gruselkabinett 24/25)
[„Die liebende Tote“ 5021 (Gruselkabinett 26)
[„Der Leichendieb“ 5166 (Gruselkabinett 27)
„Die vergessene Welt“ („The Lost World“) aus der Feder von Sherlock-Holmes-Erfinder Sir Arthur Conan Doyle wurde im Jahr 1912 zunächst als Fortsetzungsroman im britischen |Strand Magazine| veröffentlicht, eroberte kurz darauf als Buch die Bestsellerlisten und gilt heute zusammen mit Werken wie Jules Vernes „20.000 Meilen unter den Meeren“ und H. G. Wells‘ „Die Zeitmaschine“ als Meilenstein der phantastischen Literatur und des SciFi-Genres. Die |Great Britain Oxford Press| nennt „The Lost World“ eine der größten Abenteuergeschichten, die je geschrieben wurden. Conan Doyles Urzeitriesenspektakel war außerdem Inspirationsquelle für Werke wie „King Kong“ und „Jurassic Park“.
_Die Sprecher in der Reihenfolge ihres Auftretens:_
Maple White: Robert Missler
Blondell: Thomas Nicolai
McArdle: Jochen Schröder
Edward D. Malone: Timmo Niesner
Der alte Malone (Erzähler): Peter Weis
Professor Summerlee: Jürgen Thormann
Dr. Illingworth: Lothar Blumhagen
Professor Challenger: Klaus Sonnenschein
Lord Roxton: Ronald Nitschke
Sir Douglas: Friedrich Schoenfelder
Affenmenschen und Indianer: Die Maulhelden
Musik und Sounddesign: Jan-Peter Pflug
Geräusche: Martin Langenbach
Technik Berlin: Ahmed Chouraqui und Max von Werder
Technik Hamburg: Fabian Küttner
Regieassistenz: Antje Seibel/Kai Lüftner
Hörspielbearbeitung, Produktion und Regie: Frank Gustavus
Aufgenommen im On Air Studio Berlin, April 2005
Hörsaalaufnahmen: Museum für Völkerkunde Hamburg, Mai 2005
Gemischt im Eimsbütteler Tonstudio Hamburg, Juli/August 2005
http://www.ripperrecords.de
_Story:_
London im Jahre 1912: Der durchgeknallte Professor Challenger ist unter seinen Kollegen alles andere als beliebt und gilt gemeinhin als Aufschneider, der keinen Widerspruch duldet und auch gerne mal handgreiflich wird, wenn man versucht, ihm ins Werk zu pfuschen. Dementsprechend froh ist der Redner einer Podiumsdiskussion auch, als der verschrobene Wissenschaftler nicht wie angekündigt an dieser teilnimmt. Als dann aber bei eben jener Sitzung über das Leben von Tieren aus der Urzeit gesprochen wird, taucht Challenger plötzlich auf und behauptet, auf einem Hochplateau im südamerikanischen Dschungel lebendige Dinosaurier entdeckt zu haben.
Natürlich wollen ihm seine Kollegen nicht glauben, doch als der Redner die Menge anstachelt und schließlich veranlasst, dass Challengers größter Kritiker Professor Summerlee, sein Anhänger Lord Roxton und der abenteuerlustige Zeitungsreporter Edward D. Malone sich vor Ort selber ein Bild machen sollen, um die Welt vom Wahrheitsgehalt von Challengers Aussagen zu unterrichten, brechen die Abenteurer zu einer Expedition in den südamerikanischen Urwald auf, die sie wohl ihr Leben lang nicht vergessen werden …
Bevor sie jedoch im Dschungel ankommen, fühlen sie sich schon gelinkt, weil der angebliche Lageplan eine Fälschung ist. Dann taucht jedoch der Überraschungsgast Challenger auf und betont, dass er dringend bei dieser Reise selber dabei sein muss.
Gemeinsam zieht das vierköpfige Team, unterstützt von einigen Expeditionshelfern, mitten in den Urwald, und noch bevor Summerlee Challenger zum hundersten Mal beschuldigt, dass dieser sich lediglich Lügengeschichten ausgedacht habe, muss auch der ‚vernünftige‘ Professor feststellen, dass der Dschungel voll von Sauriern, totgeglaubten Vögeln und verschiedenen Eidechsen ist. Und bevor sich Summerlee und seine Gefährten richtig eingelebt haben, werden sie auch schon von diesen Geschöpfen verfolgt, müssen sich vor Flugsauriern verstecken und aus der Gefangenschaft eines Stammes von Affenmenschen entfliehen. Das Abenteuer in der vergessenen Welt hat begonnen …
„Die vergessene Welt“ ist ein vielzitierter Klassiker, der ganz klar als Inspiration für diverse Monster-Filme aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, aber auch für solche Spektakel wie „Jurassic Park“ hergehalten hat.
Die Hörspiel-Version dieses legendären Werkes bringt es insgesamt auf eine Spielzeit von 122 Minuten, und obwohl die Art und Weise, wie die Geschichte aufgebaut ist, und auch der inhaltliche Aspekt wirklich vom Allerfeinsten sind, wünscht man sich zwischendurch noch etwas mehr Detailarbeit, denn für meinen Geschmack kommt die Action im Dschungel ein wenig zu kurz. Natürlich ist es nicht leicht, die dort vorherrschende Atmosphäre auf diesem Medium originalgetreu wiederzugeben, gerade wenn man bedenkt, dass der Schwerpunkt auf den Dialogen liegen muss. Aber hier hätte man meiner Meinung nach ein wenig die Prioritäten verschieben müssen. Ich finde nämlich, dass die ständigen Feindseligkeiten zwischen Challenger und seinem gesamten Kollegium zugunsten tiefer ausgeschmückter Action-Sequenzen etwas in den Hintergrund gehören, aber da kann man sicher auch geteilter Meinung sein.
Ansonsten ist „Die vergessene Welt“ allerdings wirklich ein echtes Meisterwerk, auch als Hörspiel. Die Geschichte um den Professor, dem keiner glaubt, das von ihm entdeckte Urzeit-Gebiet und die spannende Expedition von vier vollkommen unterschiedlichen Charakteren, gibt nun mal eine ganze Menge her, und |Ripper Records| haben diese Vorgaben auch fabelhaft umgesetzt.
Das Abenteuer wird aus der Perspektive des alten Malone erzählt, der rückblickend wie in Tagebuch-Form von seinem Erlebnis im südamerikanischen Urwald mit den beiden Professoren und dem schießwütigen Lord Roxton berichtet. Dabei wechselt das Szenario im Jahre 1912 immer wieder zwischen dem Professoren-Kollegium in London, das den Schilderungen des Zeitungsreporters Malone in seinem Stammblatt |Gazette| keinen Glauben schenken will, und den vier Menschen, die im Urwald um ihr nacktes Überleben kämpfen. Vielleicht hätte man auch hier nicht immer wieder betonen müssen, dass die Menschen abseits des Dschungels die Ergebnisse der Expedition für bloßes Gewäsch halten, denn das kommt seitens der Erzählerstimme wirklich sehr häufig durch. Ansonsten ist das ständige Pendeln aber genau das richtige Mittel, um die beiden Welten sinnvoll miteinander zu verknüpfen und die Spannung in Bezug auf das eigentliche Abenteuer immer am Höhepunkt zu halten.
Zu meiner Schande muss ich allerdings gestehen, dass ich den Roman von Sir Arthur Conan Doyle noch nicht gelesen habe, gelobe aber für die nächsten Wochen Besserung. Das Hörspiel hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht, und wenn die Romanvorlage nur ansatzweise so gut gestaltet ist wie dieses zweistündige Hörspiel, dann blicke ich der Lektüre mit großer Vorfreude entgegen. Aber immerhin hat ja hier der Autor von Sherlock Holmes zur Feder gegriffen …
_Fazit:_
„Die vergessene Welt“ ist ein tolles Abenteuer-Hörspiel, das zwar in wenigen Passagen ein bisschen überdramatisiert dargestellt wird, ansonsten aber von der fabelhaften und ausnahmslos überzeugenden Performance der Sprecher über die Produktion bis hin zum wundervollen Inhalt gelungen ist.
In Form von „Kommissar X“ haben sich |Maritim| an einen weiteren Krimi-Klassiker aus den Fünfzigern herangewagt und ihn als Hörspiel neu aufgelegt. Nach der Originalromanvorlage von Patrick Wynes ist so eine 63-minütige, arg kurzweilige Geschichte entstanden, die spannend erzählt wird, aber im Gegensatz beispielsweise zu den Hörspielen aus der Edgar-Wallace-Reihe nicht ganz das Flair dieser besonderen Zeit versprüht. Damit komplettiert der berüchtigte Kommissar nun sein Auftreten auf dem Büchermarkt, nachdem es bereits 1740 Titel gibt, die entweder als Heft, Buch oder eBook erschienen sind.
|Sprecher:|
Jo Walker: Robert Missler
Tom Rowland: Michael Weckler
April Bondy: Marianne Lund
u. a.
Romanvorlage: Patrick Wynes
Drehbuch und Regie: Susa Gülzow
Musik: Alexander Ester
Tonmeister: Carsten Berlin, Hans-Joachim Herwald, Peter Harenberg
Produktion: Nocturna Audio
Laufzeit: ca. 63 Minuten
_Story:_
In New York geht die Angst vor einem mysteriösen Serienmörder um. Ein schwarz gekleideter und maskierter Killer hat es auf all die Menschen abgesehen, die wegen Notzuchtverbrechen angeklagt waren, trotzdem aber freigesprochen wurden, nachdem ein gewisser Anwalt namens Lovelyn die jeweiligen Mandanten vertreten hatte. Dachten die fiesen Verbrecher zunächst noch, dass ihnen der Freispruch aus der Patsche helfen würde, mussten sie eines Tages erfahren, dass er gleichzeitig ihr Todesurteil bedeutete. Der maskierte Mörder, der von der Presse auch „Der Panther aus der Bronx“ genannt wird, rächt sich nämlich aus einem bislang noch unbekannten Motiv an den Frauenschändern und Vergewaltigern und schlägt jedes Mal völlig unerwartet zu. Auch die Art und Weise, wie er seine Opfer zur Strecke bringt, ändert sich individuell und reicht von einem Mord mit einem asiatiischen Langschwert bis hin zur Sprengung einzelner Gebäude.
Wie ein Phantom bewegt sich der Panther und hinterlässt nach seinen sauber geplanten Taten keine Spur außer dem typischen Erkennungszeichen, einem bltuigen Mal auf den Gesichtern der Toten, für das er anscheinend messerscharfe Krallen eingesetzt hat.
Kommissar Jo Walker, in Fachkreisen auch als Kommissr X bekannt, erhält eines Tages den Anruf einer verzweifelten Frau, die ihm eröffnet, dass ihr Sohn unter Verdacht steht, eine Frau vergewaltigt zu haben und somit auch vom Panther aus der Bronx gefährdet ist. Walker möchte zwar die Tat des jungen Mannes nicht decken, lässt sich aber trotzdem auf die Dame ein und übernimmt den Auftrag, ihn zu beschützen. Dies hätte er allerdings besser nicht getan, denn die unscheinbare Frau ist die Gattin eines berüchtigten Mafiabosses, der überdies nicht sonderlich darüber erfreut ist, dass Kommissar X plötzlich in seinem Umfeld als Privatdetektiv herumschnüffelt …
_Bewertung:_
Obwohl die Geschichte sehr spannend und mitreißend erzählt wird – Robert Missler, der den Kommissar X aus der Ich-Perspektive spricht, macht hier einen verdammt guten Job -, läuft sie nach der Hälfte der Zeit doch auf ein absehbares Ende zu, denn auch wenn das Motiv des Killers nicht klar ist, so kommen doch nur wenige Personen in Frage, die sich hinter der Tarnung des Panthers befinden könnten, und im Endeffekt scheiden bis auf eine dann alle aus. Trotzdem hat die Geschichte auf ihre Weise einen besonderen Reiz, der in erster Linie von der astreinen Darbietung der drei vertretenen Sprecher(innen) ausgeht. Auch wenn die Wortwahl teilweise ein wenig einsilbig ist und sich manche Sätze in ihrer Essenz alle paar Minuten wiederholen, gelingt es dem Ensemble, diese potenzialreiche Geschichte mit einem packenden Unterton zu versehen, der die gute Stunde Spielzeit im Flug vergehen lässt. Die Handlung ist von Anfang an sehr schlüssig, die unerwarteten Morde sorgen für die notwendigen Wendungen und die Vorlage an sich gibt auch einiges her. Lediglich die Atmosphäre ist nicht ganz so spannungsvoll geraten und kann auch durch die Hintergrundmusik nicht diesen Status erreichen. Manchma wird sogar das genau Gegenteil erreicht, nämlich dann, wenn als Zwischensequenz einige Klangmalereien kommen, die auch schon für die „Alf“-Hörspiele herhalten mussten. Irgendwie will das nicht so recht passen …
An so etwas möchte ich mich aber jetzt nicht hochziehen, denn mir hat die Erzählung wirklich Freude gemacht und ich habe mich von diesem Hörspiel bestens unterhalten gefühlt. „Kommissar X – Der Panther aus der Bronx“ ist deswegen noch lange nicht das Nonplusultra auf diesem Gebiet, aber ganz sicher eine Bereicherung des Krimi-Sektors, die man sich als Fan auch blind anschaffen kann – trotz vereinzelter Schwächen.
Bereits zum zweiten Mal spielt Andy Materns Jingle zu „Necrophobia“ auf und lädt den geneigten Hörer ein, sich die „besten Horrorgeschichten der Welt“ zu Gehör zu führen. 2003 enthielt die erste Ausgabe von [„Necrophobia“ 1103 Geschichten von Lovecraft und Laymon und auch 2005 hat Mastermind Lars Peter Lueg wieder eine illustre Mischung auf zwei CDs gebannt. Fünf Geschichten darf der Hörer genießen, deren Bandbreite so groß ist, dass für jeden etwas dabei sein dürfte: eine gruselige Seemannsgeschichte, ein fanatischer Sammler, ein lebendig Begrabener, ein wandelndes Monster und ein religiöser Serienmörder haben in „Necrophobia“ ihren großen Auftritt.
Den Anfang macht William Hope Hodgons „Die Stimme der Nacht“ („The Voice in the Night“, 1914) mit einem durchaus interessanten Setting. Zwei Seeleute machen in einer finstren und nebligen Nacht eine außergewöhnliche Begegnung. Durch den Nebel hören die beiden ein „Schiff Ahoi“ auf sie zutreiben und machen kurz darauf in der Dunkelheit der Nacht ein Boot aus. Der Insasse weigert sich standhaft, nähert ans Licht zu kommen, bittet aber um etwas Proviant für die Dame, die er auf der Insel zurückließ. Die beiden Seemänner haben Mitleid, lassen ihm frische Früchte zukommen und im Gegenzug erzählt der mysteriöse Fremde seine Geschichte. So konnte er sich nämlich mit seiner Frau gerade so von einem sinkenden Schiff retten. Doch die Insel, auf die sie sich retten konnten, scheint von einem seltsamen und abstoßenden Pilz überwuchert zu sein, der vor nichts Halt macht. Die beiden harren zwar zwangsweise auf der Insel aus, doch sind sie dort gefangen und dem Pilz hoffnungslos ausgeliefert …
Hodgons Erzählung mäandert etwas dahin und bietet kaum unerwartete Überraschungen. Sie lebt vielmehr von dem beunruhigenden Gefühl, in völliger Freiheit eingesperrt zu sein und keine Hoffnung auf Rettung zu haben. Das junge Ehepaar kann nirgendwohin ausweichen, ihr Feind verfolgt sie überallhin. Und auch wenn sie es nicht wissen, als sie die Insel betreten, so sind sie doch bereits zum Tode verurteilt, als sie den Fuß auf den Strand setzen. Die Geschichte spielt mit der alten Frage, was sich alles da draußen in dieser Welt befindet; welche Schätze und Grauen noch nicht entdeckt sind. Und auch wenn wir heute meinen, uns die Welt untertan gemacht zu haben, so gibt es immer noch Flecken wie diese Insel, die böse Überraschungen bereithalten können.
Helmut Krauss bildet den Anfang als Sprecher auf dieser Höranthologie. Krauss (Synchronsprecher von Marlon Brando & Samuel L. Jackson) liest oft und viel für LPL und seine tiefe dräuende Stimme verfehlt nie ihre Wirkung. Hier überzeugt er vor allem als krächzender und lebensmüder Erzähler, dem man die Verzweilfung und Hoffnunslosigkeit anhört.
Weiter geht es mit dem totalen Gegenprogramm, Kim Newmans „Der Mann, der Clive Barker sammelte“ („The Man who collected Barker“, 1990), einer Erzählung, die zwischen böser Parodie und wohl temperiertem Schrecken hin und her pendelt. Die Ich-Erzählerin trifft auf einen Mann, dessen Lebensinhalt das Sammeln von Pulp-Autoren ist. Erstausgaben, signiert, mit persönlicher Widmung schmücken seine Privatbibliothek, die so eingerichtet ist, dass die Bücher möglichst nicht verblassen oder sonstwie Schaden nehmen. Der Sammler stellt sich schnell als fanatischer Spinner heraus (daher ja auch das Wort „fan“ von „fanatic“) und Kim Newman zielt und platziert genüsslich einen Seitenhieb nach dem anderen auf all die Berufsfans da draußen, diese Geeks, die so weit in ihrem Fandom aufgehen, dass sie darüberhinaus kein Leben haben. Newman schreibt damit das genaue Gegenprogramm zu Nick Hornbys Hymne an Fans und Sammler und Geeks moderner Popkultur, und dass er zunächst in seiner Beschreibung des Sammlers kaum überzeichnet, setzt der ganzen Sache die Krone auf. Doch als er die Ich-Erzählerin in den Schrein für Clive-Barker-Erstausgaben führt, wird es zusehends abstruser. Da gibt es Ausgaben in Menschenhaut gebunden, auf Papyrus gedruckt und mit Blut signiert. Eine Sonder-Sonderausgabe ist grauenhafter als die nächste und die Krönung seiner Sammlung ist die Ausgabe … doch das soll hier natürlich nicht verraten sein.
Newmans Erzählung ist eine wunderbar spritzige und dabei bitterböse Abrechnung mit fanatischen Fans aller Art. Die gesammelten Objekte sind ein Fetisch, ein Kunstwerk in sich und es wäre ein Sakrileg, würde der Sammler sie aus dem Regal nehmen und tatsächlich lesen. Ja, er habe sich Barkers [„Bücher des Blutes“ 538 mal aus der Bibliothek ausgeliehen und die Geschichten seien auch gut gewesen. Aber gehen wir lieber zu dieser Sonder-Sonderausgabe über … Das Objekt der Begierde kann vollkommen willkürlich gewählt sein, denn es scheint nicht, dass unser Sammler eine besondere Vorliebe für Pulp hat – offensichtlich liest er ja nicht mal. Doch wenn das Objekt erst einmal gewählt wurde, dann muss es besessen und beherrscht werden.
Marianne Groß (bekannt als Synchronstimme von Angelica Huston, Merryl Streep, Whoopie Goldberg) ist neu als Sprecherin bei LPL und nach ihrem Debüt auf „Necrophobia“ möchte man doch hoffen, dass sie den Hörbuchfans lange erhalten bleibt. Mit spitzer Zunge referiert sie die gesammelten Absurditäten der Barker-Sammlung und man hört ihr die Verachtung für derartiges Fanverhalten geradezu an. Ein wahres Fest!
Abgeschlossen wird CD1 mit einer kurzen Erzählung über ein altes Thema: „Rettungslos“ (1903) von Paul Busson beschreibt aus der Ich-Perspektive einen Mann, der lebendig begraben wurde. Neu ist an dieser Idee kaum etwas, doch schafft es Busson zumindest, das Grauen durch seinen Stil greifbar zu machen. Da dem Protagonisten nur noch sein Gehör zur Verfügung steht, schildert er hauptsächlich diese Eindrücke. Das Schließen des Sargdeckels, das Geräusch, als die Trauernden Erde auf den Sarg fallen gelassen wird – und erst dann, begraben unter ein Paar Metern Erde, kann er endlich zwei seiner Finger wieder bewegen. Doch natürlich zu spät.
Lutz Riedel, ebenfalls seit langem für LPL tätig, liest „Rettungslos“. Leider ist die Geschichte so schnell vorbei, dass man sich kaum eingehört hat. Doch Riedel (Stimme u. a. von Timothy Dalton; mit Marianne Groß liiert) schafft es, den eindringlichen Bewusstseinsstrom des Protagonisten ebenso eindringlich wiederzugeben. Ein beunruhigendes Finale für die erste CD der Anthologie.
Auf CD2 geht es mit dem Altmeister subtilen Horrors weiter, nämlich mit „Der Außenseiter“ („The Outsider“, 1926) von H.P. Lovecraft. Wer nicht ohnehin schon die Lovecraft-Hörbuchreihe von LPL im Regal stehen hat, der wird hier ordentlich angefüttert. Ein recht geheimnisvoller Ich-Erzähler – geheimnisvoll in dem Sinne, dass er sich nicht erinnern kann, wie wo und mit wem er eigentlich aufgewachsen ist -, versucht seiner Umgebung zu entrinnen. Er wohnt nämlich in einem unheimlichen Schloss, das so von Bäumen umstanden ist, dass er noch nie Sonne oder Mond gesehen hat. Also steigt er auf den höchsten Punkt des Schlosses, öffnet eine Falltür und … muss mit einer ziemlichen Überraschung fertig werden.
Der Erzählung merkt man schon nach den ersten Sätzen den Lovecraft’schen Stil an und nie verfehlt er seine Wirkung. Surreale Settings, lauernde Schatten, offene Fragen – all das verbindet Lovecraft mit einer Meisterschaft, die auch heute noch menschliche Urängste anspricht und zum Vorschein bringt. Man kann sich also eines unfreiwilligen Schauderns nicht erwehren, auch wenn man die Pointe der Geschichte schneller durchschaut als der Ich-Erzähler. Lovecrafts genialer Einfall, die Geschichte aus der Innenansicht des vermeintlichen Monsters zu erzählen, verwischt die sonst so klaren Grenzen einer Horrorgeschichte und trägt zum Gruselfaktor unbedingt bei.
David Nathan (Johnny Depp, „Spike“, Christian Bale,) als Sprecher ist ebenfalls seit einiger Zeit bei LPL dabei – zu Recht, versteht sind, denn seine Bandbreite weiß immer wieder zu überraschen. Mit viel Einfühlungsvermögen gibt er den Bericht des Außenseiters wieder und schafft Balance zwischen Mitgefühl und Abscheu.
Den Abschluss bildet die grausig-schwüle Slashergeschichte „Summertime“ („Fish are Jumping, and the Cotton is High“, 1996) von S. P. Somtow, die idyllisch genug beginnt: Vater und Sohn verbringen wie jedes Jahr den Sommer damit, durch das amerikanische Hinterland zu fahren und zu fischen. Doch schon bald stellt sich heraus, dass an der ganzen Sache nichts idyllisch ist. Zum einen führen die beiden das Skelett ihrer toten Oma in einem Koffer mit, stauben sie regelmäßig ab und behängen sie mit Wunderbäumen (gegen den Gestank natürlich). Zum anderen handelt es sich bei „fischen“ um einen Euphemismus dafür, Huren zu entführen, sie brutal zu foltern und dann zu töten. Alles im Namen des Herrn, versteht sich. Denn der Serienmörder ist ein religiöser Fanatiker.
Somtow liefert eine durchdachte Geschichte, die zwar große Mengen Blut produziert (und damit die hartgesottenen Fans begeistern dürfte), aber nicht vergisst, den beiden Hauptcharakteren ausreichend psychologischen Hintergrund mitzugeben, um die Geschichte zu tragen. Wenn Somtow also in die völlig zerstörte Psyche des Protagonisten eintaucht, dann ist das abwechselnd absurd, komisch, schockierend und eklig. „Summertime“ bildet einen wunderbaren modernen Gegensatz zu so polierten Erzählungen wie Lovecrafts „Der Außenseiter“ und trägt „Necrophobia“ sowohl thematisch als auch stilistisch ins 21. Jahrhundert.
Torsten Michaelis (als Synchronstimme von Wesley Snipes offensichtlich total unterfordert) liest hier aus der Perspektive des Sohnes des Serienmörders und fängt dessen gestörte Wahrnehmung der Realität grandios ein. Mit kindlicher Naivität findet er es ganz selbstverständlich, die tote Oma im Auto mitzuführen und die knackigen Hinterteile der toten Huren zu essen (um die Leichen zu entsorgen und weil das Fleisch dort am leckersten ist).
Über einen Anspruch wie „die besten Horrorgeschichten der Welt“ wird man immer streiten können. Doch ohne Frage überzeugt die Auswahl der Geschichten, sind sie doch in Thema und Stil jeweils sehr unterschiedlich und bieten somit für jeden Geschmack etwas. Abgerundet wird die Anthologie von hochkarätigen Sprechern, die die 146 Minuten Spielzeit zu einem unheimlichen Vergnügen machen!
http://www.lpl.de
Bei |LPL records| kennt man sich mit gepflegtem Grusel ja aus. In schöner Regelmäßigkeit werden dort ansprechende Hörbücher mit hochkarätigen Sprechern produziert und der Slogan von LPL, „Gänsehaut für die Ohren“, ist keineswegs ein leeres Versprechen. Bei LPL hat man schon Lovecraft oder Lumley auf CD gebannt, den Zuhörer mit Gruselmärchen unterhalten und HR Giger für eine Zusammenarbeit gewonnen. Bei so viel Gruselpotenzial darf natürlich auch ein Altmeister des gotischen Grauens nicht fehlen: Bram Stoker, wohl am besten (und fast ausschließlich) für seinen [„Dracula“ 210 bekannt, hat eine durchaus stolze Anzahl Romane und Kurzgeschichten geschrieben. Es gibt also keinen Grund, dem Hörer noch eine Interpretation des „Dracula“ zu bieten (die gibt es schon zur Genüge), stattdessen hat man sich bei LPL für drei Kurzgeschichten entschieden.
In „Draculas Gast“, der titelgebenden Geschichte, treffen wir auf Jonathan Harker, der auf seiner Reise nach Transsilvanien gerade einen Stopp in München einlegt. Von der Abenteuerlust gepackt, begibt er sich auf eine Ausfahrt, um die Gegend zu erkunden – die Warnungen seines Kutschers nicht beachtend. Dieser nämlich stirbt fast vor Angst, ist doch grad Walpurgisnacht. Dem Engländer allerdings bedeutet der kontinentale Volksglauben im katholischen Bayern überhaupt nichts, und so treibt er seine Erkundungstour nötigenfalls auch ohne den schlotternden Kutscher voran. Allerdings nicht, bevor dieser ihm eine unheimliche Geschichte von einem verlassenen Dorf ganz in der Nähe erzählt hat, dessen Bewohner offensichtlich Vampiren zum Opfer fielen. Jonathan lacht dem Kutscher – und der Gefahr – ins Gesicht, schickt die Kutsche zurück zum Hotel und geht zu Fuß weiter. Bald trifft er auf einen Friedhof, auf ein seltsames Grab, auf einen starken Schneesturm und und einen viel zu zutraulichen Wolf … Selbst dem überhaupt nicht abergläubischen Jonathan wird es da mulmig.
„Draculas Gast“ ist eigentlich das verworfene erste Kapitel von Stokers großem Roman über den Grafen der Vampyre und damit merkt man der Geschichte den Expositionscharakter auch an. Eigentlich wirft die Geschichte nämlich mehr Fragen auf als sie klärt, besonders nach dem ominösen Schluss (der hier natürlich nicht verraten wird). Stoker nimmt sich viel Zeit, seinen Handlungsort zu schildern und den Leser auf die kommenden unheimlichen Ereignisse einzustimmen. Und auch hier, stärker noch als später im Roman, wird dem Protagonisten seine überhebliche Haltung gegenüber dem Glauben und den Gebräuchen seines Reiselandes zum Verhängnis – offensichtlich ein beliebtes Thema für Stoker, wie die beiden anderen Kurzgeschichten zeigen werden. Zu Hochform läuft Stoker auf, wenn er die aufgewühlte Natur während des Schneesturms beschreibt. Wald und Wetter werden zum personifizierten Gegner, zu einem Charakter innerhalb der Geschichte, der zu großen Teilen für das Unwohlsein seines Zuhörers verantwortlich ist. Harker dagegen ist nur ein Spielball größerer Mächten – sein aufgeklärter Rationalismus hilft ihm angesichts solcher Ereignisse nicht weiter.
In „Das Haus des Richters“ geht es traditioneller und geordneter zu. Der Student Malcolm Malcolmson zieht sich aufs Land, genauer ins Städtchen Benchurch, zurück, um dort ungestört für sein Mathematikexamen lernen zu können. Er mietet sich in einem leer stehenden Haus ein, das im Ort nur als „das Haus des Richters“ bekannt ist, was bei der Gastwirtin hysterische Anfälle auslöst, ohne dass sie erklären könnte, was es mit dem Haus genau auf sich hat. Doch Malcolm, genauso rational veranlagt wie Jonathan Harker, lässt sich von einem neurotischen Frauenzimmer nicht schrecken und macht es sich in dem Haus bequem. Zunächst kommt er mit dem Lernen auch gut zurecht und lässt sich selbst von den zahlreich vorhandenen Ratten nicht stören (er ist eben sehr stoisch). Zwar befindet sich unter den Ratten auch ein besonders großes Exemplar, das sich ganz selbstverständlich auf einem Sessel niederlässt, doch kann er das Tier vertreiben, indem er es mit Büchern bewirft (was für eine Taktik). Nun sollte ihm zu denken geben, dass seine Mathematikbücher keine Wirkung zeigten und die Ratte sich nur durch die geworfene Familienbibel vertreiben ließ – doch Malcolm ist wie gesagt Rationalist und fröhnt keinesfalls dem Aberglauben.
Natürlich wird ihm letztendlich genau diese Einstellung zum Verhängnis und das Haus des Richters macht seinem Namen alle Ehre. Und so hat der arme Malcolmson ganz umsonst für sein Examen gelernt, stellt sich doch letztendlich heraus, dass die riesige Ratte gar keine Ratte ist.
„Das Haus des Richters“ ist eine klassische Gruselgeschichte über ein Spukhaus, das dennoch (oder gerade deswegen) seine Wirkung nicht verfehlt. Zwar bleiben einige Fragen offen, doch überzeugt Stoker gerade in der Beschreibung der Abgeschiedenheit seines Handlungsortes. Und natürlich läuft sein Protagonist Malcolmson sehenden Auges in sein Unglück, sodass man nur begrenztes Mitleid für ihn entwickeln mag.
Die dritte Geschichte, „Die Sqaw“, ist gleichzeitig der makabre Höhepunkt des Hörbuchs. Ein Ehepaar in den Flitterwochen (doch ihre romantischen Neigungen halten sich in Grenzen) befinden sich auf Sightseeingtour in Nürnberg. Ihnen schließt sich der Amerikaner Hutcheson an, der das Ehepaar durch seine Anwesenheit fortan nicht nur vom Streiten abhält, sondern es auch mit Abenteuergeschichten unterhält. Die beiden fressen, aus irgendeinem unverständlichen Grund, sofort einen Narren am laustarken und überheblichen Hutcheson, der beweist, dass das Stereotyp des unverdient selbstbewussten Amerikaners nicht erst eine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist. Und so stellt sich Hutcheson selbst zwar als liebenswürdig und empfindsam dar, beschreibt die Indianer seiner Heimat aber als brutale Barbaren und ist sich nicht zu schade, eine Geldbörse aus Menschenhaut bei sich zu tragen. Kurzum: Dem Leser stößt Hutcheson mehr und mehr auf. Und das geht auch einer Katze so, auf die das Trio auf der Nürnberger Burg stößt. Hutcheson erschlägt – ganz aus Versehen natürlich – deren Junges mit einem Stein und spätestens seit Poe wissen wir, dass mit Katzen nicht zu scherzen ist. Hutcheson wird sein Ende finden, und es wird besonders blutig und besonders unangenehm sein.
Wieder ereilt den Protagonisten, der unfähig ist, andere Kulturen zu verstehen und zu akzeptieren, ein tödliches Schicksal. Doch wo Harker und Malcolmson noch Sympathien beim Leser hervorrufen konnten, da sieht man sich in „Die Sqaw“ unversehens auf der Seite der Katze wieder, die geschickt Rache an Hutcheson nimmt und so den Tod ihres Nachwuchses rächt. Das Ende, das Hutcheson ereilt, wird von Stoker lange und genüsslich vorbereitet und der Leser weiß längst, welchen Ausgang die Geschichte nehmen wird, als Hutcheson sich noch lautstark amüsiert.
Es ist wirklich eine Bereicherung, mal etwas anderes von Stoker genießen zu können als immer nur „Dracula“, wenn natürlich, der Gerechtigkeit halber, hinzugefügt werden muss, dass „Dracula“ sein bestes und suggestivstes Werk bleiben wird. Doch Stokers gotische Kurzgeschichtenschrecken vermögen auch heute wohlige Schauer hervorzurufen, gerade wenn sie von einem so patenten Sprecher wie Lutz Riedel vorgetragen werden. Mit Freude arbeitet er jeweils auf den Höhepunkt der Geschichte hin, um diesen dann ausgiebigst auszukosten. Billige Effekte braucht es da nicht. Stimme und Wortgewalt reichen vollkommen aus. Abgerundet wird das Hörbuch wie immer durch die Musik von Andy Matern, dessen dräuende Melodien dem Hörer wohlige Schauer über den Rücken laufen lassen werden. Mal wieder ist |LPL| damit ein Treffer ins Schwarze gelungen!
Wo soll man beginnen, wenn man mit der schier unlösbaren Aufgabe betraut wurde, ein Hörspiel von 713 Minuten zu besprechen, das dazu noch die komprimierte Fassung eines Romans von 1300 Seiten ist? Mit der Handlung? Wohl kaum, schließlich gibt es nach der Verfilmung von Peter Jackson fast niemanden mehr, der nicht zumindest eine grundlegende Ahnung davon hat, worum es in J. R. R. Tolkiens „The Lord of the Rings“ geht: Ein Hobbit, nämlich Frodo Baggins, wird – recht unfreiwillig – mit der Aufgabe betraut, den Ring Saurons zu zerstören; ein Symbol für das ultimativ Böse. Parallel dazu gibt es Schlachten, Männer auf Wanderschaft, seltsame Rassen, viele Lieder und Gedichte und so etwas wie eine Liebesgeschichte. Die Handlung braucht hier also nicht rekapituliert werden, ist sie doch auch viel zu komplex, um sie in drei Absätzen wiederzugeben.
Womit also sonst beginnen? Den technischen Daten? Die 713 Minuten Spielzeit verteilen sich auf beeindruckende 10 CDs, die in einem stilsicheren Pappschuber nach Hause kommen. Dazu gibt es ein kleines Booklet mit einer Einleitung von Brian Sibley, der zusammen mit Michael Blakewell das Drehbuch für das Hörspiel schrieb. Eine ganze Reihe bekannter Namen wurden verpflichtet, allen voran natürlich Ian Holm als Frodo und Peter Woodthorpe als Gollum, der die Rolle bereits in Ralph Bakshis Trickfilmversion des Stoffes verkörperte („The Lord of the Rings“, 1978). Nach zwei Monaten im Studio wurde die erste der 26 Episoden von „The Lord of the Rings“ am 8.3.1981 auf Radio 4 im UK ausgestrahlt.
Vielleicht sollte man also einfach von vorn beginnen: Nämlich im Shire, diesem idyllischen Flecken (Mittel-)Erde, in dem die Geschichte vom Ringkrieg seinen Anfang nimmt. Das Hörspiel lässt sich für die Exposition viel Zeit, und bis die Hobbits Rivendell erreichen, vergehen zwei CDs. Zwar fehlt auch in der Hörspielversion Tom Bombadil, doch lässt sich die Erzählung zunächst viel Zeit, um die Hobbits vorzustellen und zu charakterisieren und Hintergrundwissen unterzubringen (so wird beispielsweise das Kapitel „Riddles in the Dark“ aus dem [„Hobbit“ 481 mit eingeflochten, um zu erklären, wie Bilbo an den Ring gekommen ist). Es gibt viel Interaktion zwischen Frodo und Bilbo und gerade Ian Holm als Frodo klingt viel erwachsener und ernster als sein Gegenpart Elijah Wood im Film. Auch William Nighy (wohl besser bekannt als Bill Nighy, zu sehen in Filmen wie „Underworld“ oder „Love, Actually“) als Sam spricht sich sofort in die Herzen der Zuhörer. Und die Tatsache, dass er eine wunderbare und ausdrucksstarke Singstimme hat, verstärkt diesen Effekt noch. Im Gegensatz zum Film arbeitet das Hörspiel nämlich oft und gern mit den Liedern und Gedichten, die Tolkien in sein Werk hat einfließen lassen. So dürfen mehrere Charaktere von Zeit zu Zeit singen oder rezitieren und man hört beispielsweise „The Fall of Gil-Galad“, „The Lay of Luthien“ oder „Elbereth Githoniel“ in Auszügen. In vielen Fällen werden die Lieder auch von Musik begleitet (komponiert von Stephen Oliver). Gerade diese Lieder und Gedichte, die die meisten im Roman überlesen, entfalten im Hörspiel ihre volle Wirkung und tragen damit nicht nur stark zur Stimmung bei, sondern treiben von Zeit zu Zeit auch die Handlung voran.
Die Hobbits sind noch nicht einmal in Rivendell, da erwarten Tolkien-Puristen schon die ersten positiven Überraschungen. Arwen wurde, wie von Tolkien vorgesehen, wieder an ihre Stickarbeiten zurückbeordert (sie hat im Hörspiel ohnehin nur einen kurzen Dialog am Ende der Geschichte) und so darf der verletzte Frodo ganz traditionell von Glorfindel gerettet und nach Rivendell befördert werden. Und er ist nicht der einzige Charakter, der es – im Gegensatz zum Film – ins Hörspiel geschafft hat. Dazu gehört auch Halbarad, der zusammen mit den Rangern Aragorn in der finalen Schlacht unterstützt. Auch viele Szenen, die der Film vermissen ließ, sind ausführlicher ausgearbeitet. So ist die finale Konfrontation zwischen Gandalf und Saruman („The Voice of Saruman“) als Schlüsselszene angelegt und damit ein viel überzeugenderer Schlusspunkt als die Version von Peter Jackson. Es gibt mehr aus den Kapiteln „The Houses of Healing“, „The Scourging of the Shire“ und auch auf den Schluss der Geschichte wird mehr Zeit verwendet. So wie schon der Beginn von „The Lord of the Rings“ bedächtig im Shire anfing, so klingt die Geschichte dort auch langsam aus. Mit der Rückkehr ins Shire wird die Stimmung immer melancholischer und wehmütiger und entspricht damit sehr gut Tolkiens Ende des Ringkriegs. Das Hörspiel klingt also sehr leise aus und emotionale Gemüter werden wohl die ein oder andere Träne wegwischen müssen.
Wie sieht es nun mit den Sprechern aus?; mit ihnen steht und fällt schließlich die Glaubwürdigkeit der Geschichte. Auf alle kann hier natürlich nicht eingegangen werden, dafür ist das Ensemble einfach zu umfangreich, daher sollen hier einige Sprecher herausgepickt werden, die auf die ein oder andere Art aufgefallen sind:
|Menschen:|
Da muss natürlich Aragorn (Robert Stephens) erwähnt werden. Und welch einen Schock verursacht er zunächst, gerade im Gegensatz zu seinem filmischen Alter Ego (Viggo Mortensen). Wo Mortensens Aragorn ein nachdenklicher, von Selbstzweifeln geplagter König im Exil ist, so stellt Stephens ihn als selbstbewussten und zielgerichteten Mann dar, der durchaus weiß, was er will (nämlich König werden) und dieses Ziel auch hingebungsvoll verfolgt. Und dazu lacht er auch noch aus vollem Halse! Und das gleich in seiner ersten Szene! Robert Stephens ist gewöhnungsbedürftig, wohl auch, weil er stimmlich älter klingt, als man sich Aragorn vorstellen würde. Doch seine Interpretation wächst dem Hörer mehr und mehr ans Herz.
Theodén (Jack May) dagegen hat Tolkiens Pathos wohl etwas zu ernst genommen. Er klingt so theatralisch und überzogen, dass man sich wünscht, die Regie hätte hier eingegriffen und May etwas gedämpft.
Denethor (Peter Vaughan) dagegen ist ein echter Gewinn. Der Hörspiel-Denethor ist viel weniger verrückt als der Film-Denethor. Vaughan stellt ihn als einen überforderten Herrscher dar, der sich mit schier unüberwindlichen Problemen konfrontiert sieht – und bleibt damit viel dichter an Tolkiens Vorlage.
|Elben:|
Bei den Elben sticht kaum jemand heraus, anzumerken ist vielleicht nur, dass Galadriel (Marian Diamond) die erste Frauenstimme ist, die man im Hörspiel zu Ohren bekommt. Galadriel ist hier ein durchaus sympathischer und hilfsbereiter Charakter und keineswegs mysteriös oder zwiespältig.
|Hobbits und andere Kurze:|
Ian Holms Frodo macht im Verlauf des Hörspiels eine faszinierende Metamorphose durch. Zwar klingt er schon zu Beginn sehr seriös und erwachsen, doch nähert er sich später immer mehr Gollums Sprache und Modulation, was sehr gut den Einfluss illustriert, den der Ring auf ihn hat. Von einem durchaus ernsthaften und zielgerichteten Hobbit wird er so immer mehr zu einer unvernünftigen Kreatur, die nicht mehr für sich selbst entscheiden kann und geradezu krankhaft auf den Einen Ring fixiert ist.
Ein wahres Fest ist Peter Woodthorpe als Gollum. Er ist herrlich hysterisch und verrückt und Woodthorpe schafft es zielsicher, Gollums gesamten trickreichen Charakter mit seiner Stimme zu füllen. Da bleiben keine Wünsche offen. Ohne Frage ist Woodthorpe eines der großen Highlights des Hörspiels.
|Zauberer:|
Michael Hordern als Gandalf verleiht dem Charakter die nötige Würde und eine ordentliche Prise Mysterium und Witz: so, wie man Gandalf gewöhnt ist. Die wirkliche Überraschung ist jedoch Peter Howell als Saruman, der es tatsächlich schafft, den Zuhörer mit seiner Stimme zu bezaubern und für sich einzunehmen (ganz so, wie man es von Saruman behauptet). Wenn er will, klingt er so gutmütig, hilfsbereit und altruistisch, dass man ihm auf keinen Fall zutrauen mag, mit Sauron unter einer Decke zu stecken.
Im Hörspiel wirkt, trotz des großen Ensembles, niemand fehlbesetzt, auch wenn man natürlich zugeben muss, dass es unter Umständen schwierig werden kann, alle Charaktere auseinanderzuhalten. Schließlich werden alle zehn CDs, wenn man von den weiblichen Nebenrollen (Galadriel, Eowyn, Arwen) einmal absieht, von Männern bestritten. Doch wenn man ein grundlegendes Wissen darüber hat, was wann in der Geschichte passiert, so wird man auch keine Probleme haben, dem Hörspiel zu folgen. Ein Tipp sei jedoch erlaubt: Tolkiens „The Lord of the Rings“ in Buchform enthält in der Regel eine Karte von Mittelerde. Eine solche zur Hand zu nehmen, empfiehlt sich auch für das Hörspiel, um nachvollziehen zu können, wo sich die Gefährten gerade befinden. Wie das Leben nämlich so spielt, wird häufig darüber diskutiert, welcher Weg einzuschlagen ist (Männer können eben nicht nach dem Weg fragen …) und diese Diskussionen sind einfacher zu verfolgen, wenn man eine Karte zur Hand hat.
Abschließend ist zu sagen, dass das Hörspiel der BBC neben der Trickfilmversion von Ralph Bakshi und der Filmtrilogie von Peter Jackson eine wirklich faszinierende Interpretation des Stoffes von Tolkien ist. Das Hörspiel teilt sich mit dem Roman einige Längen (so beispielsweise der lange Expositionsteil im Shire), doch dafür kann es auch besonders gut die Stimmungen einfangen, die Tolkien zu evozieren versuchte. Überraschend ist auch, dass es gelungen ist, die Schlachten durchaus überzeugend darzustellen – und zwar nur mit Musik und kurzen Sprachfetzen. Und so wird zwar, naturgemäß, im Hörspiel wenig Elbisch gesprochen (was zwar schade, aber verständlich ist), doch macht man sich die vielen Lieder und Gedichte zunutze – für mich einer der großen Pluspunkte des Hörspiels. Weder der Trickfilm noch die Realfilme haben darauf viel Zeit verwendet und im Roman führt all diese Poesie eher ein Schattendasein. Im Hörspiel allerdings haben sie eine zentrale Rolle inne und können ihre ganze Suggestionskraft entfalten.
Dramatisierung: Brian Sibley und Michael Blakewell
Musik: Stephen Oliver
Sprecher: Ian Holm, Michael Hordern, Robert Stephens, Peter Woodthorpe, William Nighy, Richard O’Callaghan, John McAndrew, David Collings, Michael Graham Cox u. v. a.
Spielzeit: ca. 713 min
Den „Herr der Ringe“ als Hörspiel zu genießen, ist natürlich nicht ganz billig – die zehn CDs kosten knapp 50 €uro. Allerdings bekommt man dafür auch Hörgenuss vom Feinsten und Tolkien im englischen Original geboten.
http://www.hoerverlag.de
|J. R. R. Tolkien bei Buchwurm.info:|
[The Hobbit 481
[Der Hobbit 22
[Der Hobbit 130 (Hörspiel)
[Das Silmarillion 408
[Nachrichten aus Mittelerde 1407
[Der Elbenstern 805 (Hörbuch)
Mit „Das indische Tuch“ beginnt eine Hörspielreihe von Titania Medien, die unter dem Titel „Krimi Klassiker“ mehrere Geschichten des britischen Krimialromans aufbietet. Neben einzelnen Erzählungen des berühmten Sherlock Holmes kommt auch Krimi-Legende Edgar Wallace im Laufe dieser Serie zu Hörspiel-Ehren, wobei die erste Episode, „Das indische Tuch“, sich gleich mit einer Geschichte jenes berühmten Schriftstellers befasst.
|Titania Medien| bzw. Drehbuchautor und Regisseur Marc Gruppe haben eigens für die Realisierung dieses Projekts bekannte Synchronsprecher verpflichtet, die ihren Job bei diesem ersten Teil überragend lösen. Hier eine kurze Auflistung der vertrenenen Schauspieler (in Klammern die Namen der ansonsten synchornisierten SchauspielerInnen):
Lord Willie Lebanon – Daniel Werner
Lady Lebanon – Dagmar von Kurmin
Isla Crane – Manja Doering (Natalie Portman)
Dr. Amersham – Christian Rode (Christopher Lee)
Gilder – Jürg Löw
John Tilling – Gero Wachholz
Joan Tilling – Dörte Lyssewski (Cate Blanchett)
Studd – Jens Hajek
_Story:_
Auf dem düsteren Schloss Marks Priory ist die Atmosphäre unter den dort lebenden Leuten hundsmiserabel. Jeder wettert gegen jeden, einzelne Bündnisse werden geschlossen, um die Gegner gegen einander auszuspielen und im Endeffekt traut man selbst seinen Nächsten nicht. Im Kreuzfeuer der Kritik steht dabei der fiese Dr. Amersham, Leibarzt der Adelsfamilie Lebanon, der vom Lord nicht mehr erwünscht wird, jedoch von Lady Lebanon weiter geduldet wird. Ähnlich verhält es sich mit dem Chauffeur Studd, den Amersham als einen Spion bezeichnet und gegen den er daher auch Intrigen spinnt, die zur Entlassung Studds führen.
Als Studd sich bei seiner Entlassung ein letztes negatives Wort über Amersham äußert, zieht er den Zorn des Arztes auf sich. Kurze Zeit später wird Studd dann im Park tot aufgefunden; in seiner Nähe befindet sich ein indisches Halstuch, mit dem der ehemalige Chauffeur erdrosselt wurde. Auch wenn der Hauptverdacht auf Amersham fällt, so hat im Endeffekt jeder ein Tatmotiv.
Nach und nach finden die Officers von Scotland Yard unter der Leitung von Chief Inspector Tanner und Detective Seargent Totty heraus, wie die Bewohner und Angestellten zueinander stehen, und bestimmen nach Überprüfung sämtlicher Alibis und Tatmotive einen Hauptverdächtigen. Doch just in dem Moment, in dem Totty diesen festnehmen möchte, wird dieser ebenfalls tot aufgefunden.
Die beiden Polizeibeamten klären infolgedessen auf, welche Details ihnen bisher von den Leuten auf Marks Priory verschwiegen wurden, und kommen dem rätselhaften Mordkomplott Schritt für Schritt auf die Spur. Doch inzwischen geschehen weitere merkwürdige Dinge auf dem düsteren Schloss …
Das Hörspiel zu „Das indische Tuch“ hat im Jahre 2003 verschiedene Kritikerpreise gewonnen, unter anderem für das beste Einzelhörspiel, die beste Sprecherin (Dagmar von Kurmin) und die beste Musik (hier begleitend eingefügt von Manuel Rösler). All diese Preise sind meiner Meinung nach auch vollkommen gerechtfertigt und basieren vor allem auf der fabelhaften Leistung der beteiligten Sprecher. Die Emotionen der Betroffenen werden ausgezeichnet übertragen, die Geschichte wird überaus spannend erzählt und die musikalische Untermalung unterstreicht die mystische Atmosphäre immer wieder aufs Neue.
Dabei bietet die Geschichte ähnlich wie die Story bei [„Die blaue Hand“ 1266 wiederum sehr viele Verstrickungen, einen komplexen Handlungsstrang und einige unerwartete Wendungen. Lediglich zu Beginn schreitet die Story ein wenig schleppend voran, weil die Einführung der Hauptdarsteller ein wenig in die Länge gezogen wird. Andererseits scheint dies dann aber auch wieder nötig zu sein, um den zunächst ermordeten Chauffeur Studd und seine Beziehung zu den Angestellten auf Marks Priory vorzustellen. So richtig spannend wird die Geschichte jedoch erst nach dem ersten Mord, denn von dort an wird es zunächst richtig kompliziert. Neue Protagonisten kommen ins Bild, Alibis werden aufgebaut, kurze Zeit später aber auch wieder widerlegt, der Haupttatverdächtige wechselt alle paar Minuten und in dem Moment, in dem man sich sicher ist, den Richtigen identifiziert zu haben, wird man durch eine Umkehrung der Ereignisse wieder auf eine andere Fährte gelockt.
„Das indische Tuch“ bietet erstklassige Krimi-Unterhaltung mit exzellenten Sprechern und einer Top-Geschichte bester britischer Machart. Nicht nur Nostalgiker, sondern auch Neueinsteiger finden hier wirklich schmackhafte Genre-Kost, die man sich auch gerne mehrfach anhört. Im Doppelpack sind die beiden Geschichten von Edgar Wallace im Zuge der Serie „Krimi Klassiker“ ein echtes, abendfüllendes Erlebnis. Kann ich daher nur uneingeschränkt weiterempfehlen!
Auch beim dritten Teil der Krimi-Klassiker aus dem |Titania Medien|-Verlag handelt es sich um eine klassische Erzählung, hier nach einer Vorlage von Edgar Wallace. Dieses Mal wird die Geschichte „Die blaue Hand“ erzählt, und das in einer Besetzung, die einem als Liebhaber des Hörspiels das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen sollte. Nachfolgend ein Überblick über die teilnehmenden Rollen bzw. ihre Sprecher (in Klammern der Name der ansonsten verkörperten Synchronstimme):
_Jane Groat_ – Dagmar von Kurmin
_Digby Groat_ – Torsten Michaelis (Wesley Snipes)
_Septimus Salter_ – Heinz Ostermann
_Jim Steele_ – David Nathan (Johnny Depp)
_Eunice Weldon_ – Heide Jablonka
_Mrs. Fane_ – Gisela Fritsch (Susan Sarandon)
_Madge Benson_ – Evelyn Maron (Kim Basinger)
_Jackson_ – Charles Rettinghaus (Jean-Claude van Damme)
_Mary Weatherwale_ – Regina Lemnitz (Kathy Bates)
_Tom_ – Detlef Bierstedt (George Clooney)
_Postbote_ – Lothar Didjurgis
_Portier_ – Joachim Tennstedt (John Malkovich)
Wie man unschwer erkennen kann, ist dieser 70-minütige Krimi also bestens besetzt, und dementsprechend ist auch die Qualität der Erzählungen sehr hoch einzustufen. Vor allem David Nathan in der Hauptrolle des Anwalts Jim Stelle weiß zu überzeugen, aber dazu mehr nach dem Überblick über die eigentliche Geschichte.
_Story:_
Nachdem ein Millionenerbe entsprechend den Regeln des Testaments 20 Jahre ruhen musste, soll es nun nach dem Ablauf dieser Zeit in den Besitz der Groats, der einzigen Verwandten der verstorbenen Familie Danton, übergehen. Der engagierte Anwalt Jim Steele beschäftigt sich gerade mit dem Fall und stellt erste Ermittlungen an, denn ihm persönlich ist die Familie Groat, vor allem der junge Digby, nicht ganz geheuer. Gleichermaßen bandelt Steele gerade mit der jungen Eunice Weldon an, muss aber entsetzt feststellen, dass diese demnächst im Hause der Groats als Sekretärin eingestellt werden wird.
Schon in der ersten Nacht spielen sich merkwürdige Dinge im Hause Groat ab; jemand ist in Eunices Zimmer eingedrungen und hat eine geheimnisvolle Warnung hinterlassen: „Jemand, der dich liebt, bittet dich dringend, dieses Haus so schnell als möglich zu verlassen!“ Außerdem bleiben mehrere blaue Abdrücke einer Damenhand zurück.
Eunice ist die Sache nicht geheuer, doch trotzdem setzt sie ihre Arbeit bei der mysteriösen Familie fort. Steele indes untersucht auch die Vergangenheit von Mrs. Weldon genauer und stellt dabei fest, dass Eunice im selben Alter wie die einst verschollene Dorothy Danton sein muss. Jedoch gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass Zusammenhänge zwischen der Vermissten und der geliebten Sekretärin bestehen. Eines Tages jedoch bringt Steele diesbezüglich Licht ins Dunkle; er stellt fest, dass das Verhältnis zwischen Digby und seiner Mutter gar nicht so gut ist, wie es nach außen hin scheint, freundet sich mit der Wittwe Groat an und erfährt dabei auch wichtige Details über die Vergangenheit. Von nun an gilt es für Jim Steele zu verhindern, dass das Millionenerbe in die falschen Hände gerät …
Die Geschichte um die blaue Hand ist in ihrer Struktur gewohnt komplex und mit vielen Details gespickt. Oder um es kurz zu sagen: der typische Edgar-Wallace-Stoff. Spannung ist jedenfalls im gesamten Verlauf geboten, selbst in dem Moment, wo man glaubt, dass die eigentliche Geschichte schon aufgelöst ist – und genau diese Eigenart besitzen nur die ganz guten Krimis aus der alten britischen Schule. Wallace wählt die Charaktere dabei nach den üblichen Kriterien aus; ein hoffnungslos verliebter junger Mann, eine Dame, die sich der Gefahr, in der sie schwebt, nicht bewusst ist, und auf der anderen Seite ein kompromisloser Schurken, der zusammen mit seinem Handlanger seine gemeinen Pläne durchsetzen möchte, selbst wenn er dabei über Leichen gehen muss.
Die komplexen Verflechtungen lösen sich dabei im Laufe des Hörspiels auf, jedoch kann man anfangs keinesfalls vorausahnen, in welche Richtung sich die Erzählung entwickeln wird. So sind vor allem die Rollen der Eunice Weldon und die der Jane Groat unklar. Weiterhin stellt sich die Frage, zu wem der Butler der Familie schließlich halten wird. Oder aber welche Motivation Jim Steele abgesehen von seinen Gefühlen für die junge Mrs. Weldon beim Ermitteln im Falle Danton antreiben.
Marc Gruppe, der Mann hinter diesem Drehbuch, hat die Rollen sehr gut verteilt und sich hierfür prominente und überaus talentierte Synhcronsprecher ins Haus geholt, die allesamt einen fabelhaften Job erledigen. Das gilt für den fabelhaft und heimtückisch auftretenden David Nathan alias Jim Steele ebenso wie für die undurchschaubare Jane Groat, der Dagmar von Kurvin ihre Stimme leiht.
Im Krimisektor ist dieses Hörspiel daher definitiv eines der besten seiner Machart und macht nach der recht kurzen Spielzeit von 70 Minuten Lust auf einen weiteren Durchlauf. Eine Seltenheit in diesem Genre, aber gerade dieser Fakt macht „Die blaue Hand“ auch für diejenigen interessant, die mit Hörspielen bzw. Krimis im Normalfall nicht so viel anfangen können. In diesem Fall wird die Kombination aus erstklassig agierenden Sprechern, einer spannungsgeladenen und gut ausgeschmückten Story und natürlich der Tatsache, dass die Legende Edgar Wallace hierzu die Vorlage geliefert hat, jedenfalls zu einem echten Glücksfall.
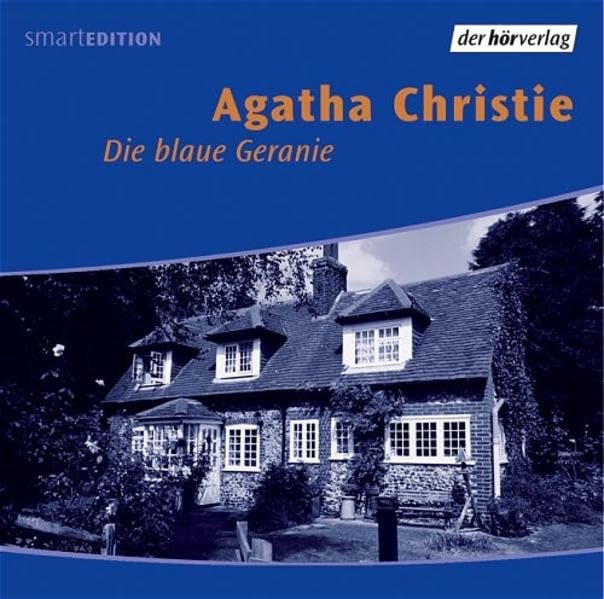

Bram Stoker / Marc Gruppe – Das Amulett der Mumie (Gruselkabinett 2) weiterlesen