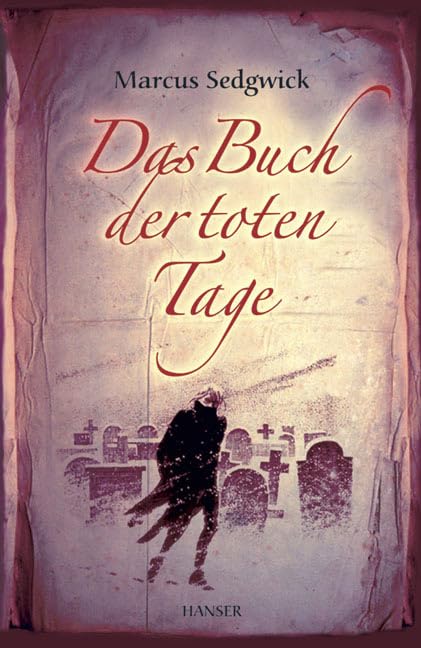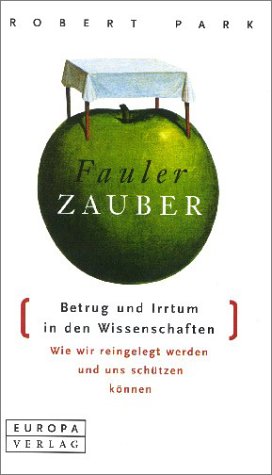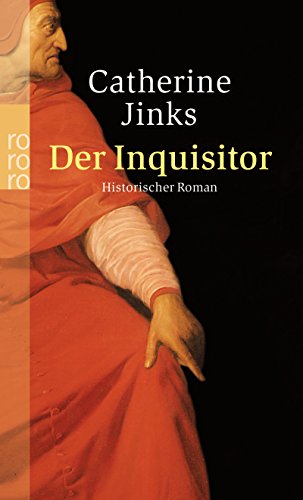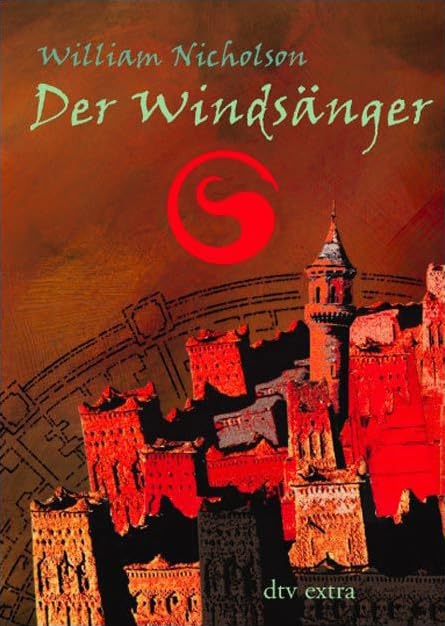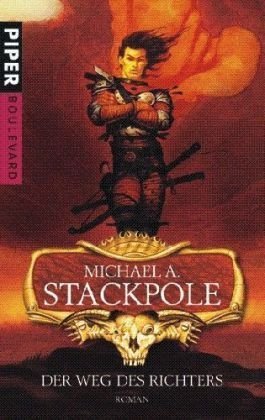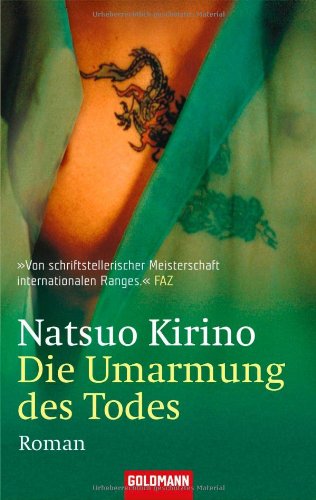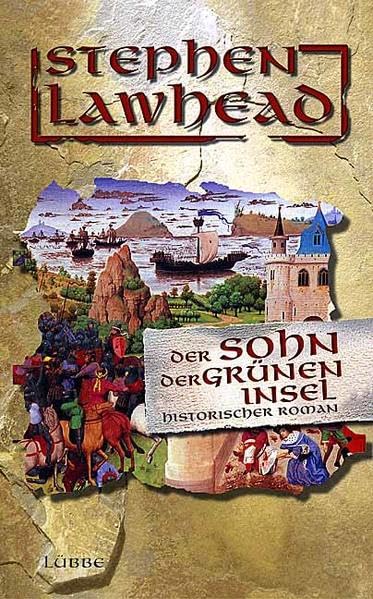Boy, der Waisenjunge ohne Namen, assistiert seit vielen Jahren dem übellaunigen Illusionisten Valerian, in dessen Anwesen er eine winzige Kammer bewohnt und für den er auch außerhalb der Theaterarbeit rund um die Uhr im Dienst ist. Dessen missmutiges Temperament wird in letzter Zeit nur noch von seiner gedanklichen Abwesenheit und Unlust an der Bühnenarbeit übertroffen. Etwas bereitet dem alten Trickkünstler deutliche Sorgen, und da sein Herr eher jemand ist, der zum Frühstück rostige Eisennägel verspeisen könnte, muss der Quell dieses Übels etwas wahrhaft Schreckliches sein, mutmaßt Boy.
Als Valerian seinen vierzehnjährigen Leibsklaven – anders lässt es sich kaum betrachten – zwecks Informationsbeschaffung zu einem Agenten entsendet, dieser jedoch vor Boys Augen auf recht unheimliche Weise ermordet wird, beginnt einige wilde Aufregung in das triste und regengraue Dasein des Jungen Einzug zu halten oder besser gesagt über ihn hinwegzurollen. Auch der Theaterdirektor wird in der gleichen Nacht ums Leben gebracht und von Willow gefunden, einem Mädchen in Boys Alter, das des Jungen Schicksal in ähnlicher Weise als Bedienstete der exzentrischen Sängerin Madame Beauchance teilt. Willow und Boy geraten unter Mordverdacht und stante pede ins Gefängnis. Valerian befreit die beiden, verwendet dabei allerdings einen „Trick“, der in Boy den Verdacht aufkeimen lässt, dass die Magie des Alten wohl doch nicht nur aus Taschenspielereien besteht, sondern mehr dahinter steckt. Zudem: Warum sollte sein unangenehmer Herr und Meister ihn aus dieser misslichen Lage befreien, wo er sich doch sonst kein Deut um den Jungen scherrt? Etwas ist wohl faul im Staate Dänemark. Was sich da zusammenbraut, beunruhigt Valerian und damit Boy zutiefst, hat etwas mit dem Näherrücken der Silvesternacht zu tun, mit einem lang zurückliegenden dämonischen Pakt und mit dem mysteriösen „Buch der toten Tage“, hinter dem der Bühnenmagier ohne Rücksicht auf Verluste her ist.
So sind die vier Tage vor dem Jahreswechsel angefüllt mit einer wilden, atem- und schlaflosen Jagd nach diesem Buch. Friedhöfe, Verliese, Stadtwächter, ein verrückter Präparator, ein genialer Wissenschaftler und obskure Erfindungen, eine alte Kirche, vergessene Kanäle unter der Stadt und vielerlei Absonderliches mehr erwarten unsere Helden wider Willen in dem nun folgenden Abenteuer.
_Die Zeit der toten Tage_
Wintersonnenwende, Mittwinter, das Julfest, die Weihnachtszeit, Jahreswechsel – dieser Jahresabschnitt war in unserem Kulturraum bereits seit „heidnischen“ Zeiten von Tagen des Friedens, der Ruhe und der Familie geprägt. Alles fließt langsamer und befindet sich in einer Art von Zwischenstadium, von einem erwartungsvollen Zwielicht durchwirkt. Marcus Sedgwick beschreibt „die sonderbar stille Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr“ als „tote Tage – Tage, an denen die Türen zwischen unserer Welt und jener unsichtbaren, die gleich darunter liegt, geöffnet sind.“
Diese Stimmung und durchaus düstere Bilder waren für den früheren Buchhändler und Lektor, der nun seit 1994 Jugendromane verfasst und in England zu den Großen seiner Zunft zählt, der Ausgangspunkt für die gar abenteuerliche und gotisch-düstere Erzählung, die uns nun der |Hanser|-Verlag in deutscher Übersetzung angedeihen lässt. Inspiriert von Orten wie den Pariser und Krakauer Friedhöfen, Katakomben und Bolognas geheimnisvoller Kanalisation, entwirft Segwick das stimmungsvolle Bild einer fiktiven, organisch wirkenden Metropole, die zeitlich in einem Übergang zwischen Aberglaube und Magie auf der einen Seite und ersten Wissenschaften und Experimenten auf der anderen angesiedelt ist. Damit greift die gewählte Epoche die Ausgangsidee der toten Tage auch bildhaft auf. Alles bewegt sich in einem Zwischenraum, einem Übergang, ist zeitlos und schwer greifbar.
_Tage ohne Atempause_
In dieser Umgebung lässt der Autor ein wahres Gewitter an Ereignissen auf den jungen (oder jung gebliebenen) Leser einprasseln, dass dieser aus dem Staunen nicht mehr herauskommen mag. Die Kapiteleinteilung ist kurz und knackig, die Szenenwechsel erfolgen rasch. Verschnaufpausen gibt es kaum; die Geschichte nimmt uns in sich auf und entlässt uns erst wieder in die Wirklichkeit, wenn das letzte Rätsel gelüftet und die finalen Gefahren überstanden sind. Segwick ist dabei keineswegs zimperlich – für einen jugendlichen Leser mag so manche Situation und Begebenheit für wahrhaft schlaflose Nächte sorgen. So ist auch die Erzählweise ernsthaft und unheimlich genug, den erwachsenen Leser ausreichend zu fesseln. Humorige Elemente sucht man dagegen vergebens.
_Was dabei auf der Strecke bleibt_
Angesichts des Erzähltempos und der handlungsorientierten Geschichte bleibt allerdings einiges auf der Strecke. Zunächst hält der Autor sich sehr zurück, was atmosphärische Beschreibungen und Eindrücke der Umgebung angeht. Das rechte Bild will sich nur aufbauen, wenn man mit Lokalitäten, wie sie oben erwähnt wurden, durch eigene oder filmische Erfahrungen etwas vertraut ist. Ob man so viel stimmungsvolle Kopfarbeit von einem jugendlichen Leserkreis bereits freiweg erwarten kann, ist vielleicht bezweifelbar. Auch die Charakterausarbeitungen beschränken sich auf ein Minimum. Genauere Vorstellungen bekommt man nur von Valerian und Boy, aber auch sie bleiben schablonenhaft; ziemlich im luftleeren Raum existiert dagegen bereits Willow, deren Wesenszüge und Motivationen weitgehend unklar bleiben. Irgendwann kommt es beispielsweise zu wohl kaum vermeidbaren romantischen Aufwallungen gegenüber Boy, aber warum das so ist, wird nicht nachvollziehbar. Willow liebt Boy mit einem Schlage über alles und würde ihr Leben für ihn geben, und das müssen wir so hinnehmen, scheint’s. In dieser Art gäbe es noch einiges bei Randfiguren zu erwähnen, doch will ich es hierbei belassen.
Bei der Gelegenheit sei auch noch ein Wort zur Übersetzung verloren. Diese wirkt stellenweise recht unbeholfen und lässt sprachliches Feingefühl vermissen. Ein vergleichender Blick ins Original gibt seitenweise Anlass, sich zu wundern. Regional gefärbte Wendungen irritieren zusätzlich. Zwei Beispiele dazu, herausgegriffen von Seite 108: „Es kam sie alle hart an.“, „Willow war es fast schlecht geworden …“. Unsicherheiten bei den neuen Rechtschreibregelungen kommen hinzu. (Bleiben wir auf Seite 108: „zurück führen“ wird auch nach der Reform „zurückführen“ geschrieben.) In der Summe wird der Lesegenuss durch diese Schwachpunkte durchaus spürbar getrübt.
_… und was vom Tage übrig blieb_
Detail- und Feinarbeiten darf man letztlich im „Buch der toten Tage“ nicht erwarten, dafür aber eine spannende und dramaturgisch geschickt aufgebaute Abenteuergeschichte mit unheimlicher und düsterer Grundstimmung. Das, was man in schöner Aufmachung zwischen den Buchdeckeln präsentiert bekommt, weiß bis auf die deutsche Bearbeitung zu gefallen, aber zu einem wirklich erinnerungswürdigen Leseerlebnis fehlen noch einige handwerkliche Ingredienzien, wie eine glaubhafte Charakterzeichnung oder stimmungsvoll ausgearbeitete Bilder, die nicht zu viel der Fantasiearbeit des Lesers überlassen. Dennoch: Das Reinschmökern in verregneter und frostiger Witterungslage lohnt allemal und verspricht ein kurzweiliges Lesevergnügen, wenn man die literarische Erwartungshaltung nicht zu hoch ansetzt.