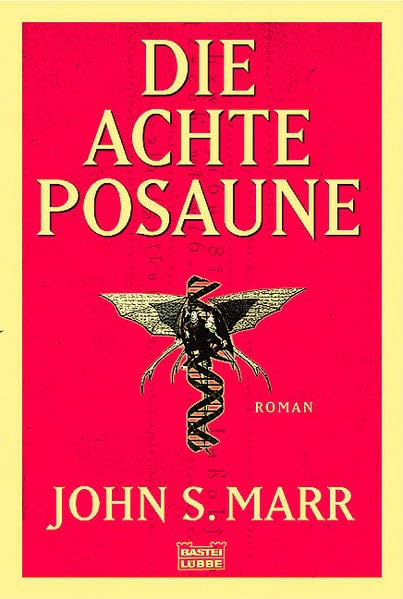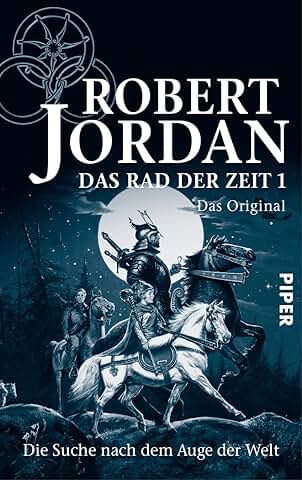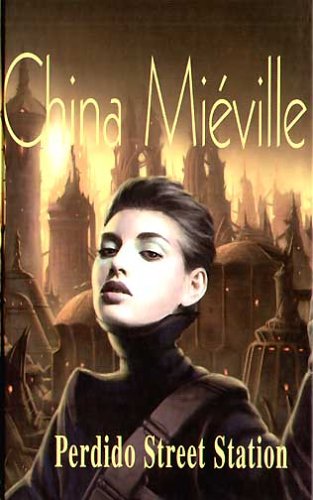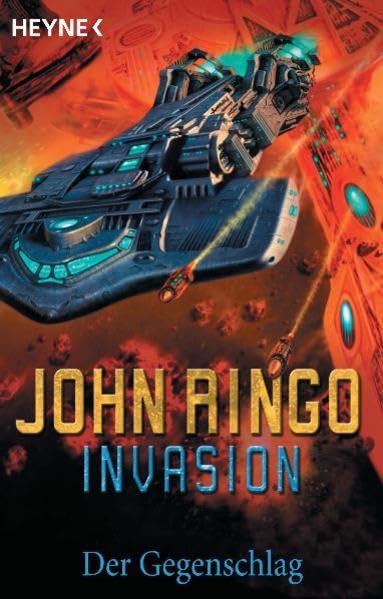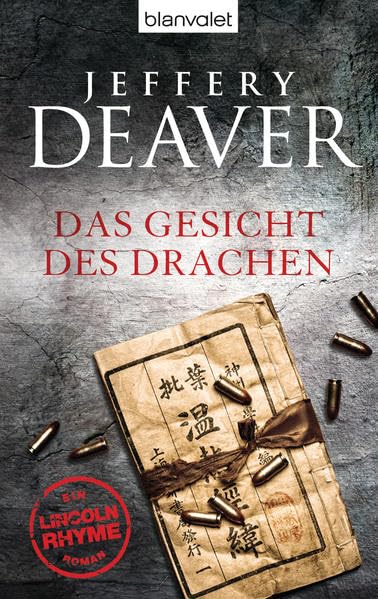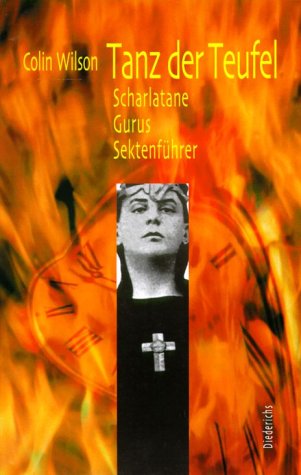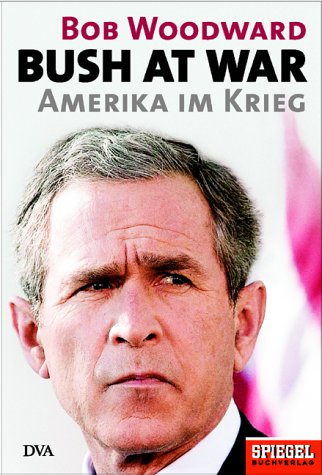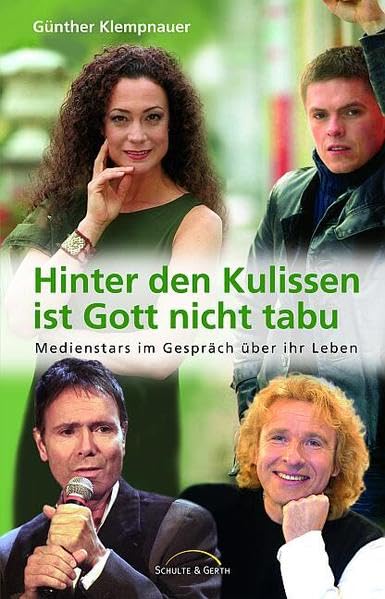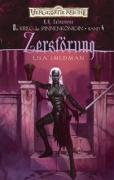Zwei Jahre ist es her, dass die Welt (= die Vereinigten Staaten von Amerika) vom irren Reagenzglas-Psychopathen und Bio-Terroristen Theodore Graham Kameron heimgesucht wurde. Die zehn Plagen des Alten Testaments hatte der geniale, unter akutem religiösen Wahnsinn leidende Naturwissenschaftler in seinem Labor heraufbeschworen: dies sehr erfolgreich und mit für seine zahlreichen Opfer unerfreulichen Folgen.
Auf die Schliche gekommen war dem selbst ernannten Engel des Bösen damals Jack Bryce, Spezialist für Infektionskrankheiten. Noch heute leidet er unter den Folgen der Hetzjagd, die ihn das große Finale nur arg ramponiert überleben ließ. Schlimmer: Kameron konnte entkommen. Für die Behörden gilt er als tot, aber Bryce weiß es bald besser. Wie nahe ihm sein Feind ist, ahnt er nicht: Im US-Südstaat Virginia hat Bryce eine Stelle als Universitätsdozent angenommen. Der Zufall (bzw. die von Hollywood geprägte Dramaturgie des modernen Bestseller-Thrillers) hat ihn dorthin verschlagen, wo der Kameron-Clan – dessen Angehörige schon immer verhaltensauffällig waren – seit 150 Jahren Übles treibt.
Theodore wandelt auf den Spuren seiner Vorfahren. Wieder plant er die Welt für allerlei sündhaftes Tun zu strafen. Dieses Mal wählt er eine besonders widerliche Methode: Er malträtiert seine Opfer mit Würmern, Zecken oder Blutegeln, die er zusätzlich mit exotischen Krankheitskeimen auflädt. Im Inneren eines menschlichen Körpers entwickelt sich diese Höllenbrut prächtig, um dann am Tage X hungrig über die Organe ihres Wirtes herzufallen. Das garantiert ein eindrucksvolles Sterben, wie u. a. Shmuel Berger bestätigen kann (Kotztüten bereithalten!), dessen Studienfreund und Zimmergenosse just auf diese Weise zu Tode kam. Shmuel hatte damals geholfen, dem entfesselten Kameron das Handwerk zu legen. Mit im Bunde waren Vicky Wade, Fernsehreporterin, und FBI-Agent Scott Hubbard, die Kameron ebenfalls nicht vergessen hat.
Doch zunächst gilt es die übliche Alltagsarbeit eines gemeingefährlichen Irren zu verrichten. Kameron kontaminiert diverse Pechvögel mit seinen Parasiten, um jene Angst und jenen Schrecken zu säen, nach dem er süchtig ist. Lange dauert es nicht, bis Jack Bryce aufmerksam wird. Glücklicherweise hat er an seinem neuen Wirkungsort einige Verbündete gefunden, die mit den alten Mitstreitern dafür sorgen werden, dass die Posaune des achten Engels vorläufig noch im Schrank bleibt …
Mikro-Wesen säen Makro-Schrecken
Doch bis es soweit ist, gibt es wieder tüchtig Action und Krawall, in die sich dieses Mal mehr als ein ordentliches Quäntchen Splatter mischt. Recht unappetitlich fällt Kamerons zweite Attacke auf die sündige Menschheit aus. Was bleibt einem hart arbeitenden Unterhaltungs-Schriftsteller schon übrig, um auf dem umkämpften Markt des Medizin-Thrillers die leidige Konkurrenz auszustechen? Ekel mit der groben Kelle ist immer gut fürs Geschäft; die Leser lieben ihn, und die Tugendbolde schäumen, was für gern gesehene Gratis-Werbung sorgt.
Natürlich ist „Die achte Posaune“ ein Reißbrett-Roman von der ersten bis zur letzten Zeile. Hier wurde rein gar nichts dem Zufall überlassen. Nur bewährte Thriller-Elemente fanden Verwendung in einem mechanisch geplotteten Werk, das seinen Verfasser an die Spitze der Bestseller-Listen tragen sollte. Das hat recht gut geklappt. So schlecht klingt diese „Posaune“ außerdem nicht. Wenn man Überraschungen hasst und Remmidemmi liebt, kommt man auf seine Kosten.
Noch besser: Die Handlung entwickelt sich geradezu surreal, scheut nie vor dem völlig Absurden zurück und streift sogar den blanken Horror. Theodore Kameron entpuppt sich als letzter Vertreter einer wahrlich verdammten Sippe von Lumpen, Irren, Kannibalen und Serienkillern, die seit Jahrhunderten erst im alten Europa und dann in der Neuen Welt ihr Unwesen treiben. Das ist einfach hirnrissig, wird aber hinreißend erzählt.
Vollgas nach Stotter-Start
Dies sorgt für echte Verblüffung: John Marr gehört zu den seltenen Autoren, die denkbar ungeschickt starten, um sich dann zu echten Geschichtenerzählern zu mausern. „Die achte Posaune“ ist auch mit einer zweiten Eigenschaft etwas Seltenes: der zweite Teil einer Story, die den ersten deutlich übertrifft. Absurd ist dieses Garn zweifellos, aber eben auch vergnüglich und spannend, und wenn der erfahrene Thriller-Leser auch stets im Bilde ist, so geschieht doch ständig etwas, das die Aufmerksamkeit fesseln kann.
Liegt es daran, dass Marr das zweite Bryce/Kameron-Spektakel im Alleingang entfesselt? John Baldwin, Co-Autor von „The Eleventh Plague“ (1998; dt. „Die elfte Plage“) genoss derweil die Freuden der Vaterschaft, wie wir dem Nachwort entnehmen. Eine weitere Fortsetzung wäre möglich, denn der böse Hannibal Frankenstein entkommt schon wieder seinen Häschern!
Das lässt den Leser nicht leise aufstöhnen, sondern kann sogar Erwartungen wecken. Mit „Teddy“ Kameron ist Marr ein wirklich schaurig-schillernder Bösewicht gelungen. Heimlich, still und leise führt er seinen bizarren Ein-Mann-Krieg gegen den Rest der Welt und legt dabei einen ausgeprägten Sinn für schräge Einfälle an den Tag.
Medizinschrank als Gruselkabinett
Sind die beschriebenen Schrecken realistisch? Das bleibt Nebensache. Sie lesen sich jedenfalls spannend. Sein außerordentliches Hintergrundwissen bringt Marr, ein studierter Mediziner und Seuchenspezialist, der viele Jahre das Gesundheitsamt der Stadt New York leitete, dieses Mal deutlich souveräner als noch in „Die elfte Plage“ ins Spiel bzw. in den Dienst seiner Geschichte. Todesviren ziehen in Literatur und Film immer, und Marr weiß, wovon und wie man schreibt.
Leserherz (bzw. -hirn), was willst Du mehr? Manchmal wünscht man sich, Marr in seinem Enthusiasmus bremsen zu können, denn der Kampf gegen den biologischen Terror, der ganz real und auch ohne Dr. Kamerons Nachhilfe über die Menschheit kommen kann, ist dem Verfasser ein echtes Anliegen. Mehrfach unterbricht er seine Geschichte mit ausführlichen Referaten über Seuchen, die per Schiff oder Flugzeug in Windeseile um den Globus reisen, sich mit harmlosen einheimischen Krankheiten mischen und sich in das Unsägliche verwandeln könnten. Stört das den Fluss der Geschichte? Ganz erheblich, obwohl der Leser gern zugibt, dass solche Hintergrundinformationen das furchtsame Schütteln noch steigern!
Dass Marr seine Leser zwar ernst nimmt, um die ironischen Aspekte seiner Schauermär aber sehr wohl weiß, demonstriert er u. a. mit der Figur des Dwight Fry, den die Faszination in den Bann des dämonischen Dr. Kameron zwingt. Der Horrorfan erkennt die Anspielung: Dwight Frye (1899-1943) war der Schauspieler, der im Filmklassiker „Frankenstein“ (1931) die Rolle des „Fritz“ spielt, seinem Herrn hündisch ergeben ist und seinen Teil dazu beiträgt, Frankensteins Monster über die Welt zu bringen. Marrs Fry entspringt darüber hinaus dem legendären Schocker „Freaks“ (1931), den Regisseur Tod Browning mit tatsächlich körperbehinderten Männern und Frauen besetzte, die sich normalerweise ihren Lebensunterhalt als Jahrmarkts-Monstrositäten verdienten. Unter ihnen, die gequält und betrogen werden, bis sie sich gegen ihre Peiniger erheben: Johnny Eck, ein junger Mann ohne Unterleib!
Drama ohne Finale
Für den dümmlichen deutschen Titel, der wieder einmal platt das Alte Testament bemüht, um geradezu apokalyptische Dramatik zu suggerieren, dürfen wir den Verfasser nicht verantwortlich machen. Dem war „Wormwood“, also „Wermut“ eingefallen, aus dem u. a. der berüchtigte, halluzinogene und süchtig machende Absinth hergestellt wurde.
Teddy ist überaus einfallsreich, und der Wahnsinn liegt bei den Kamerons offensichtlich in den Genen. Hinter den Kulissen der Weltgeschichte waren sie schon immer für allerlei Schauerlichkeiten verantwortlich. Möglicherweise ist Theodore nur die Spitze des Eisbergs: Es gibt da einen finsteren, alten, komplexen Plan, der von Jack Bryce und seinen wackeren Gefährten bisher nur in Ansätzen enthüllt wurde. Die wiederum flüchtige Kameron selbst plant jedenfalls noch Großes für die Zukunft.
Wir sind durchaus gespannt. Auf eine Fortsetzung dürfen wir aber offenbar nicht mehr hoffen. John S. Marr, der so schwungvoll vom Arzt zum Unterhaltungsschriftsteller wurde, hat nach „Die achte Posaune“ keinen weiteren Roman geschrieben, sondern kehrte zur ‚reinen‘ Medizin zurück.
Taschenbuch: 477 Seiten
Originaltitel: Wormwood (New York : Frog City Ltd. 2000)
Übersetzung: Axel Merz
http://www.luebbe.de
Der Autor vergibt: