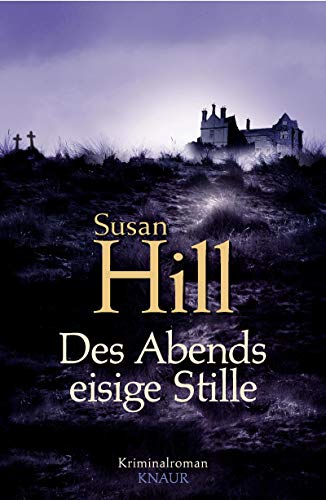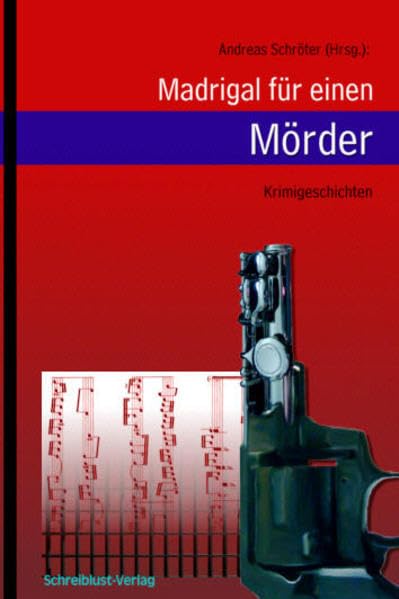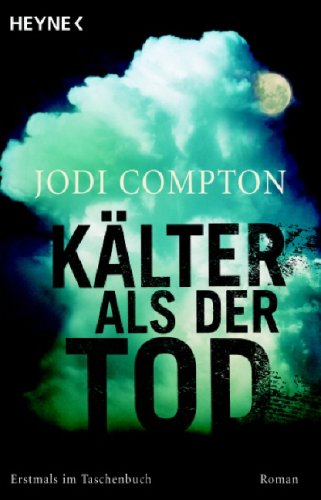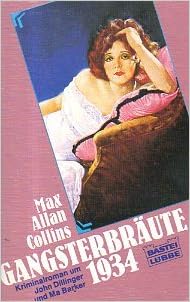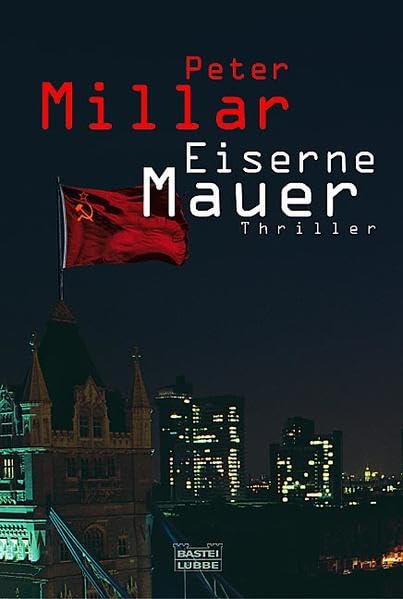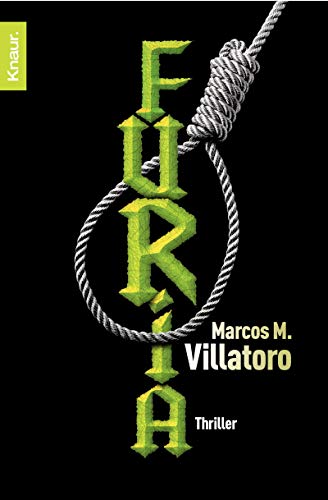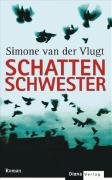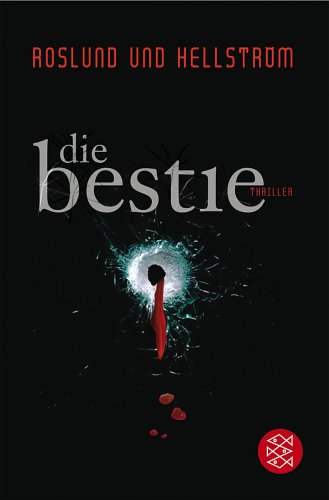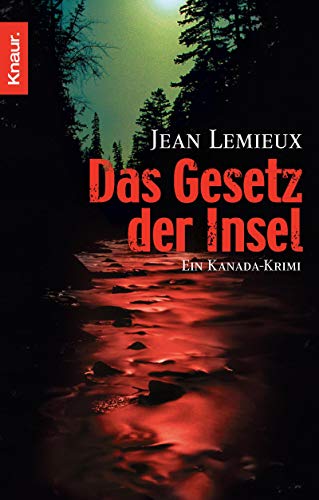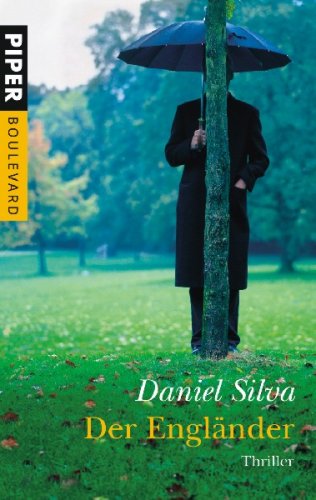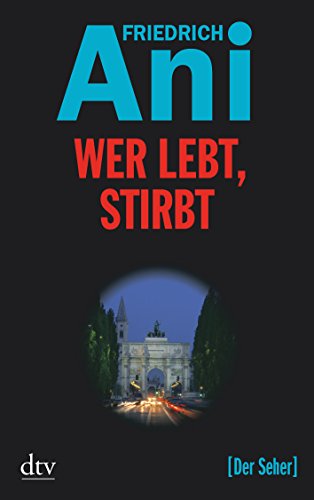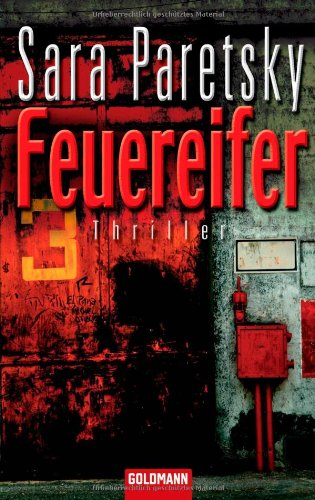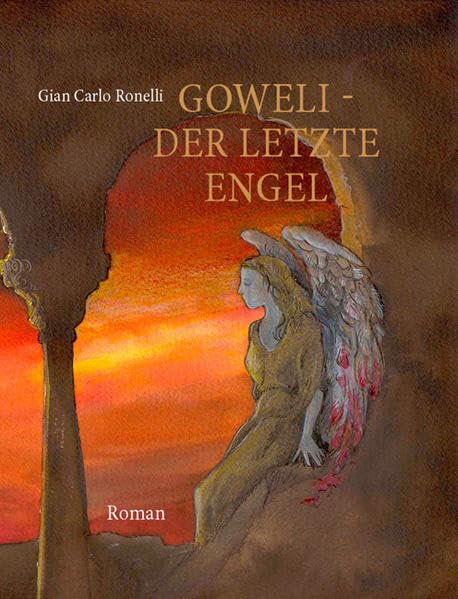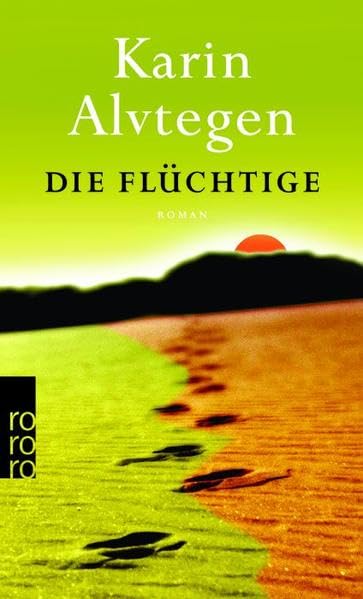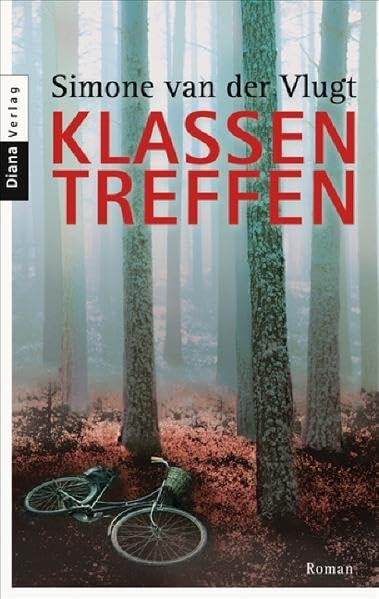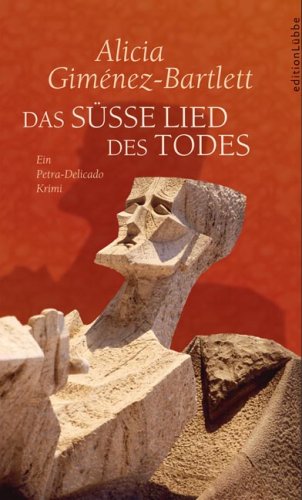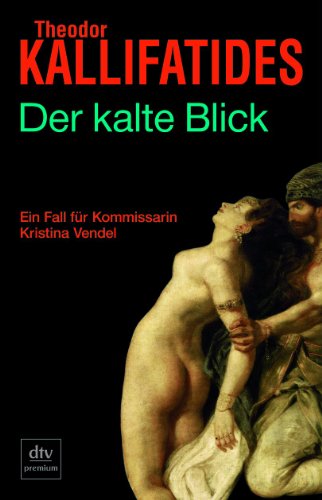Vor zwei Jahren erschien mit [„Der Menschen dunkles Sehnen“ 1698 der erste Krimi von Susan Hill rund um ihren Ermittler Simon Serrailler. Nun legt die Britin mit „Des Abends eisige Stille“ den Nachfolgeband vor.
Simon Serrailler versucht in Venedig auf andere Gedanken zu kommen und mit dem Tod seiner Kollegin Freya Graffam klarzukommen, als ihn ein Anruf aus seiner Heimat erreicht: Seine schwerstbehinderte Schwester Martha liegt auf der Intensivstation und ringt mit dem Tod. Kaum ist Simon zurück in seinem Heimatstädtchen Lafferton, lastet neben den privaten Problemen auch schnell wieder beruflicher Druck auf dem Polizeichef.
Der 9-jährige David Angus wartet am frühen Morgen vor dem Haus seiner Eltern darauf, zur Schule abgeholt zu werden, als er zuletzt gesehen wird. In der Schule kommt er nie an, niemand hat den Jungen gesehen, niemand weiß, wo er sein könnte. Die Polizei findet keinerlei Anhaltspunkte. Es gibt weder Zeugen noch Spuren. Vieles spricht dafür, dass der Junge das zufällige Opfer eines Kindesentführers geworden ist.
Simon und seine Truppe versuchen alle Hebel in Bewegung zu setzen, aber die Spur ist längst kalt. Derweil droht Davids Familie an diesem Schicksalsschlag zu zerbrechen, und da auch die Ermittlungen kaum Neues ergeben, kann auch Simon das Leid der Familie nicht verringern.
Und auch privat geht es weiterhin turbulent zu. Nachdem seine behinderte Schwester sich kurzzeitig wieder erholt hat, stirbt sie völlig unerwartet. An Simon nagen Zweifel: Ist sie wirklich eines ganz natürlichen Todes gestorben? Oder hat vielleicht jemand nachgeholfen? Oder geht sein kriminalistisches Denken schon mit ihm durch? Zu allem Überfluss taucht dann noch eine Frau aus Simons Vergangenheit auf, die ihn bedrängt …
Susan Hill baut ihren Roman ganz gemächlich auf. Sie lässt sich Zeit, ihre Figuren in die Handlung einzuführen, lässt den Leser in aller Ruhe beobachten, bevor es mit der eigentlichen Krimihandlung überhaupt erst losgeht. Das mag bei anderen Autoren problematisch sein, weil der Leser mit Nebensächlichkeiten gelangweilt wird, im Fall von Susan Hill sieht das etwas anders aus.
Ihre Stärke liegt ganz eindeutig in der Figurenzeichnung. Sie schafft lebendige Protagonisten, bei denen es schon Freude bereitet, einfach nur zuzusehen, wie sie durch ihren Alltag gehen. Man schließt sie schnell ins Herz und fühlt sich ihnen auf gewisse Art ganz nah.
Das gilt insbesondere für Simon und die Familie seiner Schwester Cat. Cat und ihr Ehemann Chris sind Ärzte. Cat selbst pausiert derweil, weil sie kurz vor der Geburt des dritten Kindes steht, dafür hängt Chris sich umso aufopferungsvoller in den Job. Das Haus von Cat und Chris ist für Simon stets eine wichtige Zufluchtsstätte. Hier findet er Halt und Geborgenheit und kann sich über alles mit seiner Schwester aussprechen.
Auch Simon ist eine sympathische Hauptfigur, wenngleich er ein etwas ungewöhnlicher Polizeichef ist. Simons Leidenschaft ist das Zeichnen, und er bereitet sich auf eine neue Ausstellung vor. Das erscheint doch als ein eher untypisches Hobby für einen Polizisten. Simon ist ein verschlossener Mensch, der kaum jemanden hinter seine Fassade schauen lässt. Er lässt kaum jemanden an seinen Gefühlen teilhaben und versucht auf seine ganz eigene Art, den zurückliegenden Tod von Freya Graffam und den Todesfall seiner Schwester Martha zu verdauen.
Der Roman spielt besonders im Spannungsfeld zwischen Simons privaten Problemen und dem beruflichen Druck, der sich rund um die Entführung von David Angus aufbaut. Hier sind es besonders auch das Schicksal der Familie Angus und die Auswirkungen des Ereignisses auf das allgemeine Leben in Lafferton, die Hill besonders eindringlich schildert. Das Grauen des Ereignisses wird für den Leser greifbar, und durch ihren einfühlsamen Erzählstil rückt sie den Leser ganz nah an das Geschehen heran.
So entwickelt sich „Des Abends eisige Stille“ von Anfang an anders als herkömmliche Krimis. Wer einen typischen englischen Krimi erwartet, der könnte etwas enttäuscht werden, denn die typische Krimispannung ist bei Hill eher eine Randerscheinung. Das soll nicht heißen, dass „Des Abends eisige Stille“ spannungsarme Kost wäre, aber sie spielt auf einer gänzlich anderen Ebene als die durchschnittliche Krimispannung. Hier sind es vor allem die Figuren, die in den Bann ziehen und den Leser fesseln, bei denen er unbedingt erfahren will, wie es mit ihnen weitergeht.
Das trifft auch auf den Nebenplot zu, in dem der frisch entlassene Ex-Häftling Andy Gunton versucht, wieder im normalen Leben in Lafferton Fuß zu fassen, während die Polizei nach den Entführern von David Angus sucht. Hill versteht es einfach, ihre Figuren interessant zu gestalten, so dass sie fast im Alleingang die Spannung des Romans tragen.
Und so verwundert es auch nicht, dass es am Ende eben auch der Krimiplot ist, der für eine Prise Unzufriedenheit beim Leser sorgt. Ungewöhnlich für einen Krimi ist, dass die Geschichte sehr offen endet. Hill findet nicht so recht den passenden Schlusspunkt, und so wird der Leser wohl warten müssen, bis der nächste Roman um Simon Serrailler erscheint, um zu erfahren, wie die Geschichte wirklich ausgeht.
Hills Romane sind miteinander verknüpft. In „Des Abends eisige Stille“ nimmt sie immer wieder Bezug auf die Geschehnisse in [„Der Menschen dunkles Sehnen“, 1698 weshalb die Lektüre in der richtigen Reihenfolge ratsam ist, wenn man sich nicht die Spannung madig machen will.
Insgesamt hinterlässt „Des Abends eisige Stille“ sowohl positive als auch zwiespältige Gefühle. Hill kann vor allem mit ihrer Figurenskizzierung punkten, die das Buch zu einer intensiven und kurzweiligen Lektüre macht. Der Krimiplot bleibt dagegen etwas zu offen und vage. Er hängt seltsam in der Schwebe und lässt den Leser mit einem leicht unzufriedenen Gefühl zurück. Ansonsten machen Susan Hills erzählerische Qualitäten in jedem Fall Lust auf die Fortsetzung, die hoffentlich nicht zu lange auf sich warten lässt, damit sich das jetzige Gefühl der Unzufriedenheit möglichst bald klären kann.
http://www.knaur.de