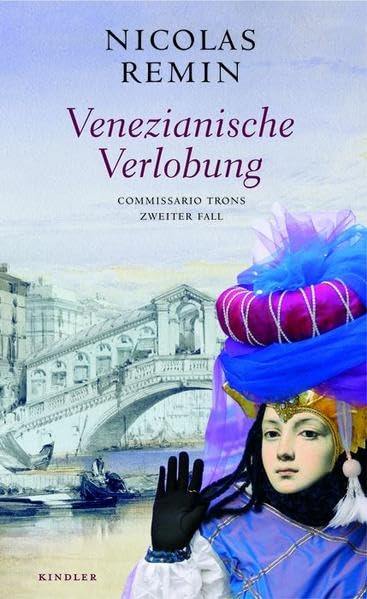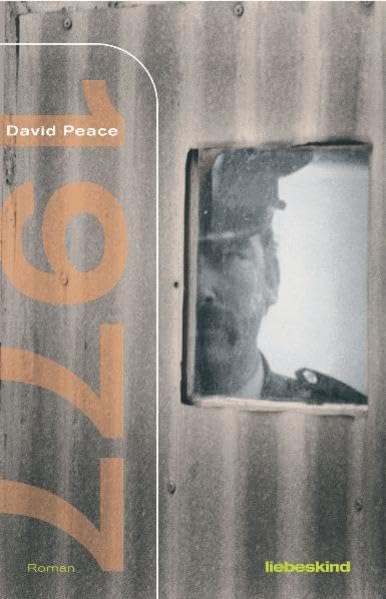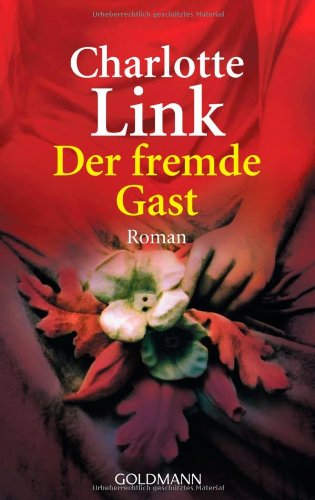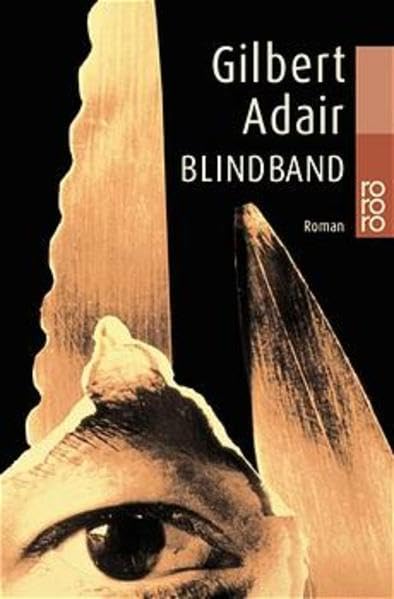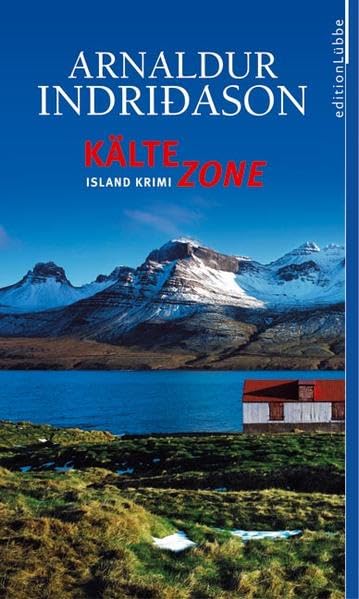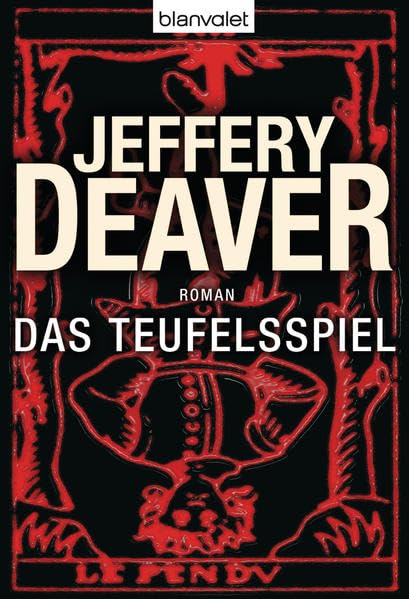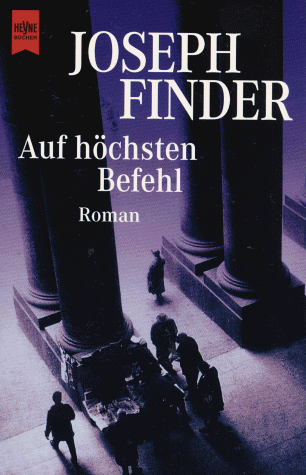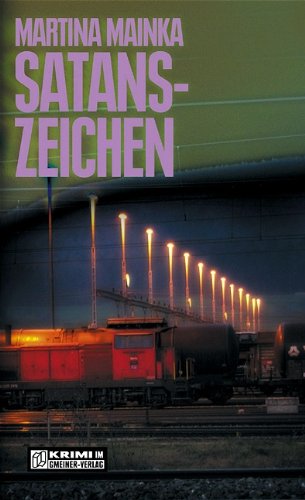Die Projektionsfläche, die Afrika, ‚der dunkle Kontinent‘, bietet, ist groß und scheint allzu häufig durch eine eher naive Faszination für das Exotische bestimmt. Nomaden, Naturvölker und natürlich auch Vodou; der direkte Kontakt zur Natur, zu Übersinnlichem und den Verstorbenen erscheinen ebenso verlockend wie beängstigend. Dazu gesellt sich eine grausame Geschichte, die in den Köpfen vorwiegend durch den immer wieder in Mode kommenden Kolonialstil und Hollywood-Verfilmungen präsent ist. Hinzu kommt, dass das weltpolitische Tagesgeschehen oft derart brisant scheint, dass Hungersnöte, Epidemien, Völkermorde und Diktaturen in Afrika schnell zur Randnotiz werden. Ein Kontinent, der im Chaos zu versinken scheint. Vor allem im frankophonen Raum Schwarzafrikas gibt es allerdings immer mehr hervorragende SchriftstellerInnen, die uns Europäern spannende, andere und ungeahnte Einblicke in das afrikanische Denken und Handeln geben könnten. Könnten, da viele Texte oft gar nicht erst ins Deutsche übersetzt werden. Weitaus angenehmer scheint es nämlich, sich dem Fremden, dem Exotischen über das Bekannte zu nähern. Und so stapeln sich die Werke überraschend vieler deutsch-afrikanischer schriftstellernder Prinzessinnen, Massais etc. in den Buchläden und finden reißenden Absatz.
Und jetzt also auch noch ein Krimi! Einer, der mitten in Westafrika, im kleinen Staat Benin, spielt. Von einer deutschen Autorin – die sich allerdings auszukennen scheint, die der erotischen Exotik nicht wirklich erliegt und deren Debütroman fast in jeder Hinsicht hinreißend und überzeugend gelungen ist.
Ada Simon, die Protagonistin in Lena Blaudez‘ „Spiegelreflex“, liebt Afrika, und insbesondere das westafrikanische Benin ist für sie zu einer zweiten Heimat geworden. Als Fotoreporterin hat sie das Land schon oft bereist und kennt sich für eine Europäerin hervorragend aus. Und da sich Fotos von Afrikanerinnen, die auf traditionelle Weise ihre Produkte herstellen, gut in die westlichen Industrienationen verkaufen lassen, kann sie hier bestens ihrem viel geliebten Beruf nachgehen. Dass derartige Reisen für eine |yovo|, ein Weiße also, nicht ganz ungefährlich sind, merkt Ada direkt nach der Ankunft am Flughafen. Denn anstatt sie zu ihrem Hotel zu fahren, entführt sie der Taxifahrer in einen dunklen Hinterhof, wo offensichtlich Menschen für den Vodou-Kult ‚gesammelt‘ werden. Als Europäerin hat Ada aber noch mal Glück, denn in Afrika ist ‚eine weiße Leiche eine besondere Leiche‘, und somit handelt man sich mit entführten, getöteten |yovos| nur unnötigen Ärger ein.
Am nächsten Morgen scheint das Leben wieder in Ordnung zu sein. Ada genießt die Atmosphäre und trifft ihren alten Freund Patrick in Papa Pauls |Champagner-Bar|. Die Freude über das Wiedersehen ist groß, zu erzählen gibt es viel. Ada schmiedet Pläne für ihre Fotoreise und knipst sich – wie Fotografen das nun einmal tun – durch die Bar, um das Flair festzuhalten. Als kurz darauf Patrick erschossen wird, ist bald klar, dass Ada den Mörder abgelichtet haben muss. Und dass ein derartiger Beweis von skrupellosen Mördern nicht hingenommen werden kann, versteht sich ebenfalls von selbst. Die Bedrohung wird überdeutlich, doch Ada macht sich trotz aller warnenden Einschüchterungsversuche auf ihre Reise durch das Land, beschützt nur durch ein Gris-Gris und eine Vodou-Zeremonie.
Wohl nicht ohne Hintergedanken lässt die Autorin Blaudez ihre Protagonistin Ada Simon während ihrer Reise immer wieder in Bulgakows „Der Meister und Margarita“ lesen. Handelt es sich doch hierbei um ein Hauptwerk russischer Literatur über Moral, Unterdrückung und Geldgier, in dem übrigens die Schwarze Magie keine unbedeutende Rolle spielt. Und zweifelsohne ist auch Spiegelreflex. Ada Simon in Cotonou ein Sittenbild nicht nur der afrikanischen Kultur. Ein spannendes Sittenbild voller Abenteuer, das Gut und Böse in vielerlei Schattierungen aufzeichnet und das Zeitgeschehen mit dem Übersinnlichen verflechtet. Das gelingt so faszinierend, dass es kaum stört, dass die eigentliche Krimihandlung etwas dürftig – dafür aber immerhin sehr realistisch anmutet. Korruption, Kredite, Spenden, Bodenschätze: Es sind das Geld und die Macht, die regieren, die ganz privaten Vorteile eines jeden. Und über allem regiert der Vodou, der Staatsreligion ist. Ada Simons Fotoreportage wird eine Reise von Projekt zu Projekt und niemanden scheint es zu stören, dass, sind die Gelder einmal geflossen, weitere Unterstützung, Ersatzteile etc. benötigt werden, um tatsächlich Hilfe zu leisten. Die Jagd nach den richtigen Fotos, der richtigen Kameraeinstellung wird mit der Zeit zunehmend zur Flucht vor Patricks Mördern. Ada Simon erscheint dabei ebenso professionell wie naiv. Extrem cool auf alle Fälle, wenn sie durch die Wüste rast, ohne Passierschein dazu gezwungen ist, Beamte zu bestechen, afrikanische Frauen beim Hirsestampfen fotografiert oder über afrikanische Märkte bummelt, um die Ingredienzien für eine Vodou-Zeremonie zu besorgen. Ada ist von dem Land, durch das sie fährt, das sie in Bildern dokumentiert, fasziniert. Sie lässt sich auf die Kultur ein, ohne den Anspruch, sie zu vollends zu verstehen. Vor allem aber lässt sie sich durch nichts so schnell beeindrucken.
Bemerkenswert an „Spiegelreflex“ ist vor allem der Stil. (Wenig ‚fraulich‘ soll er sein, was wohl heißen soll: Auch Männer dürfen sich an die Lektüre wagen?) Wie der Titel es vorgibt, erzählt Lena Blaudez wie durch die Perspektive einer Kamera reflektiert und distanziert, beschreibt mal schonungslos drastisch, mal liebevoll, fast immer amüsant in unendlichen Facetten den afrikanischen Alltag. Mal bietet sie mit dem Breitwinkel ein buntes Panorama, mal zoomt sie wie beiläufig dicht an Persönliches, Menschliches, Tragisches. Wir sehen einen Teil Afrikas durch Adas Linse, wir hören, riechen, fühlen und schmecken mit ihr – und das macht eindeutig Lust auf mehr! Und da der zweite Band schon geschrieben sein soll und Ada Simon auf den letzten Seiten von Spiegelreflex plant, nach Kamerun aufzubrechen, bleibt am Ende nur die Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen. Vielleicht ja in Douala! Oder am Strand von Limbé?
© _Anna Veronica Wutschel_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de/ veröffentlicht.|