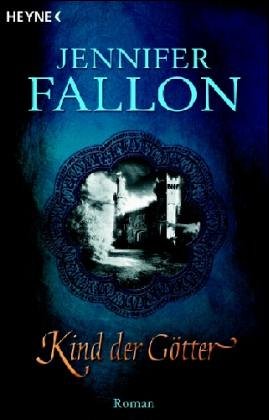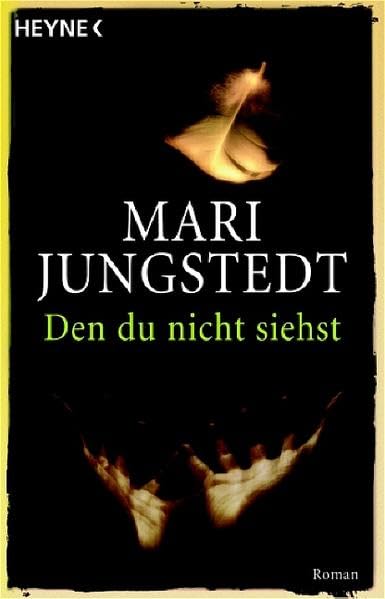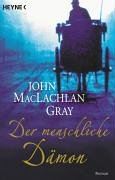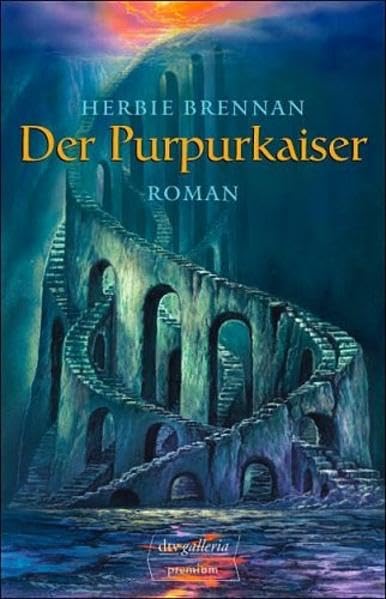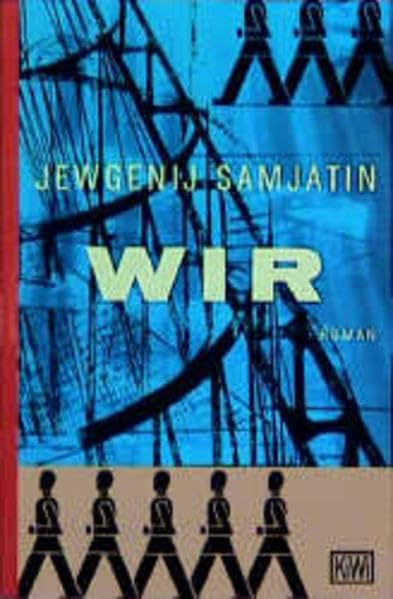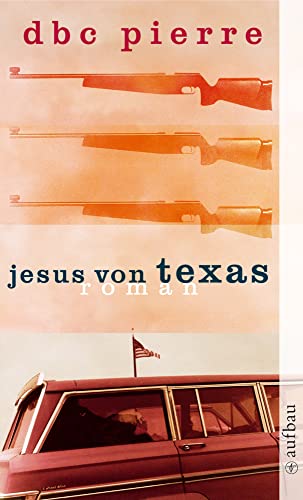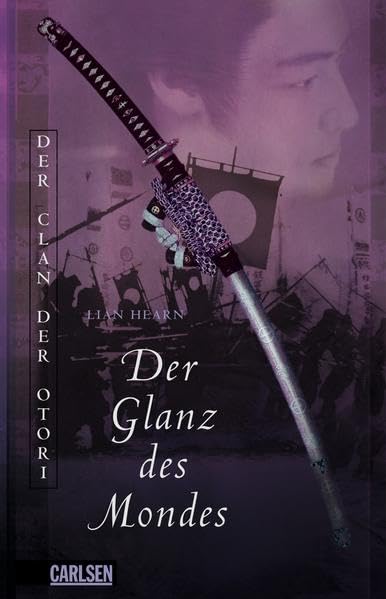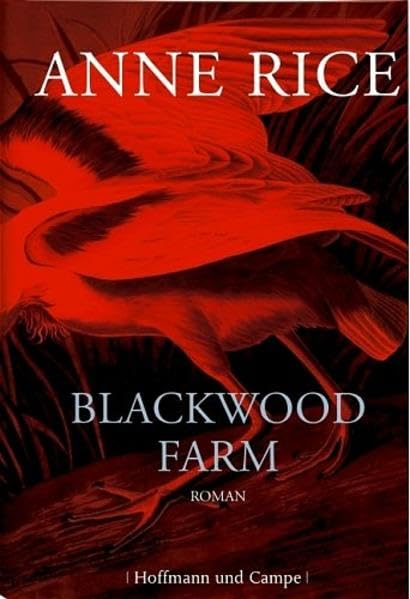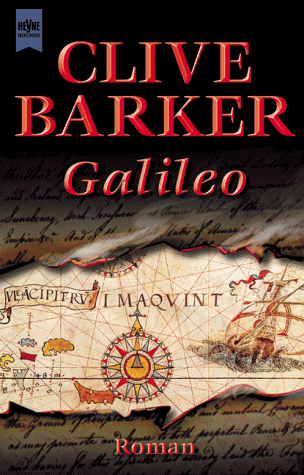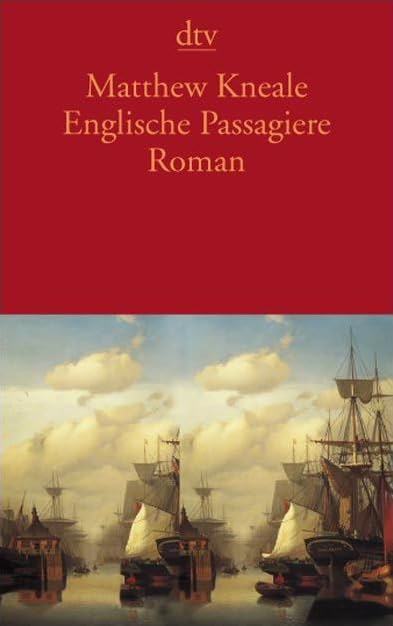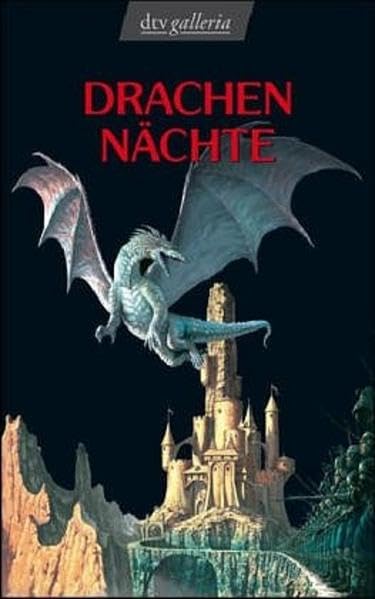Lyndle Hall im Naturschutzpark Northumberland an der Grenze zu Schottland ist ein Ort, an dem es quasi spuken |muss|: Einsam mitten im düsteren, feuchten Moor gelegen und dort schon im Mittelalter erbaut, ist der gewaltige Bau – mehr Trutzburg als Gutshof – heute zu einer halb verfallenen, eigentlich unbewohnbaren Ruine heruntergekommen. Doch die letzten Nachfahren der einst mächtigen und reichen Familie Herrol harren stur in dem alten Gemäuer aus: Claudia, die herrische Dame des Hauses, und ihr Gatte Francis, der gleichzeitig ihr Cousin ist. Der zweifelhaften Verbindung entsprang Sohn Nicholas, der schon seit frühester Kindheit zwischen Lyndle Hall und der Nervenklinik Broughton pendelt.
Zu allem Überfluss beginnen nun auch böse Geister aus dem Jenseits den jungen Mann zu piesacken: Aus dem Nichts erscheinen üble Bissmale auf seinem Körper. Da die Attacken immer heftiger werden, wendet sich die ratlose Mutter an das „British Institute for Paranormal Research“ in Edinburgh. Dort versucht man seit Jahren eher schlecht als recht dem Übernatürlichen auf die Spur zu kommen und reagiert sehr interessiert auf Claudias Bitte, ihr einen Spezialisten zu schicken. Aus trauriger Erfahrung klug und misstrauisch geworden, schickt das Institut Dr. Audrah Sidows, die spezialisiert darauf ist, scheinbare parapsychologische Phänomene und Schwindler zu entlarven. Weil sie in den vielen Jahren ihrer Tätigkeit nie einen echten Spuk entdecken konnte, hat sie nun ihre Kündigung eingereicht: Lyndle Hall wird ihr letzter Hausbesuch sein.
In Lyndle beginnen sich zur selben Zeit sehr irdische Mächte zu formieren. Die Polizei, verkörpert durch Detective Inspector Tate, bemüht sich, die junge Studentin Ginny Mulholland zu finden. Sie war einer Einladung Nicholas Herrols gefolgt, sich als Haushaltshilfe in Lyndle Hall zu verdingen. Seitdem ist sie verschollen – ebenso wie Francis, der Hausherr, mit dem sie nach Auskunft Claudias durchgebrannt ist. Tate mag dem nicht recht Glauben schenken und vermutet eher eine Bluttat des inzwischen völlig irre gewordenen Nicholas‘.
Ginny Mulhollands Verschwinden hat die Aufmerksamkeit der Medien erregt – und den mysteriösen John Cranmer nach Lyndle gelockt. Dieser hat sich einen Namen als Medium gemacht und rühmt sich seiner Kontakte zum Jenseits. Zu gern würde er mit der Polizei zusammenarbeiten und erregt durch seinen Eifer Tates Misstrauen. Aber Cranmer ist gerissen, und niemand weiß dies besser als Audrah Sidows, die ihm schon lange auf die Schliche kommen möchte. Denn er kennt Audrahs gut gehütetes Geheimnis: Vor acht Jahren verschwand ihr Gatte Lars während eines Waldspaziergangs, während er praktisch neben ihr lief – er wurde nie gefunden, und seitdem hofft Audrah insgeheim auf Hilfe aus dem Geisterreich. Cranmer reizt und quält sie mit Andeutungen, die vorgeblich auf seine Sehergabe zurückgehen und gerade so viel Wahrheit enthalten, dass ihm wissenschaftlich oder juristisch nicht beizukommen ist.
Die Situation verwirrt sich weiter, als unweit von Lyndle Hall die junge Rachel Harvey aufgegriffen wird. Sie hat von einer Tante ein Cottage geerbt und dort nun einen Geist gesehen, wie sie behauptet. Solche Neuigkeiten sind Wasser auf die Mühlen von Marion Thomas, die vor zwei Jahren ihre Tochter bei einem tragischen Unglück verloren hat. Die Mutter vermutet allerdings einen vertuschten Mord und terrorisiert die Behörden und die Presse mit ihrem zur fixen Idee geronnenen Verdacht. Da sich der berühmte Cranmer in Lyndle aufhält, beschließt Marion, ihn dort aufzusuchen und um Hilfe zu bitten.
In Lyndle Hall sind die Dinge inzwischen dramatisch in Bewegung geraten. Der emsige Tate hat sich einen Durchsuchungsbefehl beschafft und findet tatsächlich die Leiche einer unter bizarren Umständen umgekommenen jungen Frau – sie muss allerdings schon viele, viele Jahre dort gelegen haben. Der nächste Leichenfund folgt kurze Zeit später, doch auch dieses Opfer ist keineswegs die viel gesuchte Ginny. Das wahre Geheimnis von Lyndle Hall ist höchst komplex; die Beteiligten werden noch manche unschöne Überraschung erleben, bis es endlich gelüftet ist …
Dass die wahren Ausgeburten der Hölle auf dieser Welt in der Regel dem menschlichen Geist entspringen, ist heute eine allseits bekannte und auch akzeptierte Tatsache. Allerdings gibt es da eine Nische oder besser gesagt ein Reservat, in dem einige Fabeltiere aus der Frühzeit der Vernunft bis ins 3. Jahrtausend überleben konnten: das Jenseits oder das Reich der Geister, wo sich die Seelen der Verstorbenen mit Dämonen aller Art und Bosheit ein Stelldichein geben. Wenn sie sich dort langweilen, kommen sie gern auf einen Sprung in diese Welt und geben sich mal kryptisch, mal finster. Auf jeden Fall sind sie schwer zu verstehen und noch schwieriger zu fassen, was praktisch für eine bestimmte Sorte Mensch ist, die sich als Mittler zwischen den Sphären versteht, um auf diese Weise Ruhm oder Geld zu erlangen oder wenigstens die eigene Mittelmäßigkeit zu überwinden.
Alle hier skizzierten Typen treffen wir in „Tanz mit dem ungebetenen Gast“ wieder. Geradezu didaktisch stellt sie uns Julia Wallis Martin vor. Dies geschieht in der ersten Hälfte ihres neuen, im Original wie in der Übersetzung anscheinend gleichzeitig erscheinenden Werkes mit dem dieser Autorin eigenen Geschick, eine spannende Handlung nicht nur erfinden, sondern zügig und einfallsreich und mit vielen unerwarteten Hakenschlägen einem furiosen Höhepunkt zuzutreiben. Das Ganze spielt in einer liebevoll gestalteten Kulisse, die ohne Angst vor dem Klischee (und wohl auch ein wenig ironisch) mit allen Requisiten ausgestattet wurde, die uns die klassische Gespenstergeschichte lieb und teuer werden lässt.
Der Abstecher ins Phantastische überrascht dabei nur im ersten Augenblick. Wie immer bei Martin steht im Mittelpunkt der Mensch, der keine Geister braucht, um sich und den Seinen das Leben schwer zu machen. Deshalb folgt in der zweiten Hälfte die „logische“ Auflösung aller seltsamen Ereignisse, die sich beim „Tanz“ zugetragen haben. Dies sei an dieser Stelle verraten, ohne dass dadurch dem Leser die Spannung genommen werde; eine echte Überraschung ist es ohnehin nicht, da Wallis selbst diese Katze frühzeitig aus dem Sack lässt.
Überhaupt sind zur zweiten Hälfte von „Tanz mit dem ungebetenen Gast“ einige kritische Anmerkungen zu machen. Martin verfängt sich dort sichtlich im Geflecht ihrer Handlung, das sie selbst so kunstvoll gewoben hat. Vielleicht hätte sie besser nicht das gesamte Handbuch des Okkulten und einen Crashkurs in Küchen-Psychologie zu einem einzigen, dazu nicht sehr umfangreichen Roman verarbeitet. Die Erklärungen für das scheinbar Übernatürliche sind jede für sich überzeugend. In ihrer Gesamtheit und vor allem im Zusammenspiel stellen sie die Geduld des Lesers indes auf manche Probe. Und während ihn die Thriller-Maschine zunächst gut geölt und wie auf Schienen dem Höhepunkt entgegenträgt, schaut er im Finale unter die weit geöffnete Motorhaube: Nun wird allzu offensichtlich, wie die Geschichte konstruiert ist, und das mindert den Spaß an der Reise.
Viel macht Martin im Detail wieder wett. Unter die Haut geht auf jeden Fall die Figur der Marion Thomas, die über den Tod ihrer Tochter gemüts- oder gar geisteskrank geworden ist, an ein simples Unglück als Erklärung weder glauben kann noch will und stattdessen Gott und die Welt verfolgt und bedrängt auf der Suche nach einem Schuldigen, den es nicht gibt – ein Kabinettstück echten psychologischen Thrills, auch wenn diese Marion Thomas mit der eigentlichen Geschichte streng genommen gar nichts zu tun hat. Sie existiert allein zu dem Zweck, die Figur des Mediums Cranmer stärker zu konturieren. Dabei kann dieser auch ohne rasendes Muttertier sehr gut bestehen. Ist er ein geltungssüchtiger Lügner, oder hat er doch einen Draht nach drüben? Auch als im Finale erklärt und erläutert wird, bis des Lesers Kopf raucht und die Geister in hellen Scharen zurück in die Twilight Zone fliehen, bleibt ein Rest Ungewissheit: ein kluger Schachzug der Autorin. Solche Offenheit hätte man sich öfter gewünscht; nicht weil Martin die Geistergläubigen dieser Welt so unbarmherzig zaust – denen kann eine Dosis gesunder Realitätssinn (oder ein tüchtiger Tritt in den Hintern) eigentlich niemals schaden -, sondern um der Geschichte willen.
So muss Julia Wallis Martin letztlich vor demselben Problem kapitulieren, das seit jeher auch Autoren größeren Kalibers zu schaffen macht: Das Grauen im Angesicht des Übernatürlichen ist schwierig heraufzubeschwören und ein flüchtiges Gut. Erklärungen lassen es dahinschmelzen wie Butter unter der Sonne. Doch der Leser einer fiktiven Geschichte wie der vom „Tanz mit dem ungebetenen Gast“ will nicht belehrt, sondern unterhalten werden. Daher ist er bereit zu billigen, was er in der Realität verlacht. Werden seine Illusionen gar zu unbarmherzig zerstört, stellt sich kein zufriedener „Aha!“-Effekt, sondern Enttäuschung ein – und genau das geschieht hier und fügt dem Roman unnötigen Schaden zu.