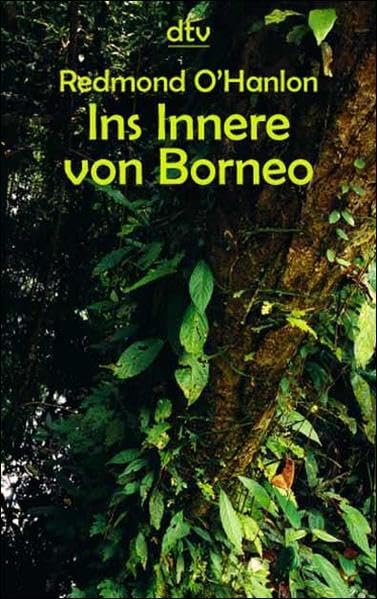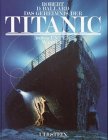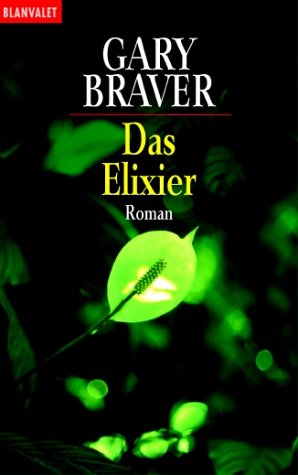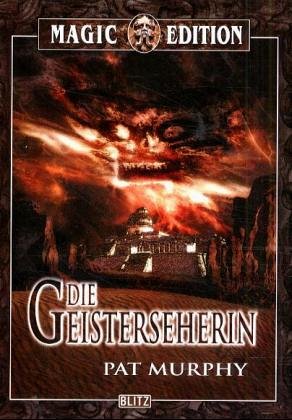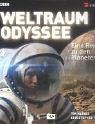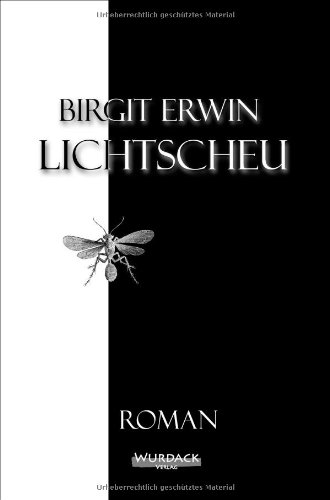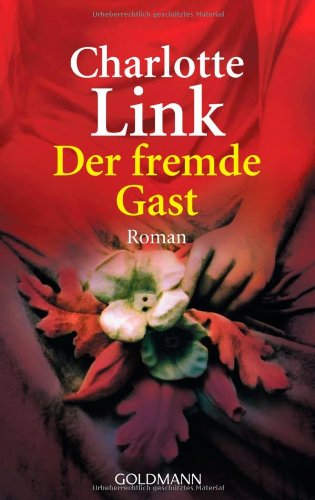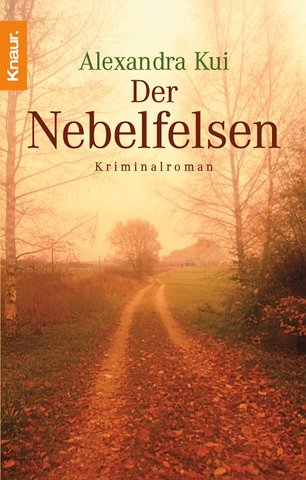Die Zusammenarbeit Hörbuch und Publikumszeitschrift scheint sich überaus zu lohnen. In diesen Wochen liegen der _“Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“_ jeweils in drei Folgen ungekürzte Hörbuchlesungen von „Die Schatzinsel“, „Robinson Crusoe“, „In 80 Tagen um die Welt“ und „Robin Hood“ kostenlos bei. Die PR-Aktion für die Jugendklassiker-Reihe des „Verlag und Studio für Hörbuchproduktionen“ soll einer größeren Öffentlichkeit für die insgesamt 18 Titel umfassende Reihe dienen. Auch Random House und Verlagshaus Gruner + Jahr – konkret die Frauenzeitschrift „Brigitte“ – haben eine gemeinsame _Hörbuch-Edition „Starke Stimmen“_ konzipiert und das kommt richtig gut an. Bereits die erste Ausgabe für Elke Heidenreichs Interpretation von Dorothy Parkers „New Yorker Geschichten“ hatte schon vor dem Erstverkaufstag 50.000 Vorbestellungen. Für ein Hörbuch eine gigantische Zahl. Hörbücher bleiben zwar mit einem steigenden Marktanteil von nur 3,2 % eigentlich unbedeutend, aber statistisch glaubt man an den Erfolg. Denn dieser schnellt nach oben. 2004 14,7 % Umsatzzuwachs gegenüber 2003, 2003 waren es 10,3 % gegenüber 2002 gewesen. An kräftigsten natürlich im Bereich der Belletristik. Und dort gibt es nun die ersten literarisch anspruchsvollen satten Verkaufserfolge. Der Verband der phonographischen Wirtschaft verleiht dem Verlag _steinbach sprechende Bücher_ gleich _drei goldene_ Schallplatten für die Hörbücher von _Paulo Coelho_. 150.000-mal wurde sowohl das Hörbuch „Der Alchemist“ wie auch „Der Wanderer“ verkauft und 100.000-mal „Unterwegs“. Der auf die ungekürzte Lesung profilierte Verlag mit Schwerpunkt auf zeitgenössischer Literatur, klassischen Autoren, literarisches Sachbuch sowie Kinderhörbuch produziert jährlich etwa 30 Titel, lieferbar sind rund 200 Titel. Gespannt kann man jetzt schon auf das im Mai erscheinende Hörbuch „Die dunkle Seite der Liebe“ von Rafik Schami mit 20 CDs sein. Die Preise für Hörbücher purzeln endlich auch immer mehr. Den gestarteten Niedrigpreisreihen anderer Verlage hat sich nun auch der Münchner _Hörverlag_ mit seiner „Smart Edition“ angeschlossen. Die Reihe startete mit neun Titeln zum Preis von 7,99 Euro.
Zeitungen scheinen mit den Bucheditionen richtig Geschäfte zu machen. Die _“SZ-Bibliothek“_ der Süddeutschen Zeitung, die auf 50 Titel konzipiert war, wird fortgesetzt und um weitere 50 Bände erweitert. Nicht nur mit Büchern und Hörbüchern, auch mit DVDs wird da viel ausprobiert. Nach der _DVD-Reihe_ in Kooperation ZDF und der „Welt“ legte jetzt auch die _“Frankfurter Allgemeine Zeitung“_ in Zusammenarbeit mit „Spiegel TV“ eine zwölfteilige Dokumentation zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert vor. Außerdem hat die „FAZ“ seit Ende Februar bis Anfang Mai unter dem Titel „Faszinierende Natur“ eine zehnteilige Reihe von BBC-Dokumentationen auf DVD. Und nahtlos an die „SZ-Bibliothek“ begann sich die _“SZ-Cinemathek“_ anzuschließen, die ebenfalls 50 Spielfilme auf DVD umfasst. Was den Schaden solcher Zeitungs-Billig-Editionen für den Buchhandel angeht, beruhigt der Börsenverein. Im gesamten Kaufverhalten machte dieser Umsatz etwa 4 % aus und führte eher dazu, das Interesse an Büchern zu wecken.
Gut laufen im übrigen Buchgeschäft auch bestimmte _“Ratgeber“-Titel_. Das Lieblingsthema ist wie seit Jahren unverändert der eigene Körper und seine Befindlichkeit. Wellness und Selbstfindung liegt nach wie vor im Trend.
Am 16. Juli, eine Minute nach 1 Uhr (0.01 Uhr der britischen Sommerzeit), darf der _sechste Band von Harry Potter_ verkauft werden und im März ging der Hype schon wieder los. Die Buchhändler sind verärgert, denn wieder gibt es einen langen Vertrag mit 13 Punkten zu unterschreiben: Vor dem besagten Tag darf man weder selbst das Buch lesen, noch dürfen dies die Mitarbeiter; sogar Fotografien von Kartons sind unzulässig und noch mal anders als in den Vorjahren gibt es nur ein beschränktes Remissionsrecht: erst ab 1. November darf remittiert werden, die Gutschrift darf aber 20 % des Betrags der Eingangsbestellung bei Bloomsbury nicht überschreiten. Auf Nachbestellungen wird überhaupt kein Rückgaberecht mehr eingeräumt. Da keine Preisbindung vorliegt, läuft der Preiskampf auf Hochtouren, wahrscheinlich legen viel Händler wieder drauf, anstatt mal zu verdienen. Die Niedrigstpreisgarantie hat bislang Weltbild mit 15,75 Euro. Wer es woanders billiger bekäme, braucht dann sogar bei Weltbild nur diesen Preis zu zahlen. In diesem Jahr entschließen sich viele der kleinen Buchhändler erstmals dazu, die Verträge nicht zu unterzeichnen und Harry Potter bei Erscheinen nicht anzubieten, weil sie beim anstehenden Preisdumping einfach nicht werden mithalten können. Bei Interesse von Kunden nutzen sie die Barsortimente.
Die Zeitschrift _Hagal_, bislang im Verlag Zeitenwende erschienen, ist vom Regin-Verlag übernommen worden und kam im März erstmals unter ihrem neuen Untertitel „Zeitschrift für Tradition, Metaphysik und Kultur“ heraus. Der bisherige Untertitel „Zeitschrift für Mythologie, Religion, Metaphysik und Esoterik“ wurde geändert, weil esoterische und mythologische Themen künftig nur dann noch behandelt werden, wenn sie in einem Kontext mit der überlieferten Tradition stehen.
In Polen ist beim Warschauer Verlag XXL das in Deutschland verbotene Buch von Adolf Hitler _“Mein Kampf“_ als Neuausgabe gedruckt worden. Die Auflage liegt bei 2000. Bereits 1992 war dort eine erste Ausgabe erschienen, die inzwischen vergriffen war. Unter dem Kommunismus war das Buch in Polen verboten. In der Türkei ist Hitlers Buch seit langem sehr gefragt und erhältlich. „Kavgam“ (der türkische Titel) gehört dort zu den meist verkauften Büchern des ersten Quartals 2005.
_Rolf Hochhuth_ hat den Fehler begangen, sich differenzierter zu „rechten“ Zuordnungsmechanismen zu äußern, indem er den in Deutschland als „Holocaust“-Leugner bezeichneten britischen Historiker David Irving als „fabelhaften Pionier der Zeitgeschichte“ bezeichnete. Diese Aussage führte sofort zu großem Aufschrei über Hochhuth in Deutschland, weswegen er sich von seiner eigenen Aussage schnell wieder distanzierte. Dennoch wird nun die Deutsche Verlagsanstalt die für Frühjahr 2006 geplante Autobiografie von Hochhuth, die zu seinem 75. Geburtstag am 1. April erscheinen sollte, nicht mehr veröffentlichen, da die getätigte Aussage nicht mit den Autoren von DVA in Einklang zu bringen sei. Hochhuth besteht allerdings auf Vertragserfüllung und geht mit Anwalt vor Gericht.
Bundesinnenminister Otto Schily hat den in Hessen ansässigen Verlag der türkischsprachigen _Zeitung „Anadoluda Vakit“_ wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung verboten. Unter dem Deckmantel einer angeblich seriösen Berichterstattung sei antijüdische und antiwestliche Hetze verbreitet worden. Bereits im Dezember hatte die CDU gegen das Blatt, das in Deutschland in einer Auflage von 10.000 Exemplaren erscheint, verfügt, Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet.
Am 18. Februar kam endlich der Rat für deutsche Rechtschreibung zu seiner ersten Arbeitssitzung über die _Rechtschreibreform_ in Mannheim zusammen. Diskutiert wurde die Getrennt- und Zusammenschreibung. Von den insgesamt 36 Sitzen des Gremiums blieben die beiden Plätze der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, die aus Protest fernbleibt, nach wie vor unbesetzt. Da man nicht wirklich weiter weiß, wurde einfach mal wieder ein siebenköpfiger Arbeitskreis ins Leben gerufen. Das Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, endlich eine diskussionsfähige Grundlage zu schaffen. Geleitet wird die Gruppe von Ludwig Eichinger, dem Direktor des Instituts für Deutsche Sprache. Eigentlich soll der Rat bis zum 1. August die bereits reformierte Reform noch mal reformieren, bis dahin trifft sich der Rat noch dreimal. Das Ganze bleibt schildbürgerisch und Eichinger rechnet auch nicht mit der Klärung aller strittigen Fragen bis zum Inkrafttreten der Reform in den Schulen am 1. August. Auch einer der ausgetretenen prominenten Reformgegner ergreift im „Rat für deutsche Rechtschreibung“ doch wieder das Wort. Sprachwissenschaftler _Theodor Ickler_ vertritt die Interessen des deutschen PEN-Zentrums. Er möchte im Rat die „Interessen der Schulbuchvertreter“ aufdecken, denen er unterstellt, die Rücknahme der Reform zu verhindern. Sein Hauptanliegen ist ein „Moratorium“ für die Reform, die im August an den Schulen eingeführt wird.
Mit _Hans Christian Andersen_ können viele Verlage in diesem Jahr Jubiläum begehen. Seine Märchen sind jedem bekannt, allerdings weniger, dass er auch fünf Romane geschrieben hatte. Sein erster Roman „Der Improvisator“ von 1835 ist nun im 170. Erscheinungsjahr. Ansonsten feierte man am 2. April seinen 200. Geburtstag und am 4. August wird der 130. Todestag gewürdigt. Deswegen sind jede Menge Neuerscheinungen der Andersen-Märchen und -Romane, sowie Bücher über den Autor frisch auf den Mark gekommen. Einen Überblick über die medialen Höhepunkte, die zu den Jubiläen stattfinden, gibt es auf http://www.HCA2005.com.
Auch der am 29. Januar 1455 in Pforzheim geborene _Johannes Reuchlin_ ist im 550. Jubiläumsjahr. Sein Kampf gegen religiösen Fanatismus, Anmaßung und Intoleranz bildet bist heute die vorherrschende Perspektive auf das Leben und Werk dieses Gelehrten. Als neuplatonisch-kabbalistischer Philosoph, lateinischer Dichter, Gräzist und Begründer der christlichen Hebraistik hätte Reuchlin ohnehin Eingang in die Geschichtsbücher gefunden; zu jenem epocheprägenden „Wunderzeichen“, als das ihn nicht zuletzt Goethe gerühmt hat, wurde er aber erst durch seinen entschiedenen Einsatz für den Erhalt der jüdischen Literatur und seine daraus erwachsene Rolle als Verteidiger der Wissenschaft. Seine gesamten Werke nebst seinen Briefwechseln sind bei Frommann-Holzboog aufgelegt (www.fromman-holzbog.de).
Immerhin auch schon 130. Geburtstag feierte man mit _Edgar Wallace_, geboren am 1. April 1875 in Greenwich, gestorben 10. Februar 1932 in Hollywood. Seine Kriminalromane wurden bereits in den 20er Jahren in Deutschland gelesen, aber ihre große Renaissance kam in den 50er Jahren mit der auffällig in rot gehaltenen berühmten Taschenbuchreihe des Goldmann-Verlages. Noch erfolgreicher waren dann die Filme – die ersten drei gab es bereits 1927 („Der große Unbekannte“), 1929 („Der rote Kreis“) und 1931 („Der Zinker“). Aber auch hier gelang der Durchbruch ebenso erst in den fünfziger Jahren mit „Der Frosch mit der eisernen Maske“. Wallace schrieb über hundert Kriminalromane. Davon wurden unter der Gesamtleitung von Horst Wendlandt und der Regie von Alfred Vohrer und Harald Reinl insgesamt 32 verfilmt. Ende der 60er Jahre ging es mit der Erfolgsreihe zu Ende, in welcher eine ganze Reihe großartiger Schauspieler regelmäßig agierten. Unvergesslich dabei vor allem Klaus Kinski in seinen Verbrecher-Rollen.
Der Verlag _Brockhaus_ begeht 200. Jahresjubiläum des Geburtstages von E. A. Brockhaus und zelebrierte diess mit einem spektakulären Festakt auf der diesjährigen Leipziger Messe.
Ebenso Jubiläum begeht der _Orlanda Frauenverlag_, der nun bereits seit drei Jahrzehnten gute Literatur für Frauen publiziert. Nachdem bei den meisten renommierten Verlagen die Frauenbuchreihen eingestellt sind, ist Orlanda einer der wenigen unabhängigen Verlage zur Frauenthematik. Begonnen hatte alles 1975 noch im Selbstverlag mit dem _“Hexengeflüster“_, einem Selbsthilfebuch der Frauengesundheitsbewegung. 1980 wurde der Verlag in sub rosa umbenannt, bevor 1986 die Idee kam, mit Orlanda den abgewandelten Titel eines Romans von Virginia Wolf als Verlagsnamen zu nehmen. Einer der weiteren großen Erfolge war _“Wechseljahre Wechselzeit“_ von Rina Nissim. Einer der Schwerpunkte von Anfang an ist auch die Literatur für das lesbische Publikum. In diesem Frühjahr startet mit |orlanda – die edition| eine neue Belletristikreihe, die von der langjährigen Fischer-Lektorin Ingeborg Mues betreut wird. Fischer hat ja seine anspruchsvolle Frauentaschenbuchreihe „Die Frau in der Gesellschaft“ vor einiger Zeit eingestellt. Dagegen sind in die derzeit boomende Frauenbelletristik hauptsächlich Romanheldinnen in eine leicht zu lesende Unterhaltungsliteratur verpackt, die in hohen Auflagen gedruckt und als preiswerte Stapelware angeboten wird. Der dafür verwendete Begriff: _“freche Frauenliteratur“_. Die Zielgruppe sind Frauen zwischen 25 und 35. Die besten Titel erreichen Auflagen von drei Millionen Exemplaren. Literarisch wertvoll sind sie nicht, eher substanzlos aus dem Leben gegriffen. Die Autorinnen gehören auch nicht zu hochgejubelten deutschen Gegenwartsautorinnen. Die heutige Frauenliteratur hat nichts zu tun mit der engagierten Frauenliteratur der 70er Jahre, die im Zusammenhang mit der neuen Frauenbewegung vor allem von Frauen für Frauen geschrieben wurde. Beispiele von damals: „Häutungen“ von Verena Stefan, „Wie kommt das Salz ins Meer?“ von Brigitte Schwaiger, „Gestern war heute“ sowie „Hundert Jahre Ewigkeit“ von Ingeborg Drewitz, „Kassandra“ von Christa Wolf oder auch die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. In all diesen Romanen ging es um die Beschreibung des Rollenverständnisses der Frau in einer vom Mann geprägten Gesellschaft. Begleitet wurde diese Erkundung von der großen Resonanz der feministischen Debatte innerhalb der Gesellschaft, was wiederum Verlage dazu veranlasste, eigene Frauen-Reihen aufzubauen. So entstanden 1977 die Reihen „Neue Frau“ bei Rowohlt und 1978 „Frau in der Gesellschaft“ bei S. Fischer. Damals wurden in dieser Sparte noch Alternativen und Antworten gesucht. Davon ist in dem neuen Genre der „frechen“ Frauen nicht mehr viel übrig geblieben. „Frech“ und „angepasst“ ist da kein Gegensatzpaar mehr. Der Stil dieser neuen Bücher ähnelt den weiblichen Psycho-Befindlichkeitstexten aus Frauenzeitschriften. Tatsächlich stammen viele der jüngeren Autorinnen aus den Redaktionen von „Brigitte“, „Cosmopolitan“, „Vogue“, „Freundin“ oder „Elle“. Begründet wurde das Genre Ende der 80er Jahre durch Eva Heller („Beim nächsten Mann wird alles anders“), Hera Lind („Ein Mann für jede Tonart“) und Gaby Hauptmann („Suche impotenten Mann fürs Leben“). Die Sehnsucht nach der großen Liebe und dem richtigen Mann fürs Leben scheint zeitlos. Auffallend an dieser Literatur ist jedoch, dass sie das traditionelle Frauenbild bevorzugt. „Frech“ hat heute nicht mehr den emanzipatorischen Beigeschmack der 70er Jahre. Der Markt dieser Literatur ist größtenteils aufgeteilt zwischen den Verlagen der Random-House-Gruppe (Goldmann, Heyne, Blanvalent etc.), Rowohlt, den S.-Fischer-Verlagen, der Verlagsgruppe Lübbe, Piper, Droemer Knaur und dtv. Die Übergänge zwischen „frechen“ Frauen als neuem Genre, aktueller Frauenliteratur und klassischen Liebesromanen sind fließend. Es gibt im dritten Jahr schon eine eigenständige Buchmesse – die „Liebesroman Messe“ vom 20. bis 22. Mai in Wiesbaden mit 200 geladenen Gästen, darunter Autorinnen und Autoren, Übersetzer, Lektoren und Literaturagenten. Die Verlagsgruppen Droemer Knaur, Lübbe und Random House haben dort Stände und die „freche“ Frauenliteratur Workshops und Gesprächsrunden.
Zehnjähriges Jubiläum begeht auch die Reihe _C.H. Beck Wissen_, in der bereits mehr als 250 Titel erschienen sind.
Am 20. Februar verstarb _Hunter S. Thompson_, einer der besten Schriftsteller unter den amerikanischen Journalisten. Am populärsten ist wohl sein Roman „Angst und Schrecken in Las Vegas“, der auch sehr erfolgreich verfilmt wurde.
Nach langer schwerer Krankheit ist der Verleger _Dr. Karl Blessing_ am 12.3.05 in München im Alter von 63 Jahren verstorben. Dr. Karl H. Blessing, geboren am 24. März 1941 in Berlin, verfasste nach dem Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie seine Dissertation über die Frühwerke Döblins. Lange Jahre in leitenden Positionen in der Verlagsbranche tätig, leitete er von 1982 – 1995 als Verleger und Programmgeschäftsführer die Verlage Droemer, Knaur und Kindler. 1996 gründete er mit der Bertelsmann Buch AG den Karl Blessing Verlag und verlegte dort niveauvolle Belletristik und interessante Sachbücher. Als klassischer Autorenverleger bot er in seinem zutiefst individuellen Programm immer wieder bekannten und noch nicht bekannten Autoren eine verlegerische Heimat. So wurde er 2004 vom Magazin |BuchMarkt| zum Verleger des Jahres gewählt. Unter dem Dach der Verlagsgruppe Random House wird das anspruchsvolle Programm im Sinne Karl Blessings weitergeführt.
Der diesjährige _Leipziger Buchpreis_, seit 1994 jährlich auf der Leipziger Buchmesse vergeben, geht an die kroatische Schriftstellerin _Slavenka Drakulic_, die seit Beginn der 1990er Jahre die jugoslawische Bürgerkriegstragödie in mehreren Romanen und Reportagebänden analyisiert. Die Auszeichnung gilt vor allem ihrem jüngsten Werk: „Keiner war dabei – Kriegsverbrechen auf dem Balkan“. Als Beobachterin der Prozesse am Internationalen Tribunal in Den Haag zeichnet sie dort die Portraits der Täter nach. Der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung würdigt Autoren, die sich vor allem um die ost- und mitteleuropäische Annäherung verdient gemacht haben. Zu den Preisträgern gehörten bisher unter anderem Aleksandar Tisma, Peter Nadas, Imre Kertesz und Dzevard Karahasan. Auch andere Preise wurden auf der Messe vergeben, z. B. der seit 1977 vom |Börsenblatt| ausgeschriebene _Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik_, den diesmal _Hubert Spiegel_, der Leiter der „FAZ“-Literaturredaktion erhielt. Den _Kurt-Wolff-Preis_ erhielt der Bonner Verleger _Stefan Weidle_ vom Weidle-Verlag für sein engagiertes Programm mit Literatur der 20er und 30er Jahre als vorbildliches Beispiel für unabhängige Verlage in Deutschland. Und erstmals wurde in diesem Jahr der _Preis der Leipziger Buchmesse_ in den Kategorien Belletristik an _Terézia Mora_, Sachbuch/Essayistik an _Rüdiger Safranski_ und Übersetzungen an _Thomas Eichhorn_ verliehen. Auch zeigte sich die „kleinere Messe“ in diesem Jahr internationaler als je zuvor. Zunehmend gibt es Länder-Beiträge wie auch auf der Frankfurter Messe. Sogar Korea war angereist und gab einen Vorgeschmack auf die Frankfurter Messe, wo das Land dieses Jahr Gastland ist. Im Gegensatz zur Frankfurter Messe machen die kleineren und mittleren Verlage in Leipzig achtzig Prozent der Aussteller aus. Die Leipziger Buchmesse ist ansonsten mit der Aktion _“Leipzig liest“_ mit 1.200 Veranstaltungen und über tausend Mitwirkenden das größte europäische Literaturfest. Erfreulich war, dass die Bundeswehr dieses Jahr nicht mehr mit einem Werbestand auf der Buchmesse vertreten war. Unaufhaltsam wächst der Leipziger Branchentreff, bereits im 15. Nachwendemessenjahr, von Jahr zu Jahr.
Je näher der Termin der Messe anrückte, desto größer wurde innerhalb der Branche das Murren. Dass die Leipziger Messe zeitgleich mit der Lit.Cologne veranstaltet wird, stößt auf einheitliche Kritik, für dessen Ärgernis man die Kölner verantwortlich macht, denn Leipzig war nun einmal eher da. Man ist sehr gespannt, wie dieses Konkurrenzgebahren sich künftig entwickelt, denn die Kölner Messe hat nach dem Abgang der Popkomm kräftig in eine eigene Hörbuchmesse investiert. In der Öffentlichkeit ist Lit.Cologne auch nicht mehr wirklich beworben worden, sondern die meisten setzten dann doch wie gewohnt auf die Leipziger Messe. 120 Hörbuchverlage kamen nach Leipzig, im Jahre 2000 waren es gerade mal 40. Darunter waren alle renommierten Hörbuchverlage sowie alle ARD-Rundfunkanstalten, die sich als Hörbuchproduzenten nur in Leipzig vereint präsentieren. Wie auf der Frankfurter Messe gibt es nun das „Focus“-Hörbuch-Café mit attraktivem Fachprogramm. Bereits zum fünften Mal fand die zur Tradition gewordene „ARD-Radionacht der Hörbücher“ statt, die am Messefreitag live ausgestrahlt wurde. Als erfolgreichstes Hörbuch des Jahres wurde _“Die Päpstin“_ (DAV) mit dem _“HörKules“_ ausgestattet. Damit ist die Leipziger Messe der wichtigste Treffpunkt für die Hörbuchbranche geblieben.
Dennoch war die _5. Lit.Cologne_ mit rund 50.000 Besuchern ebenfalls überaus erfolgreich, was zu Änderungen führt. Der Termin für 2006 ist der 10. bis 18.März und die Messe wird damit von fünf auf neun Tage ausgedehnt und erstreckt sich über zwei Wochenenden. Da das Kinderprogramm auf der Messe auf großes Interesse stieß, wird es 2006 – neben der dann zweiten Kölner Hörbuchmesse – auch eine eigene Kinderbuchmesse geben. Der Streit um die Hörbücher wurde beigelegt, denn die Hörbuchmesse Audio Books Cologne wird nur vom 10. – 13. März 2006 gehen und die Leipziger Buchmesse ist dann erst die Woche darauf vom 16. – 19. März. Das überschneidet sich natürlich dennoch wieder mit der sonstigen Lit.Cologne. Zwar ist Köln eine Autorenmesse und Leipzig eine Buchmesse, dennoch erwartet Leipzig weiterhin, dass Köln den 2001 angezettelten widersinnigen Wettbewerb auf eine Weise löst, die in künftigen Jahren zu keinen Terminüberschneidungen mehr führt.
Das diesjährige Gastland auf der _Frankfurter Buchmesse_ könnte ein Flop werden. Politisch war die Auswahl des Gastlandes Korea – da Süd- und Nordkorea zusammen auftreten – ein genialer Coup, aber nun hat Südkorea sein kulturelles Rahmenprogramm radikal gestrichen. Als Grund wird angegeben, dass die einheimische Wirtschaft das Projekt im Stich gelassen habe und so wurden die geplanten Kultur- und Diskussionsveranstaltungen auf ein Minimum reduziert. Da verspricht man sich schon jetzt um so mehr vom Gastland 2006, welches Indien sein wird, denn dort entwickelt sich das Verlagswesen überaus rasant. Und 2007 folgt dann Katalonien als Ehrengast der Messe. Interessant dabei ist, dass sich damit nur eine Region präsentiert und nicht das gesamte Land Spanien. Erstmals schaut dann die Messe auf einen eigenständigen historischen Kulturraum und experimentiert mit einer neuen Herangehensweise an das Konzept des Gastlandes. In jedem Jahr nehmen die deutschen Verlage das Gastland zum Anlass, um Schwerpunkte in ihrem Programmen zu setzen.
Im _Börsenverein des deutschen Buchhandels_, dessen umfangreiche Reform in den letzten Jahren zu einem großen Wirtschaftsbetrieb geführt hatte, wird heftig um die Verbandsdemokratie diskutiert. Hauptthematik ist die bessere Kommunikation zu den Mitgliedern, denn „diese wollen nicht beruhigt werden, sondern beruhigt sein“ (Matthias Ulmer, Sprecher Arbeitsgruppe Verbandsreform). Bisherige Strategie war es immer gewesen, Probleme nicht an die große Glocke zu hängen. Dies erweist sich nun als ganz schlecht für die Bindung an die Mitglieder. Zum Beispiel durften auf den Hauptversammlungen bislang die Mitglieder dem Bericht des Vorstands lauschen, doch eigentlich sollte ein Vorstand doch auch hören, was die Mitglieder ihm zu sagen haben. Die einzelnen Sparten im gemeinsamen Verband driften immer mehr auseinander. Überhaupt verliert der Verband kontinuierlich pro Jahr etwa 200 Mitglieder. Vor kurzem ist auch Amazon aus dem Verband ausgetreten, was als Zeichen gewertet wird, dass die Großen den Börsenverein nicht mehr brauchen. Für die politische Lobbyarbeit ist es aber weiterhin wichtig, dass der Verband die gesamte Branche repräsentiert. Bertelsmann z. B. kann froh sein, dass der Börsenverein dem Club eine Plattform geboten hat, um das Potsdamer Abkommen neu zu verhandeln. Sehr problematisch ist auch, dass der Ruf nach einem eigenen Verlegerverband lauter wird. Die Differenzen in den Streitigkeiten – wie z. B. Konditionen mit dem Sortiment – scheinen zu groß zu werden. Der Börsenverein will nun, um als spartenübergreifender Verband bestehen zu bleiben, mehr das selbstständige Eigenleben der Sparten innerhalb des Verbands fördern. Für den Austausch unter den Sparten gab es bislang die Abgeordnetenversammlung, die aber in der Praxis nicht funktionierte. Auf den Treffen wurde genau das erzählt, was auch am Tag zuvor in den Fachausschüssen gesagt wurde. Die Mitglieder assoziieren mit der Abgeordnetenversammlung einen „Frankfurter Klüngel“ und wollen, dass Entscheidungen auf der Hauptversammlung getroffen werden, bei der jedes zahlende Mitglied Sitz und Stimme hat. Die Vision der künftigen Hauptversammlung ist ein wirklich lebendiger Verleger- und Buchhändlerkongress mit einem vielfältigen Rahmenprogramm und intensiver Diskussion über den Verein. Inzwischen fühlen sich selbst Vorstandsmitglieder desinformiert. Jetzt soll der Vorstand erweitert und mit neuen Strukturen die Verbandsarbeit wirklich revolutioniert werden. Auch die Vertreter der Landesverbände werden in den Vorstand mit aufgenommen. Um den Streitereien ein Ende zu bereiten, müssen alle an einem Strang ziehen können. Die Entfremdung der Mitglieder von den Landesverbänden ist allerdings seit Jahren schon nicht mehr übersehbar. Es besteht die Pflicht einer Doppelmitgliedschaft im Bundesverband wie im Landesverband, was die Mitglieder schon lange nicht mehr einsehen. Aufgrund solcher nun eskalierender Politik der letzten Jahre zum Wirtschaftsverband war das kulturpolitische Profil auf der Strecke geblieben. Das Ansehen als Kulturverband soll gestärkt werden mit den bewährten Projekten wie dem Friedenspreis oder dem Vorlesewettbewerb. Aber auch durch neue Projekte wie den Deutschen Buchpreis und „Ohr liest mit“.
|Das Börsenblatt, das die hauptsächliche Quelle für diese Essayreihe darstellt, ist selbstverständlich auch im Internet zu finden, mit ausgewählten Artikeln der Printausgabe, täglicher Presseschau, TV-Tipps und vielem mehr: http://www.boersenblatt.net/.|