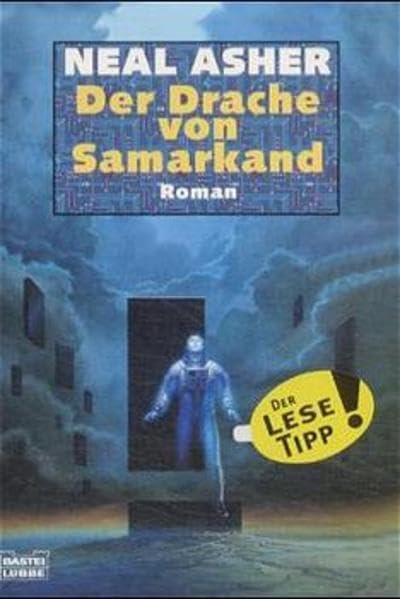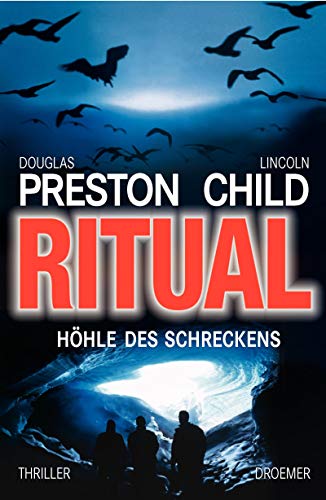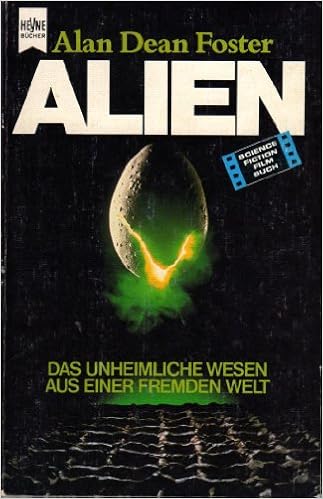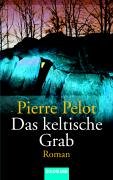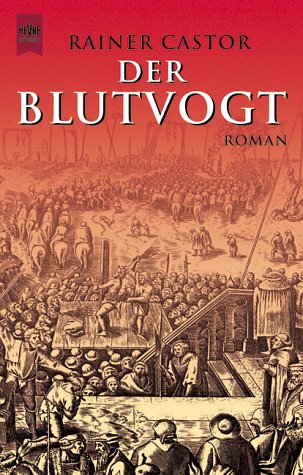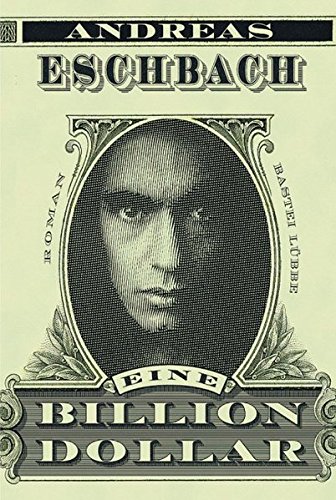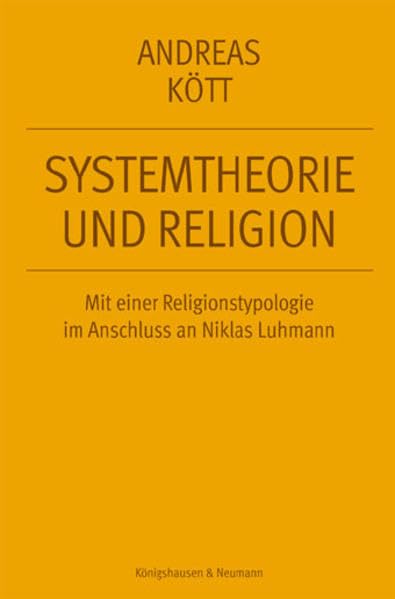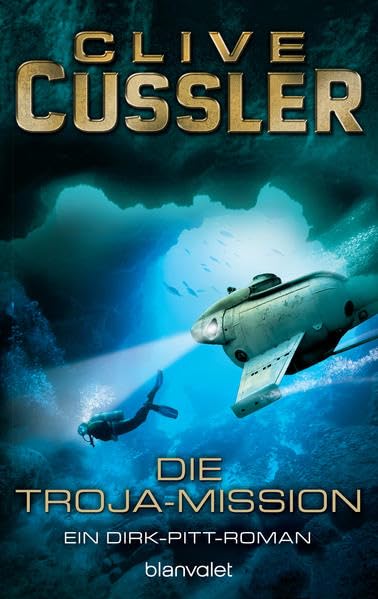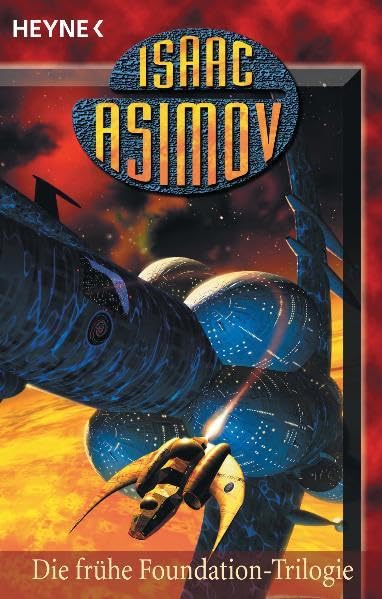|Vor ein paar Monaten überraschte mich der Berliner Autor Markolf Hoffmann mit seinem Debüt-Roman [„Nebelriss“. 473 Anlässlich der Veröffentlichung seines zweiten Romans „Flammenbucht“ am 28.10.2004 habe ich mich letztes Wochenende nach Berlin aufgemacht, um den jungen Mann einmal persönlich kennen zu lernen.|
_Sven Ollermann:_
Moin Markolf, schön, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Stell dich unseren Lesern doch bitte einmal vor.
_Markolf Hoffmann:_
Ich bin der Autor von „Nebelriss“ und dem Nachfolger „Flammenbucht“. Ich studiere in Berlin Geschichte und Literaturwissenschaften und habe vor einigen Jahren damit begonnen, ernsthaft an meiner Schriftstellerkarriere zu arbeiten. Damals habe ich angefangen, „Nebelriss“ zu schreiben. Auch in Zukunft möchte ich weiter als Schriftsteller arbeiten.
_Sven Ollermann:_
Du hast ja schon in deiner Schulzeit geschrieben und auch Preise bei Literaturwettbewerben gewonnen, unter anderem den ersten Preis beim Literaturwettbewerb des FDA Baden-Württemberg mit der Geschichte „Haktars Schweigen“. Wie bist du damals zum Schreiben gekommen?
_Markolf Hoffmann:_
Ich habe schon als Kind angefangen zu schreiben und meiner Mutter, die mich sehr gefördert und mir die Literatur nahe gebracht hat, erste Bildergeschichten diktiert. Das hat sich dann immer weiter entwickelt. Am Anfang habe ich für mich geschrieben; Kurzgeschichten oder Gedichte, die ich zu Weihnachten an Verwandte geschickt habe. Mit 16 oder 17 habe ich dann ernsthaft darüber nachgedacht, Autor zu werden und das Schreiben professionell zu betreiben. Später habe an einigen Literaturwettbewerben teilgenommen, wo ich dann meine ersten Erfolge mit Kurzgeschichten hatte. Damit war klar, in welche Richtung mein Weg führt.
_Sven Ollermann:_
Wie stehst du zu der literarischen Bildung in der Schule; sollte der Schwerpunkt weiterhin bei den Klassikern liegen – Kafka, Goethe, etc. – oder sollten die Lehrer dazu übergehen, auch neuere Literatur in der Schule zu lesen? Zum Beispiel auch den „Nebelriss“?
_Markolf Hoffmann:_
Es wäre natürlich schön, wenn „Nebelriss“ in den nächsten Jahren in den Oberstufenseminaren gelesen würde. Ich glaube schon, dass Klassiker sehr wichtig sind und für die deutsche Sprache, die Literatur und Kultur einen wichtigen Beitrag leisten; die Frage ist nur, ob die Beschäftigung mit einigen Werken in der Schule nicht vielleicht zu früh erfolgt. Ich bin sehr dafür, auch zeitgenössische Literatur stärker ins Auge zu fassen, gerade um junge Leute an Literatur heranzuführen. Für einige Klassiker muss man als Leser vielleicht noch etwas reifen. Ich kann heute mit Goethe sehr viel mehr anfangen als zu Schulzeiten.
_Sven Ollermann:_
Wie war das bei euch, habt ihr auch zeitgenössische Literatur gelesen oder wie üblich nur die Klassiker?
_Markolf Hoffmann:_
Bei uns wurden eigentlich fast nur Klassiker gelesen. Die einzige Ausnahme, an die ich mich erinnere, war „Schlafes Bruder“, was in meinen Augen allerdings kein sonderlich interessantes Buch ist. Die Lehrer haben einfach zu wenig Ahnung von zeitgenössischer Literatur. Es gibt verschiedene Genres, die man beachten könnte, man sollte da in meinen Augen noch viel tun.
_Sven Ollermann:_
Stichwort Lehrerausbildung. Die Literaturwissenschaften gehören ja neben Germanistik auch zu den Studienfächern eines Deutschlehrers; wie sieht das an der Uni aus, geht es da überwiegend um die ältere Literatur oder werden auch Seminare zur neueren Literatur angeboten?
_Markolf Hoffmann:_
Es gibt Seminare zur neueren Literatur, die werden aber eher stiefmütterlich behandelt. Nur wenige Professoren setzen sich damit auseinander, auch von den Studenten kommt eindeutig zu wenig, obwohl Interesse durchaus vorhanden ist. Es setzt sich also fort: An der Universität wird zu wenig zeitgenössische Literatur behandelt, dementsprechend lernen die angehenden Lehrer zu wenig darüber, und das landet dann letztendlich bei den Schülern.
_Sven Ollermann:_
Du experimentierst sehr gerne mit der deutschen Sprache, das sieht man auch an deinem Roman „Nebelriss“, der literarisch durchaus anspruchsvoll ist. Gibt es irgendeinen Schriftsteller, der dich inspiriert hat, oder wie kommt es dazu, dass du die deutsche Sprache so wichtig nimmst?
_Markolf Hoffmann:_
Ich kann nicht sagen, dass mich ein einzelner Autor besonders beeinflusst hat. Ich selbst lege sehr viel Wert auf Sprache und Stil, wenn ich Literatur lese. Das versuche ich dann auch in meinen Romanen umzusetzen, wobei ich in Zukunft gerne noch mehr experimentieren würde. An sich bin ich ein großer Freund experimenteller Literatur – ob die Werke von Burroughs oder James Joyce oder die Romane des ostdeutschen Autors Reinhard Jirgl. Das sind alles Leute, die mir Mut geben, mich weiter an der Sprache zu versuchen und zu experimentieren. Ich denke, da bin ich auch erst am Anfang. Ich kann in dieser Hinsicht noch sehr viel lernen und an die Leser weitergeben.
_Sven Ollermann:_
Dann können wir ja auf deine nächsten Werke gespannt sein. Welches Buch liest du gerade?
_Markolf Hoffmann:_
Zur Zeit lese ich Umberto Ecos „Baudolino“. Ich habe noch nicht viel von Eco gelesen, aber dieser Roman beeindruckt mich sehr und ist wirklich spannend.
_Sven Ollermann:_
Du liest also durchaus auch historische Romane?
_Markolf Hoffmann:_
Ich muss sagen, ich lese bunt gemischt, nicht nur Fantasy, sondern vor allem zeitgenössische Bücher oder Klassiker. Neulich habe ich z. B. voller Begeisterung Flaubert verschlungen. Eigentlich gibt es immer irgendwas, das mich gerade packt, und dann lese ich ziemlich viel von dem betreffenden Autor. Jetzt habe ich sozusagen meine Eco-Phase.
_Sven Ollermann:_
Kommen wir zu deinem neuen Roman. Kannst du ein bisschen was über „Flammenbucht“ erzählen?
_Markolf Hoffmann:_
„Flammenbucht“ ist die Fortsetzung von „Nebelriss“, ich versuche die Geschichte weiterzuspinnen und ihr auch ganz neue Richtungen zu geben. Hm, lass mich mal kurz nachdenken; gar nicht so einfach, wie fasst man einen so komplexen Roman schnell zusammen?
_Sven Ollermann:_
Okay, Baniter wird ja Arphat wieder verlassen und zurück nach Sithar reisen; wie stehen die Chancen für das Bündnis? Seine Rückkehr wird das Gespann sicherlich überraschen, was hat er zu erwarten?
_Markolf Hoffmann:_
Die Ereignisse überschlagen sich. Als Baniter zurückkommt, erwartet ihn ein Haufen neuer Probleme. Er stellt zum Beispiel fest, dass der Kaiser verschwunden ist und sich die Situation im silbernen Kreis weiter zugespitzt hat. Mit Baniters Rückkehr wird in Thax nicht wirklich gerechnet. Gleichzeitig gerät die Lage im Kaiserreich Sithar außer Kontrolle. Der neue Hohepriester Nhordukael sorgt für Überraschungen, als er die Hauptstadt einnimmt und dem Erdboden gleichmacht. Letzten Endes muss sich Baniter zu einem Waffenstillstand mit seinen einstigen Konkurrenten durchringen, und dieses fragile Bündnis wird für einige Spannung sorgen.
Ein weiterer Handlungsstrang, der in eine ganz andere Richtung geht, behandelt die Reise des düsteren Zauberers Rumos in das Silbermeer. Hier werde ich zwei neue, etwas hellere Charaktere einführen, nämlich einen troublinischen Großmerkanten und seinen Leibdiener, die Rumos auf seinem Weg begleiten. Die Geschichte verlagert sich hierbei ins Silbermeer, und somit rücken ganz neue Gegenden des Welt Gharax in den Mittelpunkt.
_Sven Ollermann:_
Eine Sache interessiert mich brennend: Warum musste in deinem Roman ein Plätzchen für Magie eingeräumt werden? Fantasy und Magie sind zwei Elemente, die man gemeinhin gerne zusammenfasst. Schaut man sich aber zum Beispiel die „Gezeitenwelt“ an, so findet man diese fantastische Form von Magie einfach nicht. Hast du dich privat mal mit dem Thema beschäftigt oder ist die Magie eher ein Standard-Klischee?
_Markolf Hoffmann:_
Ich habe am Anfang lange darüber nachgedacht, welche Rolle Magie in dieser Trilogie spielen soll. Ich selbst habe mich während des Studiums aus Interesse mit antiker, vor allem spätantiker und ägyptischer Magie beschäftigt. Mich interessiert dabei vor allem die Schnittstelle zwischen Religion und Magie, dass z. B. die Auseinandersetzung mit Magie in der Antike letzten Endes ein Umgang mit den Göttern war und eine stärkere religiöse Konnotation hatte, als dies heute wahrgenommen wird. Mit diesem Thema wollte ich mich auseinandersetzen. Religion spielt deshalb eine große Rolle im „Nebelriss“ und zwar eine durchaus kritische. Mich interessierte die Frage: Wie erlangen Menschen mit Hilfe von Religion und Magie Macht über andere Menschen? Und wie gehen diese damit um?
_Sven Ollermann:_
Wo wir gerade ins Magische abdriften: Bist du mehr Träumer oder doch eher Realist?
_Markolf Hoffmann:_
Ich denke, ich bin vielleicht eher Realist, wobei ich sehr gerne träume. Um diesen Widerspruch ein wenig aufzuschlüsseln, kann man sagen, dass ich versuche, den Träumen auf den Grund zu gehen und mit ihnen zu arbeiten. Also bin ich vielleicht beides.
_Sven Ollermann:_
Die Welt Gharax mit ihrem durchaus komplexen politischen, religiösen und magischen Gefüge und mit der ‚parallelen Dimension‘ der Goldéi – wie bist du darauf gekommen? Haben dich da politische oder gesellschaftliche Zusammenhänge in unserer Welt inspiriert oder Bücher anderer Autoren?
_Markolf Hoffmann:_
Die politischen Auseinandersetzungen in der Welt Gharax haben mich sehr interessiert, und ich habe sie bewusst forciert, weshalb die Politik eine große Rolle spielt. ‚Das Zeitalter der Wandlung‘ beschäftigt sich ja mit dem Niedergang, dem Verfall einer Welt und ihrer Strukturen. Diese Umwälzung fordert die Menschen heraus. Wie gehen sie politisch damit um? Da gibt es Menschen, die diese Veränderungen bekämpfen, es gibt andere, die sie willenlos mitgehen und mitgestalten, und wieder andere versuchen sich ihnen anzupassen. Diese drei Wege zeige ich beispielhaft an den drei Hauptcharakteren Nhordukael, Laghanos und Baniter. Ein weiterer wichtiger Punkt ist: Wie beeinflusst Macht die Menschen, wie deformiert sie die Menschen oder stärkt sie? Und ich habe natürlich auch einige politische Anspielungen in „Nebelriss“ versteckt, zum Beispiel im Rochenland-Konflikt die Auseinandersetzung mit dem Separatismus, der ja ein gewaltiges Problem unserer Zeit ist. Ich finde es reizvoll, Entwicklungen unserer Zeit in der Phantastik zu spiegeln. Dieses Genre eignet sich perfekt dazu.
_Sven Ollermann:_
Die Welt ist vielschichtig und sehr bildhaft. Ich habe häufig das Gefühl gehabt, dass wirklich ein Film vor meinem inneren Auge abläuft. Meinst du, dass deine Arbeit als Regisseur und Drehbuchautor dir dabei geholfen hat, diese Verbildlichung der Welt zu Wege zu bringen?
_Markolf Hoffmann:_
Ja, definitiv, vor allem in sprachlicher Hinsicht. An vielen Stellen und vor allem bei Beschreibungen stelle ich mir die Szene als Bild oder als Filmszene vor und setze sie dann sprachlich um. Auch bei schnelleren Szenen, zum Beispiel Actionszenen, überlege ich mir die ‚Schnitte‘ schon vorher und fertige ein Mini-Drehbuch im Kopf an, nach dem ich schreibe. Es hilft sehr, die Ideen während des Schreibens zu verbildlichen. Meine Erfahrungen als Drehbuchautor und Regisseur von Kurzfilmen sind, denke ich, ein guter Schlüssel zur Literatur.
_Sven Ollermann:_
Die Charaktere haben durchaus phantastische Namen, Nhordukael, Laghanos, Baniter – wie hast du sie entwickelt? Hast du eine eigene Etymologie für die Welt Gharax entworfen, auf andere Sprachen zurückgegriffen oder sind sie einfach deiner Phantasie entsprungen?
_Markolf Hoffmann:_
Es sind Eigenkreationen. Etymologie wäre etwas zu hoch gegriffen. Ich habe allerdings versucht, die meisten Namen historisch einzubetten, damit sie sich aus der Geschichte des Landes herleiten lassen. Ich fand es jedoch nicht so wichtig, mir eine komplette Etymologie zu überlegen. Die Namen sollten vor allem phantastisch genug klingen, um sie von unserer Welt abzugrenzen.
_Sven Ollermann:_
Stichwort Geschichte der Welt Gharax. Deine Homepage bietet ja eine Menge an Hintergrundinformationen, worüber deine Leser, welche sich damit beschäftigen wollen, sicherlich sehr dankbar sind. Die Homepage bietet aber noch mehr: je eine mehrteilige Vorgeschichte zu deinen beiden Romanen „Nebelriss“ und „Flammenbucht“. Ist das jetzt eher eine Marketing-Strategie oder ein Geschenk an potenzielle Leser und Fans vom „Nebelriss“?
_Markolf Hoffmann:_
Es ist beides. Ich möchte natürlich Leser werben, möchte sie anlocken und ihnen die Chance geben, sich auf das Buch vorzubereiten. Auf der anderen Seite ist es auch ein Geschenk für interessierte Leser, damit sich diese mit der Geschichte von Gharax auseinandersetzen und in die Welt einarbeiten können. Und da ich selbst sehr viel Spaß daran habe, mich mit dieser Welt zu beschäftigen, habe ich auch zum zweiten Teil eine Vorgeschichte entworfen. Diese orientiert sich an Leserwünschen, denn viele Fans von „Nebelriss“ fanden vor allem die Episoden im Königreich Arphat sehr interessant. Deswegen habe ich bewusst die Vorgeschichte zu „Flammenbucht“ in Arphat angesiedelt, um die Hintergründe dieses Reiches näher zu beleuchten. Diese Hintergründe sind für den Roman „Flammenbucht“ nicht wirklich bedeutsam, sie sind vielmehr als Vertiefung gedacht. Es ist außerdem eine schöne Vorbereitung auf „Flammenbucht“. Der Prolog wird nämlich ebenfalls in Arphat spielen, weil dieses Land den Feldzug gegen die Goldéi beginnt.
_Sven Ollermann:_
Hast du die Geschichten parallel zu den Romanen geschrieben oder nachträglich?
_Markolf Hoffmann:_
Nachträglich. Ich habe sie zeitgleich zur Erstellung der Homepage geschrieben. Es ist ein sehr angenehme Abwechslung, weil ich eine solche Vorgeschichte natürlich anders schreibe als einen Roman. Ich arbeite nicht mit parallelen Strängen, und sie ist besteht aus kürzeren Abschnitten.
_Sven Ollermann:_
Dann sei noch erwähnt, dass zweimal pro Woche ein neuer Teil der Vorgeschichte auf der Homepage veröffentlicht wird. Sind es wieder zehn Kapitel?
_Markolf Hoffmann:_
Es werden sieben Kapitel sein.
_Sven Ollermann:_
Reden wir mal über das Cover, da hat sich ja jetzt einiges verändert, wegen des Verlagswechsels. Das alte Cover wirkte düster und bedrohlicher, ich fand, es passte sehr gut zum Roman. Das neue Cover von |Piper| wirkt friedlicher, fast ein wenig klischeehaft. Wie stehst du dazu?
_Markolf Hoffmann:_
Ich kann dazu nur sagen, dass man als Autor leider kein Mitspracherecht hat. Ich habe zwar Vorschläge gemacht, aber der Verlag hat sich für andere Cover entschieden. Ich persönlich hätte mir sowohl bei |Heyne| wie auch bei |Piper| etwas Abstrakteres gewünscht. Ich finde zwar, dass die neuen Cover sehr schön anzusehen sind, aber sie sind ein wenig bieder und spiegeln die Atmosphäre nicht unbedingt wieder. Auf der anderen Seite sind sie recht atmosphärisch, was mir ganz gut gefällt. Dennoch hat mir das Cover von |Heyne| besser gefallen. Ich würde mir wünschen, dass der Verlag noch mehr auf die Autoren hört, weil diese schließlich am besten wissen, welche Gestaltung die Atmosphäre eines Buches wiedergibt.
_Sven Ollermann:_
Eine Sache, die mir bei den Rezensionen auffiel und mir selber auch sehr schwer gefallen ist – die Festung, die auf den Büchern abgebildet ist, liegt die im Rochenland oder sind es die Augen von Talanur?
_Markolf Hoffmann:_
Ich bin genauso am Rätselraten wie du. Ich würde zu gerne wissen, welche Festung im Buch das Bild darstellen soll. Nun ja, ich denke, man muss ein solches Cover assoziativ verstehen.
_Sven Ollermann:_
Du warst mit „Nebelriss“ auf Lesereise. Ist das mit „Flammenbucht“ auch wieder geplant?
_Markolf Hoffmann:_
Ich werde Lesungen machen. Nicht mehr so stark wie bei „Nebelriss“, weil die Resonanz nicht so groß war, wie ich mir das gewünscht habe, aber es wird Lesungen in Berlin, München und Hamburg geben. Ich würde mich auch freuen, wenn sich noch weitere Termine ergeben. Ich bin einfach mal gespannt, ob Leute oder Institutionen an mich herantreten, damit ich meinen Roman vorstellen kann, weil ich mir auch bei der Ausarbeitung des Lesekonzepts sehr viel Mühe gegeben habe. Ich begleite meine Lesungen ja mit Musik. Ein Freund von mir, der Tonkünstler Michael Carmone, hat ein paar Tonspuren für die Lesungen geschrieben. Ich selbst gebe zudem einige atmosphärische Klavierkompositionen zum Besten. Dieses Konzept geht eigentlich über eine Lesung hinaus. Ich sehe es mehr als Konzert mit literarischen Elementen.
_Sven Ollermann:_
Ein Konzert mit literarischen Elementen – da fällt mir ein, dass heute ja Hörbücher groß im Kommen sind. Könntest du dir vorstellen, dass du „Das Zeitalter der Wandlung“ für eine Hörbuchserie freigibst?
_Markolf Hoffmann:_
Das könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen. Falls ein Hörbuchverlag Interesse hätte, soll er sich ruhig bei mir melden. Ich hätte auch große Lust, daran mitzuarbeiten oder vielleicht Regie zu führen. Das ist auch der Grund, weswegen ich mir die Rechte zurückbehalten habe, und falls das Interesse der Leser an einem Hörbuch da ist, werde ich es umsetzen.
_Sven Ollermann:_
Du hast ja – oder besser, du wurdest von Heyne zu Piper gewechselt, weil Heyne die Fantasy-Reihe abtreten musste. Du hast mal in einem Interview gesagt, das Lektorat bei Heyne hätte dir sehr viele Freiheiten gelassen, auch im Bezug auf die sprachlichen Experimente. Wie lief das mit dem Lektorat bei Piper?
_Markolf Hoffmann:_
Ich habe das große Glück, dass die Lektorin, die mich bei Heyne betreut hat, freischaffend arbeitet und ich deswegen mit ihr weiterarbeiten konnte. Daher wird sich auch an den Sprachexperimenten nichts ändern. Es wird im selben Stil weitergehen.
_Sven Ollermann:_
Piper veröffentlicht nicht so viele Bücher wie Heyne – eben auch im Fantasy-Bereich, bislang zumindest. Wie sieht das mit der Vermarktung deines Buches aus? Bist du zufrieden damit? Weißt du überhaupt schon, wie die PR läuft?
_Markolf Hoffmann:_
Das ist natürlich alles erst in der Schwebe. Ich hoffe mal, dass sich Piper besser als Heyne darum kümmert. Ich werde natürlich auch mein Scherflein dazu beitragen, zum Beispiel die Internetwerbung mache ich komplett alleine. Die Homepage habe ich selbst entworfen. Ich würde mir wünschen, dass der Verlag noch etwas mehr tut, zum Beispiel Zeitungsartikel schaltet. Wir werden sehen. Ich hoffe einfach mal, dass sich auch das Erscheinen von „Flammenbucht“ herumspricht.
_Sven Ollermann:_
Wie läuft es mit dem Endspurt deines Studiums? Du hast mir erzählt, dass du scheinfrei bist. Gedenkst du deine Magisterarbeit noch in diesem Jahr fertigzustellen?
_Markolf Hoffmann:_
Ja, die hat sich jetzt natürlich durch die Abgabe des zweiten Buches verschoben. Das nächste Projekt wird für mich der Abschluss meines Studiums sein, also zunächst eine Magisterarbeit zu verfassen.
_Sven Ollermann:_
Haben deine Dozenten mitbekommen, dass du ein Buch veröffentlicht hast? Wenn ja, wie sind sie darauf eingegangen?
_Markolf Hoffmann:_
Ich hab das nicht herumposaunt. Eigentlich möchte ich Studium und Schriftstellerei bewusst voneinander trennen.
_Sven Ollermann:_
Studium, Kurzfilme, Autor zweier Bücher – wie hast du das bewältigt? Hast du einen straffen Tagesplan oder eher eine freie Zeiteinteilung?
_Markolf Hoffmann:_
Ich bin eher Etappenarbeiter. Vor einem Jahr habe ich mich etwa mit meinem letzten Filmprojekt beschäftigt, eine Horror-Groteske, die auch noch nicht ganz abgeschlossen ist (der Film muss noch geschnitten werden). Dann war natürlich der Roman dran, an dem ich sehr viel gearbeitet habe. Dann gab es wieder Monate, in denen ich mich ausschließlich in mein Studium vertieft habe. Ich versuche, alle Energie auf ein Projekt, das zur Zeit wichtig ist, zu bündeln. Ich liebe die Abwechslung. Ich beschäftige mich auch sehr gerne mit Geisteswissenschaften, also mit der Rezeption von Texten und Theorien. Dann ist natürlich Musik ein großes Interessengebiet von mir, sowohl als Konsument als auch als Komponist.
_Sven Ollermann:_
Wie sieht es mit anderen Hobbys aus, neben deinen kreativen Tätigkeiten? Computer zocken, Kino, Kultur – bleibt dir dafür Zeit?
_Markolf Hoffmann:_
Ich nehme mir einfach die Zeit. Ich habe einen großen Freundeskreis, mit dem ich gerne etwas unternehme. So gehe ich gerne ins Kino und ins Theater. Dass mich das Theater geprägt hat, kann man vielleicht auch an der Dialoglastigkeit meiner Romane erkennen. Computer spiele ich gelegentlich ganz gerne. Früher habe ich auch mal eine Rollenspielphase gehabt, die leider aus Zeitgründen abgeschlossen ist. Außerdem gehe ich gerne schwimmen, und das Nachtleben Berlins bietet ebenfalls diverse Möglichkeiten.
_Sven Ollermann:_
Du hast mal gesagt, dass du nicht so gerne Fantasy liest. Begründet hast du es mit den vielen Klischees und der flachen, oft geglätteten Sprache, sowohl bei Übersetzungen als auch bei deutschen Romanen. Wirst du weiterhin in der Phantastik bleiben oder wechselst du vielleicht das Genre?
_Markolf Hoffmann:_
Ich würde gerne auch in anderen Genres arbeiten, obwohl mich Fantasy sehr interessiert. Ich habe auch schon ein weiteres Manuskript, einen zeitgenössischen Roman, den ich gerade bei einem Verlag unterzubringen versuche. Doch auch im Bereich Fantasy möchte ich weiterarbeiten. In diesem Genre kann man noch sehr viel Neues ausprobieren. Interessanterweise hat die zeitgenössische Literatur sehr viele phantastische Elemente aufgenommen, es gibt sehr viele zeitgenössische Romane mit Horror-Elementen, mit Fantasy- oder Science-Fiction-Elementen, während die Fantasy sehr wenige zeitgenössische Themen aufnimmt. Es würde mich deshalb reizen, in die Fantasy einige Elemente der E-Literatur ‚hineinzuzerren‘ und somit die Mauer von der anderen Seite her aufzubrechen. Von Seiten der E-Literatur ist das schon geschehen, von Seiten der Fantasy eben noch nicht, und ich denke, da stehe ich noch ganz am Anfang. Ich kenne auch einige andere Autoren, die sich an dieser Grenze versuchen.
_Sven Ollermann:_
Könntest du dir vorstellen, „Das Zeitalter der Wandlung“ noch mal aufzugreifen, oder wird es mit der Trilogie abgeschlossen sein? Es geht ja um den Untergang und den Strukturwandel einer Welt, das könnte man natürlich weiterspinnen und später über den Aufbau einer neuen Welt schreiben. Bist du daran interessiert?
_Markolf Hoffmann:_
Eigentlich ist es mein festes Ziel, nach der Trilogie diese Welt beiseite zu legen. Es kann natürlich sein, dass mich in zehn Jahren Gharax noch einmal zu sich ruft, aber eigentlich denke ich, dass die Geschichte abgeschlossen ist – auch mit ihren offenen Enden. Ich erzähle ja nur einen Abschnitt dieser Welt; der Rest sollte besser unerzählt bleiben und offen sein für Interpretationen, für Träume und Visionen. Ich denke, es wäre schade, Gharax totzuschreiben. Auf mich warten andere Themen, andere Welten.
_Sven Ollermann:_
Beispiel Lovecraft. Er hat eine Welt erschaffen und schon zu Lebzeiten, aber überwiegend nach seinem Tod, haben sich viele Autoren darangesetzt und den Mythos weitergeschrieben. Wie stehst du dazu, wenn sich irgendwann ein junger aufstrebender Autor daransetzt und sagt: Ich habe da ein paar tolle Ideen; ich schreibe einen Roman, der in der Welt Gharax spielt. Wäre das okay für dich?
_Markolf Hoffmann:_
Es ist nicht uninteressant, wenn sich Autoren an vorhandenen Konzepten orientieren und etwas Neues aus ihnen herauszuholen … allerdings nur dann, wenn sie es schaffen, sich von ihrem Vorbild zu lösen. Wenn es reines Epigonentum ist, bin ich eher dagegen. Es würde auf das Konzept ankommen, aber wenn wirklich jemand daran Interesse hat und das Ganze von einem neuen Blickwinkel her angeht, könnte das durchaus reizvoll sein.
_Sven Ollermann:_
Berlin – du studierst hier, geboren bist du in Braunschweig, dann hast du einige Jahre im Süden Deutschlands gelebt. War das damals schon ein Traum, nach Berlin zu gehen, oder war es hier nur einfacher, einen Studienplatz zu bekommen? Und wie verhält es sich heute, würdest du wieder woanders hinwollen?
_Markolf Hoffmann:_
Für mich war das schon ein Traum. Alleine schon, weil ich vom Gefühl her ein Großstadtmensch bin. Ich habe mich im Alter von sechzehn in die Stadt London verliebt. Dann war der erste Schritt, nach Berlin zu ziehen, denn ich wollte in Deutschland studieren. Berlin ist sehr faszinierend, ich würde auch jederzeit wieder hierherziehen, wenn ich noch mal anfangen würde. Was kulturelle Möglichkeiten betrifft, ist Berlin schon die Stadt, die am meisten in Deutschland zu bieten hat.
_Sven Ollermann:_
Du warst auf der Frankfurter Buchmesse. Mit deinem neuen Werk?
_Markolf Hoffmann:_
Es hatte es leider noch nicht aus der Druckerei geschafft, deswegen hatte ich es noch nicht in den Händen.
_Sven Ollermann:_
Gab es die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen – zu anderen Autoren, anderen Verlagen?
_Markolf Hoffmann:_
Ich hab vor allem die Leute des neuen Verlags kennen gelernt, die Piper-Besatzung. Das war sehr interessant. Ich hatte auch Gespräche mit anderen Autoren, aber vor allem ging es darum, den Kontakt zum Verlag zu vertiefen.
_Sven Ollermann:_
Wie feierst du Halloween? Als Rollenspieler, als jemand, der sich mit Magie beschäftigt hat, als Fantasy-Autor – bist du ein Mensch, der auf die großen Partys geht oder eher privat feiert?
_Markolf Hoffmann:_
Ich muss gestehen, dass ich keinen persönlichen Bezug zu Halloween habe, aber wenn sich eine Party anbietet, werde ich die sicherlich mitnehmen, denke ich mal.
_Sven Ollermann:_
Möchtest du unseren Lesern noch etwas sagen?
_Markolf Hoffmann:_
Vielleicht, dass mich der Austausch mit den Lesern sehr interessiert – Meinungen, Kritik und Anregungen sind immer willkommen. Ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere meine Homepage anschaut. Wer Fragen hat, kann mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ich finde, es macht ein Buch lebendiger, wenn man sich als Autor mit den Lesern austauschen kann. Und dies ist ja heute dank Internet sehr einfach geworden. Ich hoffe, dass sowohl die Leser als auch ich diese Chance nutzen.
_Sven Ollermann:_
Ich danke dir, Markolf, und freue mich riesig auf „Flammenbucht“ und den dritten Teil.
Also, liebe Leser, wer sich mit „Das Zeitalter der Wandlung“ näher beschäftigen oder sich mit dem Autor auseinandersetzen möchte: Auf http://www.nebelriss.de besteht die Möglichkeit dazu.