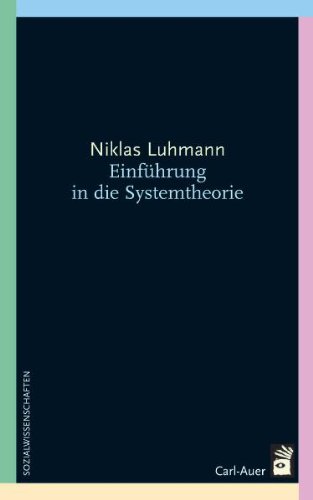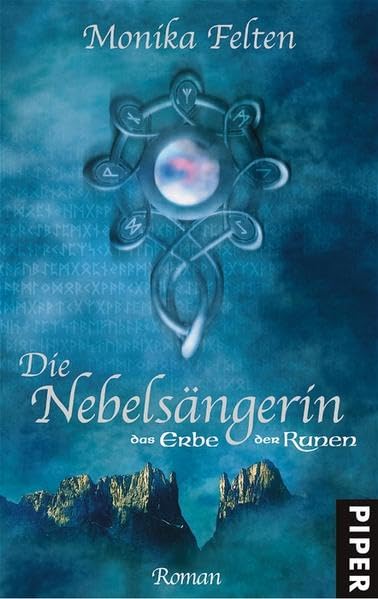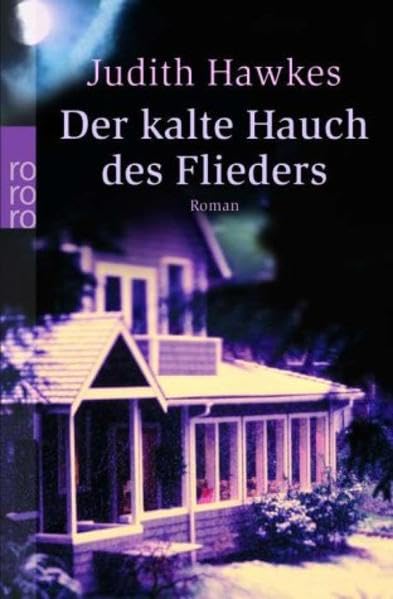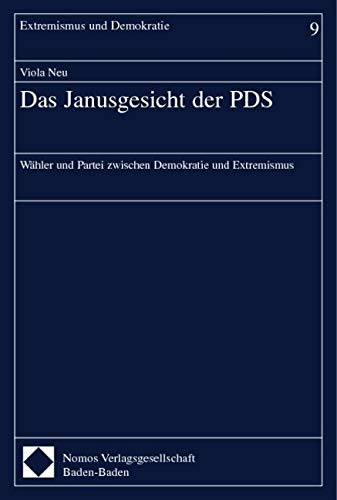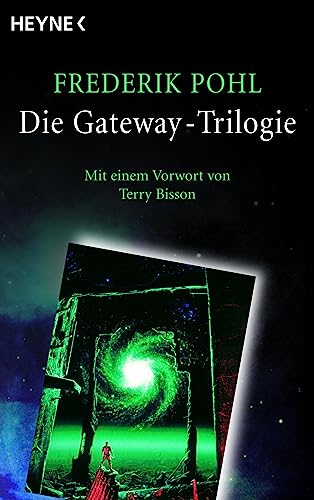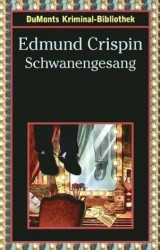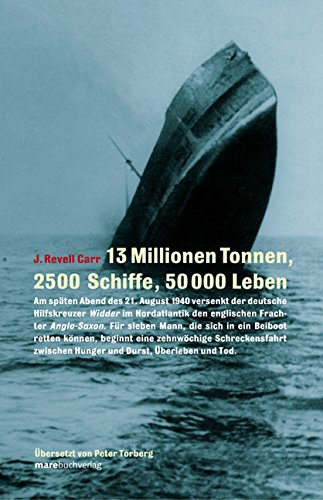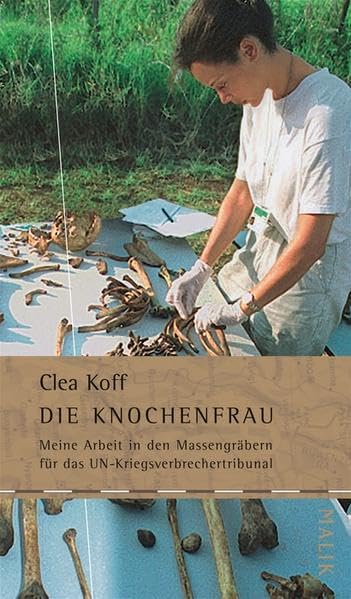Ratten haben ein schlechtes Image. Sie sind weder possierlich noch niedlich, sondern gelten als gerissen und hinterhältig. Sie leben zu Tausenden in den Großstädten und führen dennoch ein schattenhaftes Dasein. Ihr Äußeres wirkt abstoßend, und gerade ihr langer, nackter Schwanz sorgt beim menschlichen Betrachter für Ekelgefühl. Ihre Existenz, ihre schiere Zahl sorgt beim Menschen für instinktive Angst, nicht zuletzt, weil Ratten als Krankheitsüberträger gelten und im Mittelalter die Pest verbreiteten. Als kuscheliges Haustier ist die gemeine Ratte also kaum geeignet, doch als Protagonist in einem Horrorroman macht sie sich ausgesprochen gut. Gilt die Ratte doch als überaus intelligent – vielleicht intelligent genug, um es mit dem Menschen aufzunehmen?
Vier Romane hat der |area|-Verlag in „Tod durch Ratten“ vereint (wobei es sich nur bei zwei Texten tatsächlich um Romane handelt), um auf nicht weniger als 800 Seiten beim Leser unbehaglichen Grusel vor dem Nager auszulösen. Dabei können nicht alle Geschichten vollkommen überzeugen, auch wenn die Anthologie mit einem echten Knaller beginnt. Alexander Grins atmosphärische Novelle „Der Rattenfänger“ kommt zunächst einmal ganz ohne das unleidliche Getier aus. Ein verarmter Russe kommt, nachdem er seine Wohnung verloren hat, für kurze Zeit im verlassenen Gebäude der Zentralbank unter. Vollkommen allein in dem einsamen, labyrinthischen Geflecht von Räumen, bleiben die ersten Gruselschauer beim Protagonisten nicht lange aus. Zwar findet er durch Zufall einen Schrank, der prall gefüllt ist mit köstlichsten Lebensmitteln, doch aus ihm springt eine ganze Anzahl (naturgemäß gut genährter) Ratten. Bald vernimmt er Geräusche und undeutliches Gemurmel, wird von einer körperlosen Stimme durch die Räume gelockt und wirft schlussendlich einen Blick auf ein unheiliges Fest im Saal des Gebäudes. Grins Novelle ist der Höhepunkt von „Tod durch Ratten“. Sie gleich an den Anfang zu setzen, muss zwangsläufig dazu führen, dass die restlichen Geschichten abfallen und weit hinter der Meisterschaft des Russen zurückbleiben. Grins Darstellung der Zentralbank mit ihren endlosen Korridoren und Zimmern etabliert beim Leser einen subtilen Schauer und lässt ihn bar jeden sicheren Wissens nach der Lektüre zurück.
Weiter geht es mit Stephen Gilberts Roman „Aufstand der Ratten“, einer etwas behäbigen Geschichte über den Rachefeldzug (oder auch „Rattenfeldzug“) eines Verlierertypen, die auch unter dem Titel „Willard“ (USA, 1971 und Neuverfilmung des Stoffes 2003) verfilmt worden ist. Der Ich-Erzähler beginnt, Ratten zu zähmen und zu dressieren, natürlich, ohne jemandem davon zu erzählen, da er die Ratten ursprünglich als Ungeziefer vernichten sollte. Da ihm jegliches soziales Leben fehlt, werden die Ratten bald zu seinen einzigen Bezugspunkten. Er setzt seine Rattenarmee zunächst für einige Überfälle ein, um an Geld zu kommen. Doch dann werden seine Angriffe zunehmend persönlicher und er beginnt, die Ratten einzusetzen, um für ihm widerfahrene Ungerechtigkeiten tödliche Rache zu üben. Gilberts Ich-Erzähler ist naturgemäß kein sympathischer Typ. Eigenbrötlerisch, geheimniskrämerisch und hinterhältig, vergräbt er sich in seinem verunkrauteten Garten und plant seine Rache an der Gesellschaft. Zwar gelingt es Gilbert, die Ratte Ben als wirklich teuflisches und vernunftbegabtes Tier darzustellen, das im Geheimen seinen Ausbruch aus menschlicher Führerschaft plant, doch über weite Strecken tritt die Geschichte auf der Stelle und kann erst zum Ende hin etwas an Fahrt gewinnen. Auf jeden Fall bleibt „Aufstand der Ratten“ nach der Lektüre von Grins „Rattenfänger“ seltsam eindimensional.
Die dritte Geschichte, Harald Howarts „Tod durch Ratten“, variiert Gilberts Thema vom Menschen, der sich der intelligenten Ratte für die persönliche Rache bedient. Sein Protagonist Kreutzkamm ist ein kleines Licht an der Universität. Seit Jahren wird ihm (unberechtigerweise, wie er findet) der Professorentitel versagt. Doch nun ist ihm der Durchbruch gelungen, denn er kann mittels eines Apparates die Gehirnsströme von Ratten beeinflussen und sie so „fremdsteuern“. Sein Chef hält die Vorführung des Vorgangs für eine ausgefeilte Dressur und feuert Kreutzkamm kurzerhand, nachdem dessen cholerisches Temperament hervorgebrochen ist. Mit seinen Laborratten in der eigenen Wohnung festsitzend, plant dieser nun seine Rache an den Köpfen der Universität. Howarts Kreutzkamm ist fast schon zu böse, um noch glaubwürdig zu sein. Sein Charakter ist so auf Größenwahn und Egozentrismus ausgerichtet, dass für andere Eigenschaften kein Platz mehr bleibt. So bleibt der Autor auch Überraschungen in der Storyline schuldig. Kreutzkamms Rachefeldzug geht seinen geplanten Gang, bis der moralische Zeigefinger Howarts einschreitet, der den Schluss des Romans eher lustlos und überhastet zu Papier bringt. „Tod durch Ratten“ ist dynamischer als der Vorgänger „Aufstand der Ratten“, doch auch Howarts Roman kann nicht auf ganzem Wege überzeugen.
Die letzte Erzählung, Hans Joachim Alpers’ „Zwei schwarze Männer graben ein Haus für dich“, schreitet flotter voran. Der nach mysteriöser Krankheit im Rollstuhl sitzende Christoph lebt mit seiner Freundin Miriam zurückgezogen in einem kleinen Dorf. Eines Tages erhält er die Nachricht vom Tod seines alten Freundes Patrick, zusammen mit einem Packen Briefe, die ihm dieser kurz vor seinem Tod geschrieben, jedoch nie abgesendet hat. Die Staatsanwaltschaft vermutet, Patrick habe den Verstand verloren und so sein Ende herbeigeführt, denn in den Briefen wird Unglaubliches berichtet. Ratten seien auf einmal in seinem Haus gewesen, die nur er sehen konnte. Seine Freundin habe Ungeziefer in sein Essen gemischt und schließlich seinen Mord geplant. Christoph ist bei der Lektüre der Briefe hin- und hergerissen. Ebenso wie der Leser mag er mal an Wahnsinn, mal an eine übernatürliche Erklärung glauben. Alpers arbeitet sein Sujet überzeugend aus, lässt einige Informationen fallen und versucht den Leser auf falsche Fährten zu führen. Die Auflösung rundet die straff durcherzählte Handlung konsequent ab und weist Alpers als routinierten Erzähler aus.
Ein ganzes Buch nur mit dem Thema Ratten zu füllen, ist eine originelle Idee, doch schwankt die Qualität der Geschichten zu stark, um an dem Buch durchweg Spaß zu haben. Alexander Grins Novelle „Der Rattenfänger“ ist ohne Frage die beste Geschichte in der Sammlung und lohnt die Lektüre in jedem Fall. Stephen Gilberts „Aufstand der Ratten“ dagegen bildet qualitativ das Schlusslicht und erscheint zu bieder, um durchgehend unterhalten zu können.