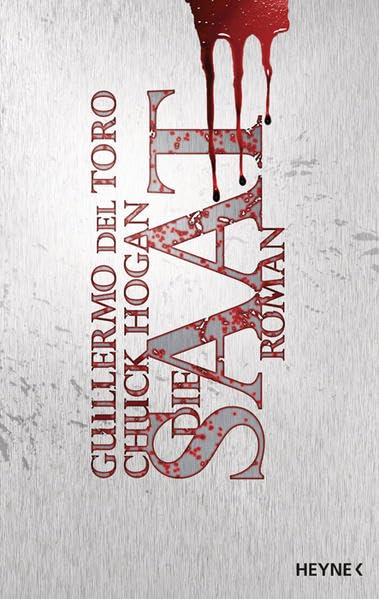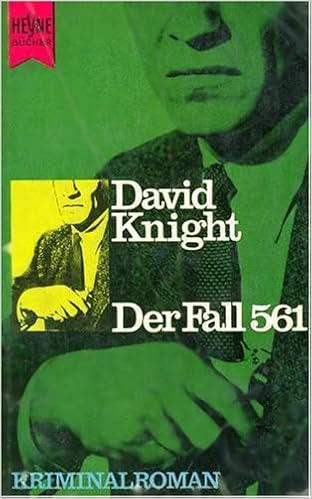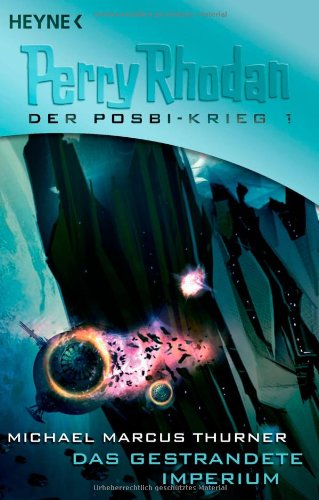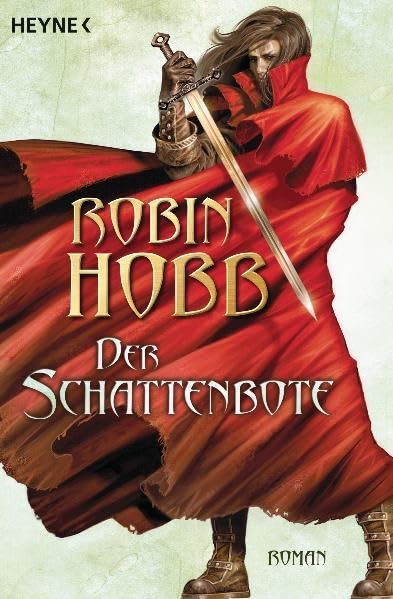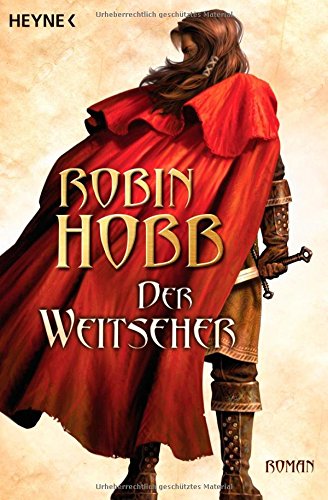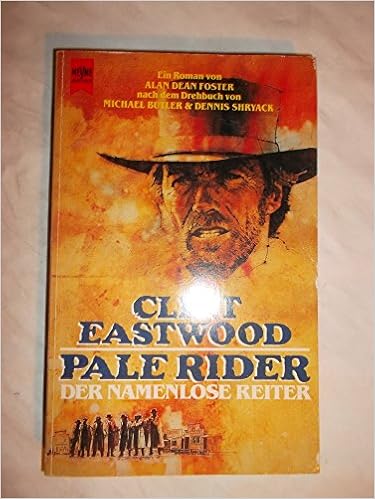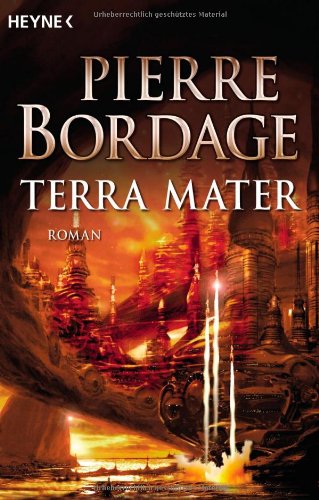_Harper Blaine:_
Band 1:[„Greywalker“ 5500
Band 2: [„Poltergeist“ 5763
Kat Richardson ist mit der Romanreihe um Harper Blaine ein Schuss ins Schwarze gelungen. Schon die beiden Vorgängerbände überzeugten mit dreidimensionalen Charakteren, spannenden Kriminalfällen und einem originellen übernatürlichen Setting. In dem dritten Roman der Serie, „Underground“, behält Richardson diese Eigenschaften bei und entwickelt ihr Universum konsequent weiter – sehr zur Freude des Lesers.
Erst einmal jedoch läuft es in „Underground“ für die Protagonistin Harper Blaine in Liebesdingen nicht wirklich gut. Schon im letzten Band kriselte es zwischen ihr und Will und das hat sich auch jetzt nicht geändert. Harper hasst es, einen wichtigen Teil ihrer Persönlichkeit – nämlich ihre Fähigkeit, im Grau zu wandeln – vor Will geheimhalten zu müssen. Diese Geheimniskrämerei tut ihrer Beziehung gar nicht gut. Doch als den beiden dann zufällig ein Zombie über den Weg läuft und Harper ihn kurzerhand kalt stellt, hilft das auch nicht weiter. Ganz im Gegenteil: Nun weiß Will zwar Bescheid, doch kann er mit diesem Einbruch des Übernatürlichen in sein geordnetes Leben nicht umgehen. Harper und Will trennen sich. Und auch wenn Harper nicht völlig am Boden zerstört ist, so ist sie doch alles andere als guter Laune.
Doch da betraut ihr Kumpel Quinton sie mit einem delikaten Kriminalfall. In einem U-Bahn Schacht hat er die Leiche eines Obdachlosen gefunden – angeknabbert und in Stücke gerrissen. Da Quinton nichts mit der Polizei zu tun haben will und außerdem davon ausgeht, dass diese sich nicht wirklich bemühen wird, den Mord an einem Obdachlosen aufzuklären, bittet er Harper um Hilfe. Zusammen machen sie sich also auf die Suche im Untergrund von Seattle und sprechen mit Obdachlosen, um die Spur des Mörders aufzunehmen, wobei bald klar wird, dass es sich keineswegs um einen Menschen handeln kann. Was nur gut ist, schließlich ist das Übernatürliche Harpers Spezialität!
Kat Richardson lässt sich für ihre Romane immer wieder neue spannende Themenfelder einfallen. So beackerte sie im vorangegangenen Band „Poltergeist“ das Feld von Parapsychologie und Spiritismus in wirklich umfassender – und natürlich unterhaltsamer – Form. In „Underground“ nun erfährt der Leser sehr viel über die Mythen und Legenden der indianischen Volksstämme aus der Gegend um Seattle sowie viel Interessantes zu Seattles illustrer Stadtgeschichte. Wieder ist offensichtlich, dass dem Schreiben des Romans eine umfassende Recherchearbeit vorangegangen ist. Und so ist der Roman vollgepackt mit Fakten, Hinweisen und Beschreibungen, ohne jedoch darüber die fesselnde Handlung aus den Augen zu verlieren. Auf sehr elegante Art gelingt es der Autorin, tausenderlei Fakten in ihren Roman zu schmuggeln, ohne dass sich der Leser belehrt vorkommt. Nie entsteht das Gefühl, Richardson würde Informationen referieren. Stattdessen sind Hintergrundinformationen immer dicht mit der Handlung verwoben und wirken dadurch als integraler Teil des Romans und nicht als pures Füllsel.
Richardsons Handlungsort ist diesmal der Untergrund Seattles – auf der einen Seite das tatsächliche Wegenetz der U-Bahn und auf der anderen Seite die teilweise noch zugänglichen alten Bebauungsschichten der Stadt, die nun hauptsächlich von Obdachlosen genutzt werden, um den Elementen zu entfliehen. Natürlich ist einem solchen Setting eine ganz besondere Faszination zu eigen, schließlich handelt es sich um eine Art Stadt unter der Stadt, die man normalerweise nicht zu Gesicht bekommt. Wie auch in Paris oder Berlin gibt es in Seattle jedoch Touristentouren, bei denen man diese alten, heutzutage unterirdischen, Teile der Stadt besichtigen kann. Richardson versteht es außerordentlich gut, das Surreale und gleichzeitig Faszinierende dieses Untergrunds in ihre Erzählung einfließen zu lassen. Ihre Beschreibungen sind ungemein plastisch und sie schafft es, die verschiedenen Zeitebenen (das heutige oberirdische Seattle sowie alte verschüttete Straßenzeilen) miteinander zu verknüpfen und für den Leser vorstellbar zu machen, selbst wenn er noch nie in Seattle war. Natürlich empfiehlt sich der Roman dadurch auch für jeden interessierten Touristen, der sich nicht nur mit dem Baedeker auf den geplanten Seattle-Urlaub vorbereiten will.
Selbstverständlich konzentriert sich Richardson nicht nur auf ihr Setting. Mindestens ebenso wichtig sind die Charaktere, allen voran Harper und Quinton. Letzterer war ja bisher ein Enigma. Der Leser hat nicht wirklich viel über ihn erfahren – wo kommt er her, arbeitet er, und wenn ja als was? Auf diese Fragen gibt Richardson in „Underground“ erstmals Antworten, wenn auch die Neugierde mancher Leser damit sicher noch nicht befriedigt sein wird. Wie Harper nämlich frühzeitig feststellt, wohnt Quinton – freiwillig – im Untergrund. Er hat sich sozusagen aus der Gesellschaft ausgeklinkt: keine Arbeit, keine Sozialversicherungsnummer, nirgends registriert. Dafür hat er seine Gründe, doch wird ihn seine Vergangenheit bald einholen.Und dann braucht es plötzlich viel Glück, Verstand und einige Zufälle, um die Vergangenheit wieder loszuwerden.
„Underground“ bietet wieder gute und spannende Unterhaltung aus der Feder von Kat Richardson. Was ihre Romane aus der Masse der Urban Fantasy heraushebt, ist einerseits ihre umfassende Recherche und andererseits ihre Fähigkeit, sympathische Charaktere zu schreiben. So kommt auch bei stolzen 500 Seiten niemals Langeweile auf. Als Leser folgt man Harper Blaine mit Vergnügen auf ihrer Wanderung durch den Untergrund von Seattle. Es wird zwar dunkel, kalt und feucht, aber dafür ist die Geschichte spannend – ein echter Pageturner eben.
|Taschenbuch: 480 Seiten
ISBN-13: 978-3453533158
Originaltitel: Underground
Übersetzt von Franziska Heel|