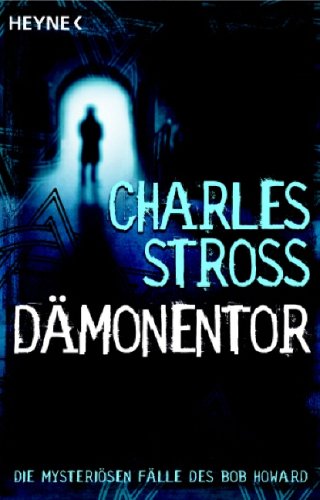Schlagwort-Archiv: Heyne
Wolfgang Jeschke, Robert Silverberg – Titan-6
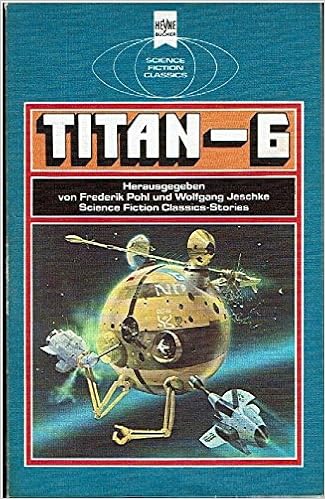
Die Großen der Science-Fiction werden mit ihren Meisterwerken bereits in der sogenannten „Science Fiction Hall of Fame“ verewigt, welche natürlich in Buchform veröffentlicht wurde (statt sie in Granit zu meißeln). Daher können Freunde dieses Genres noch heute die ersten und wichtigsten Errungenschaften in der Entwicklung eines Genres nachlesen und begutachten, das inzwischen die ganze Welt erobert und zahlreiche Medien durchdrungen hat.
In der vorliegenden Ausgabe des Auswahlbandes Nr. 6 von „Titan“, der deutschen Ausgabe der „SF Hall of Fame“, sind Novellen von Heinlein, Lester del Rey und Stanley G. Weinbaum und John W. Campbell gesammelt.
Meaney, John – Tristopolis
_Gedankenakrobatik Made In Britain._
John Meaney hat in England das Licht der Welt erblickt und akademische Auszeichnungen in den Bereichen Physik und Computerwissenschaft erlangt. Seine erstes Sci-Fi-Lebenszeichen gab er 1992 von sich, als er die Kurzgeschichte „Spring Rain“ veröffentlichte. Es folgten einige weitere Kurzgeschichten sowie Kurznovelle „Sharp Tang“, ehe 1995 dann Meaneys Debütroman erschien: „To Hold Infinity“ – eine abgefahrene Geschichte über eine Welt, in der die Gehirne der herrschenden Schicht miteinander vernetzt sind, was einen Schurken auf den Plan ruft, dessen Ziel es ist, die neuronale Speicherkapazität der Herrschenden via „Vampir-Software“ für sich selbst zu „saugen“ (einen Euro in die Kalauer-Kiste, ich weiß …) Und zu missbrauchen.
2000 servierte der Brite die Trilogie „Nulapeiron Sequence“, und auch das ist ein exotisch aufregendes Geschichten-Gelage: „Nulapeiron“ spielt in einer bizarren Welt verflochtener Untergrundstädte, die von einem strikten Hierarchiesystem bestimmt werden. Es wurde bewiesen, dass das Universum deterministisch ist; so genannte Orakel können voraussagen, was wann geschieht, und für die Menschen dort gibt es keine schlimmeren Schimpfworte als „Chaos“ oder „Unsicherheit“. Der Protagonist dieser Trilogie will sich von der Sklaverei der festgelegten Zukunft befreien und beschließt deswegen, das Orakel umzubringen. Doch wie tötet man ein Orakel, das seinen Todeszeitpunkt weit in der Zukunft vorausgesagt hat?
_Ideen im Maschinengewehr-Takt._
2007 schließlich hat Meaney sich erneut ein abgefahrenes Universum überlegt und in „Tristopolis“ zum Leben erweckt: Donal Riordan ist Polizist in Tristopolis, einer Stadt, in welcher der Tod allgegenwärtig ist, und bekommt es dort mit einem seltsamen Fall zu tun. Irgendwer scheint es auf die Künstler dieser Zeit abgesehen zu haben, inmitten ihrer Vorstellungen werden die Künstler ermordet und vom „schwarzen Zirkel“ verschleppt.
Die Ermittlungen führen Donal in das Energiezentrum der Stadt, wo riesige Nekrofusionsmeiler Energie aus den Knochen der Verstorbenen ziehen. Malfax Cortindo, Leiter des Energiezentrums, zeigt dem Polizisten, was so verlockend ist, an den Knochen der Künstler: Ihr Genie vibriert noch in den Knochen und führt jeden, der sie berührt, zu Visionen von ekstatischer Schönheit.
Riordan hat keine Zeit weiterzurecherchieren, da eine Diva in die Stadt kommen soll, ein weiteres willkommenes Opfer für den „schwarzen Zirkel“. Donal ergreift alle Maßnahmen, die nötig sind, um sie zu schützen, aber von irgendwoher fällt ein Bann auf alle Besucher, dem Riordan selbst verfällt, während er die Diva zu schützen versucht.
Als er im Krankenhaus erwacht und sich einer „thaumaturgischen Reha“ unterzogen hat, um die Folgen des Banns loszuwerden, verändert sich alles für ihn: Eine Fremde bittet ihn, Mitglied einer geheimen Abteilung der Polizei zu werden. Riordan willigt ein und bekommt es fortan mit erotischen Zombies zu tun, mit lebendigen Motorrädern, telepathiebegabten Katzen, kriminalistisch versierten Geistern, gewalttätigen Zwergen und mit einer Verschwörung, die bis in oberste Schichten der Politik zu reichen scheint.
_Morbider Genre-Crossover._
In „Tristopolis“ sind die Ideen die Hauptfiguren. John Meaney hat ein Universum geschaffen, das es in dieser Form noch nicht gegeben hat: Tristopolis ist ein städtischer Moloch, der seine Energie aus den Knochen der Toten bezieht – und der Tod ist auch sonst allgegenwärtig: In den Flüchen seiner Bürger („blutiger Tod!“, „Thanatos!“ oder „Hades!“), in den Ortsbezeichnungen, in der Technik, in der Stimmung – einfach alles ist eine Metapher auf den Tod. Alles ist dunkel, grau, glänzend, trist und überaus morbide, es gibt Todeswölfe, versklavte Geister, Menschen, die nach Landessitte an Schlangen verfüttert werden, es gibt regelmäßigen Quecksilberregen und die Sonne scheint niemals.
Die Magie ist ein wichtiges Element, aber man sollte sich darunter kein kauziges Zauberstabgeschwenke vorstellen: Meaney hat seine Magie Regeln unterworfen, pseudowissenschaftlich natürlich, aber faszinierend und irgendwie „technikähnlich“. Wie soll man sich das vorstellen? Ein Beispiel mag der Erhellung dienen:
|Cortindo erklärte, dass die Mikrostrukturen lebendiger Knochen von den Wahrnehmungen und Handlungen des Körpers verändert werden, der sie umschließt. Doch nach dem Tod, wenn selbige Knochen Bestandteil des Meilers sind, heult und stöhnt der Nekroflux, dessen Wellen von der inneren Struktur der Knochen gebeugt werden, und erweckt die Erinnerungen der Toten wieder zum Leben.
„Aber nicht in einem zusammenhängenden Ganzen“, sagte Malfax Cortindo. „Es sind nur buntgemischte Erinnerungsfragmente von zweitausend Individuen. Dieses Konglomerat denkt und empfindet in Wahrheit gar nichts.“
Donal blieb stehen und schaute zu den langen, geraden Reihen der Reaktoren zurück.
„Nicht einmal Schmerz?“
„Nein.“ Malfax Cortindo sah ihn lange an, dann tippte er mit seinem Stock auf den Boden. „Das erzähle ich zumindest jedem, der mich offiziell fragt. Verstehen Sie, Lieutnant?“|
Das ist gleichzeitig auch ein wunderbares Beispiel für die kalte und beklemmende Welt von „Tristopolis“, die einen nicht mehr loslässt. Dazu trägt auch das tolle Cover bei, das tatsächlich einen Bezug zum Inhalt des Textes hat! Franz Vohwinkel hat hier hervorragende Arbeit geleistet und die Stimmung von Tristopolis eingefangen – das englische Originalcover kommt da nicht ansatzweise heran. Vohwinkels Cover erzeugt eine herrlich düstere Resonanz zur Story und unterstreicht die intensive Stimmung. Wenn ich ein Synästhet wäre, würde ich die Geschichte wahrscheinlich in der Farbe von schwarzem Chrom wahrnehmen: dunkel, kalt, makellos, mit einem bösen Glanz von Purpur.
Es sei noch erwähnt, dass Meaney ein paar überaus rasante und knackige Kampfszenen geschrieben hat, wobei ihm sein schwarzer Gürtel im Shotokan-Karate sicherlich sehr weitergeholfen hat.
_Eine große Kulisse überleuchtet ihre Akteure._
Leider erreicht das Loblied nicht jeden Winkel von „Tristopolis“. Die Story wird nämlich ziemlich zurückgedrängt von dieser grandiosen Kulisse, und Donal Riordan, ein recht gewöhnlicher Held, muss einen eher biederen Kriminalfall lösen, der mit keinen allzu großen Überraschungen aufwarten kann. Auch Zwischenmenschliches ist nicht unbedingt Meaneys Stärke, ebenso wenig wie die Erschaffung von Figuren mit Tiefe: Selten treten echte Konflikte auf, und wenn doch, lösen diese sich ebenso schnell in Wohlgefallen auf, wie sie aufgetaucht sind.
Außerdem schießt Meaney stellenweise über das Ziel hinaus, wenn er versucht, eine düstere Stimmung zu vermitteln: Immer wieder hat jemand Schmerzen, die über das „Zigfache dessen hinausgehen, was ein normaler Mensch je ertragen könnte“, und als ob das nicht schon genug wäre, kann es schon einmal vorkommen, dass diese Höllenqualen subjektiv erlebte Jahrhunderte andauern.
Das Gleiche muss leider auch über die Fantasy-Elemente gesagt werden. Oft hat Meaney die Gratwanderung gemeistert, lässt Geister Fahrstühle bedienen oder an Flughäfen die Passagiere durchsuchen, aber wer kann sich ein Schmunzeln verkneifen, wenn Autos plötzlich Fledermausflügel ausfahren oder wenn „Überwachungselfen“ im Krankenhaus über ihren Patienten schweben und ein EKG mimen, indem sie „Zwitscher-, Pieps- und Seufzlaute“ von sich geben …
Aber genug des Gemeckers. Auch wenn die Story fast schon Statistencharakter hat, das Universum von „Tristopolis“ ist einen Besuch allemal wert. Besonders der mutige Genre-Crossover hat Unterstützung und Bewunderung verdient; Meaney hat hier Pionierarbeit geleistet und diese mit einer Unmenge solider Ideen zementiert. Außerdem schickt uns Meaney schon 2008 zum nächsten Mal nach Tristopolis, um uns von „Dark Blood“ zu berichten, und wer weiß: Vielleicht hat sich Meaney zum tollen Universum auch noch eine tolle Geschichte ausgedacht! „Tristopolis“ jedenfalls dürfte sich in jedem gut sortierten Phantasten-Regal recht wohlfühlen.
http://www.heyne.de
http://www.johnmeaney.com
Dan Simmons – Terror

Jack Ketchum – Beutezeit
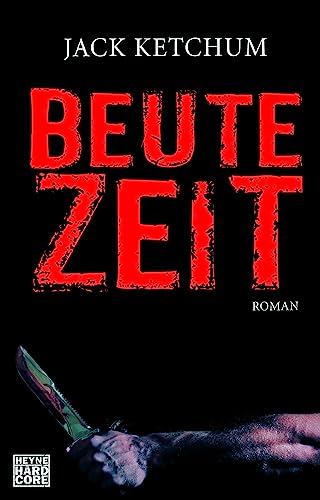
Philip Pullman – Der Goldene Kompass, Der (His Dark Materials 1)

Inhalt
Philip Pullman – Der Goldene Kompass, Der (His Dark Materials 1) weiterlesen
Jed Rubenfeld – Morddeutung
Im August des Jahres 1909 empfangen die Psychoanalytiker Stratham Younger und Abraham Brill im Auftrag der Clark University in New York die europäischen Väter ihrer noch jungen Wissenschaft: Aus Wien besucht sie Sigmund Freud in Begleitung seiner Schüler Sándor Ferenczi und C. G. Jung. Der berühmte Analytiker wird von den wissenschaftlichen Kollegen, die ihn für einen Scharlatan halten, stark angefeindet. Die Einladung in die USA gab Freud die Gelegenheit, dem Streit für einige Zeit aus dem Weg zu gehen und sich unter freundliche Kollegen zu begeben.
Die gelehrte Männerrunde wird durch ein aktuelles Verbrechen herausgefordert. Ein brutaler Serienmörder überfällt junge Frauen hohen gesellschaftlichen Standes, foltert und erdrosselt sie mit einer Seidenkrawatte. Sein letztes Opfer, die 17-jährige Nora Acton, konnte durch Schreie rechtzeitig auf sich aufmerksam machen und wurde gerettet. Der Schock hat allerdings die Erinnerung an die Untat gelöscht. Younger, der selbst zur Highsociety gehört, kann dem Bürgermeister von New York, der persönlich die Ermittlungen in diesem delikaten Fall leitet, die Idee schmackhaft machen, Nora psychoanalytisch zu behandeln und so die Gedächtnisblockade zu lösen. Freud steht ihm beratend zur Seite. Jed Rubenfeld – Morddeutung weiterlesen
Kit Whitfield – Wolfsspur
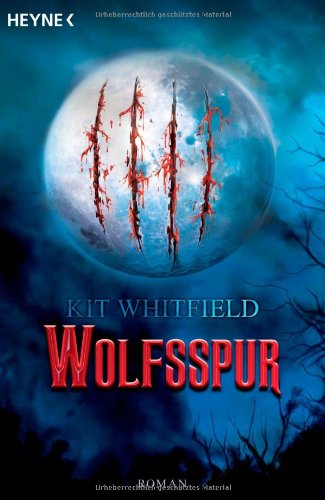
Ganz der reißerischen Titelgrafik entsprechend, geht es um Werwölfe. Doch wer deswegen nun spannende, actiongeladene Fantasy mit Gruselfaktor erwartet, der ist falsch gepolt. „Wolfsspur“ weist eine immense Tiefe auf, die man hinter einem so billig aufgemachten Buchdeckel niemals erwarten würde. Fantasy, Thriller, Liebesgeschichte, düstere Utopie und Sozialdrama – all diese Elemente verwebt Whitfield zu einer eigenwilligen und faszinierenden Geschichte.
Murray Engleheart/Arnaud Durieux – AC/DC: Maximum Rock’n‘ Roll
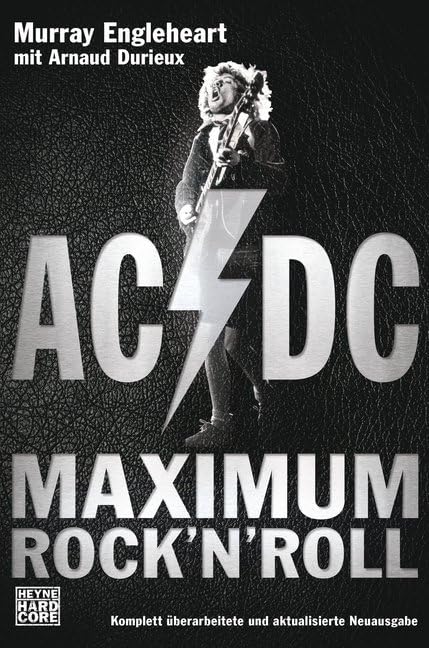
Murray Engleheart/Arnaud Durieux – AC/DC: Maximum Rock’n‘ Roll weiterlesen
Cory Doctorow – Backup. SF-Roman

Vor seiner Ermordung hätte sich der Komponist und Designer Julius nicht träumen lassen, wie wichtig ein zeitnahes Backup der eigenen Erinnerungen ist. Aber da dies schon sein vierter Tod ist, hat er allmählich eine Vorstellung davon, wie wichtig eine Sicherungskopie ist. Daher ist er wenige Tage später schon wieder in einem neuen Klonkörper einsatzbereit. Seine Freunde Dan und Lily helfen ihm, den Verantwortlichen ausfindig zu machen und zur Rechenschaft zu ziehen.
Cory Doctorow – Backup. SF-Roman weiterlesen
Harrison, M. John – Nova
_Mr. Anti-Mainstream._
M. John Harrison ist keiner, der sich den Konventionen verschrieben hat oder auf Stereotypen herumreitet, egal ob man seine Fantasy-Werke betrachtet (z. B. den |Virconium|-Zyklus) oder seine Science-Fiction-Storys. Von seinen acht Sci-Fi-Romanen haben es allerdings nur vier zu einer deutschen Übersetzung geschafft: „Idealisten der Hölle“ (1971), „Die Centauri-Maschine“ (1974), „Licht“ (2002) und jetzt auch „Nova“.
_Rauchende Köpfe._
Es ist jedenfalls erfrischend, welche Bandbreite |Heyne| mittlerweile an Science-Fiction anbietet; da gibt es die bildgewaltige Popcorn-SciFi („Mardock“ von To Ubukata) oder technikarme Gesellschaftssatire ([„Sternensturm“ 4043 von Adam Roberts) und plötzlich prügelt M. John Harrison den Leser mit dieser knüppelharten Hardcore-Keule vom Lesesessel. Das Seltsame daran: Alle harten Science-Fiction-Elemente von „Nova“ bewegen sich irgendwie im Hintergrund, sind Statisten und agieren aus dem Off. Normalerweise tauchen Science-Fiction-Geschichten ein in die Welt, die sie erschaffen haben; das Futuristische eines Sci-Fi-Romans ist fast immer eine Hauptfigur, die erschöpfend ausgeleuchtet wird. Oh, auch in „Nova“ ist das Futuristische eine Hauptfigur, aber sie wird niemals erschöpfend ausgeleuchtet, sie ist eine Figur, die ständig präsent bleibt, die jede andere Figur beeinflusst, aber nie wird dem Leser ein erhellender Blick in ihr Inneres gewährt, und das ist oft ein ziemlich faszinierendes Erlebnis.
Worum geht es denn nun in „Nova“? Es geht um eine Gruppe Menschen, die in „Saudade“ leben, einer Stadt auf einem unbenannten Planeten, gezeigt in einer unbenannten Zeit. Das Besondere an dieser Stadt ist, dass die „Ereignis-Aureole“ in sie eingeschlagen ist, ein rätselhaftes Gebiet unbekannter Physik, in dem keine der uns bekannten Gesetze gelten. Es gibt in Saudade so genannte „Entradistas“, die sich auf wagemutige Expeditionen in die Aureole begeben.
Vic Serotonin ist einer von ihnen. Seine Gründe sind profan: Er verdient sich sein Geld damit, Touristen in die Aureole zu führen und so genannte „Artefakte“ mit in die heimische Realität zu bringen, um sie illegal zu verkaufen. Artefakte sind Gegenstände oder Lebewesen, die eine völlig andere Gestalt annehmen, wenn sie die Aureole verlassen. Dabei sollte Serotonin es besser wissen. Sein Freund Emil Bonaventura hat von diesen Expeditionen irreparable Schäden davongetragen, er ist geistig verwirrt, kann nicht mehr träumen und sein Körper wird förmlich zerfressen von Geschwüren und seltsamen Blutkrankheiten; es ist, als ob sich Bonaventuras Fleisch nicht mehr an die Regeln halten würde.
Nun sind diese Ausflüge nicht nur gefährlich, sie sind verboten. Lens Aschemann ist Fahnder der so genannten Gebietskripo. Schon lange hat er Vic Serotonin im Auge, und er beginnt ihm auf den Zahn zu fühlen; ob er etwas wisse, fragt er ihn, über die Menschen, die sich im Café Surf aus dem Nichts zu materialisieren scheinen, die eine wilde Nacht verbringen, um sich dann wieder in Luft aufzulösen.
Als ob das nicht genug wäre, sitzt Vic noch eine aufdringliche Touristin im Nacken, die von ihm verlangt, dass er unbedingt mit ihr in die Aureole gehen soll. Solche Kleinigkeiten wie Polizeibeschattung interessieren sie dabei nicht. Und um dem Übel den letzten Schliff zu geben, entpuppt sich Vics letztes verkauftes Artefakt als eine „Tochter“, als ein Code also, der seinen Besitzer befällt und ihn in etwas völlig Unbekanntes verwandelt. Deswegen sitzt ihm nicht nur Gebietsfahnder Aschemann im Genick, sondern auch die Leibgarde seines letzten Kunden …
_Irrfahrt durch Weirdo-City._
Man betrachtet also Vic Serotonin, den Gebietsfahnder Aschemann und all die anderen Figuren auf ihrem bizarren Trip durch diese bizarre Zukunft. Bizarr ist nämlich das Zauberwort: Bei der Lektüre hat man oft das Gefühl, nur die Hälfte zu verstehen, es ist, als ob man einen Film in fremder Sprache betrachtet, dessen Bilder spannend genug sind, dass man ihn unbedingt zu Ende sehen möchte.
Das ist auch das Verstörende an „Nova“, das Anstrengende und das Faszinierende: Direkte Infos gibt es kaum, nirgends finden sich erklärende Zwischenbemerkungen des Erzählers, der den Leser des 21. Jahrhunderts an der Hand nimmt, um ihn in das fremde Universum einzuführen. Nein, der Leser muss sich selbst in dieser Zukunft zurechtfinden, muss die futuristische Sprache ohne Hilfe entschlüsseln, denn „Nova“ scheint nicht für uns geschrieben worden zu sein, sondern für die Menschen der Zeit, in der der Roman spielt. Beispiel gefällig? Bitteschön:
|“[…] das Tank-Proteom schwappte wie warme Spucke: Kaskaden von Autokatalyse in einem Substrat aus vierzigtausend Molekülarten, um alle zwanzig Minuten auszuschwemmen, was die Chemie nicht eliminieren konnte.“|
Alles klar? Und das bereits auf Seite 18. Aber keine Bange, an den Absurditätenfaktor von John Clutes [„Sternentanz“ 380 kommt Nova noch lange nicht heran, es gibt da schon noch die eine oder andere Begebenheit, an der sich auch ein Leser aus unserer Zeit festhalten kann.
Aber die Faszination der Sprache hält nicht den ganzen Roman durch an, irgendwann drängt sich einem nämlich der Eindruck auf, dass solche Sätze wie die obigen nichts weiter als Imponiergehabe sind. Man wird nie erfahren, was ein Codejokey so tut, wer die SED ist, und so weiter. Das alles würde nicht stören, wenn einem die Story suggerierte, dass es wenigstens der Autor weiß. Aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Oh, natürlich will ich nicht behaupten, dass Harrison nur schicke Science-Fiction-Worthülsen abfeuert, aber manchmal sieht es schon so aus, als ob gar zu kräftiges Begriffsgepolter davon ablenken soll, dass dann doch nicht soo viel Substanz dahintersteckt …
Auch die sinnverschleiernden Schachtelsätze erhärten obigen Eindruck, die „Satzgirlanden“, wie Wolf Schneider sie bezeichnen würde, der Sittenwächter über deutsche Sprachästhetik. Auch hier wird ein Beispiel erhellen, was ich meine:
|“Elektromagnetisch desorientiert und immer noch auf Instruktionen wartend, fand sich das SED der Gebietskripo – bestehend aus Codejokeys, Waffenexperten und einer menschlichen Pilotin, die mit einem DBH-Einsatzvehikel verdrahtet war – mit munteren dreißig Knoten quer zur Längsachse ins Ereignisgebiet treiben.“|
Quizfrage: Wie oft musste dieser Satz gelesen werden, um herauszufinden, worum es da eigentlich geht? Dass das „SED der Gebietskripo“ noch immer „auf Instruktionen wartet“ und dabei „ins Ereignisgebiet treibt“, „mit munteren dreißig Knoten“ und „quer zur Längsachse“? Solche potthässlichen Satzmonster vergewaltigen alle Verständlichkeit, und das kann sich so abgefahrener Stoff wie „Nova“ gleich fünfmal nicht leisten.
Das Finale ist ein drittes Indiz dafür, dass „Nova“ ein Roman ist, der mit erzähltechnischen Bizeps-Prothesen seine mageren Plot-Muskeln aufplustern will: Zwar findet jede Figur zu einem stimmigen Schlusspunkt, aber irgendwie scheint alles etwas in der Luft zu hängen; als hätte Harrison beschlossen, hier und jetzt einen Schnitt zu setzen, weil es seiner Meinung nach jetzt so weit sein müsste. Entscheidende Informationen über die Aureole bleiben außerdem ungelüftet, sodass man am Ende von „Nova“ das Gefühl hat, weniger über das Storyuniversum zu wissen als vorher.
Nun ja. Trotzdem ist „Nova“ ein abgefahrener Trip, in den man als Freund harter Science-Fiction ruhigen Gewissens einmal reinlesen kann. Man sollte allerdings darauf vorbereitet sein, dass die wachsende Erwartungshaltung enttäuscht werden wird, dass man zwar eine abgefahrene Bilderschau erleben darf, aber nicht auf eine weltbildverrückende Vision hoffen sollte, wie sie ein Greg Egan zustande bringt. Um sich den schalen Geschmack einer Stargate-Vergiftung aus dem Mund zu spülen, taugt „Nova“ aber allemal. Kann man haben, muss man aber nicht.
http://www.heyne.de
_M. John Harrison auf |Buchwurm.info|:_
[„Licht“ 907
[„Die Centauri-Maschine“ 2851
John Meaney – Tristopolis

Diane Carey – Neuer Ärger mit den Tribbles (Star Trek: DS9)
105 Jahre ist es her, dass der klingonische Spion Arne Darvin von Captain Kirk entlarvt wurde. Von seiner düpierten Regierung fallen gelassen, fristet der Ex-Agent sein Dasein als erfolgloser Kaufmann; Kirk hat er blutige Rache geschworen. Nun bietet sich ihm unverhofft eine Möglichkeit. Darvin erfährt, dass die „Doppelkugel der Zeit“, das Artefakt einer unbekannten Zivilisation, auf den Planeten Bajor gebracht werden soll. Der Auftrag, die Doppelkugel von Cardassia Prime abzuholen, geht an die „Defiant“ unter Captain Sisko von der Föderations-Raumstation „Deep Space Nine“.
Unbemerkt kann sich Darvin Zugang zur Doppelkugel verschaffen. Wie ihr Name bereits verrät, ermöglicht sie Zeitreisen. Darvin aktiviert sie und lässt sich ein Jahrhundert zurück in die Vergangenheit versetzen. Kurz bevor es auf der Raumstation „K-Sieben“ zu dem für sein jüngeres Ich verhängnisvollen Zusammentreffen mit Captain Kirk kommen wird, gedenkt er seinem Feind eine Falle zu stellen. Diane Carey – Neuer Ärger mit den Tribbles (Star Trek: DS9) weiterlesen
Charles Stross – Dämonentor. Die mysteriösen Fälle des Bob Howard
Der Heyne-Verlag deklariert diesen Roman mit dem Schriftzug: »Die große Mystery-Serie«. Sollen wir also davon ausgehen, dass dies der erste Band einer Serie wie »Akte X« ist, wie uns der Umschlag glauben macht? Auf der Autorenhomepage findet sich nur der Hinweis auf den Roman »The Atrocity Archives«, der in England ein großer Erfolg gewesen sei und nun unter anderem ins Deutsche für den Verlag übersetzt wurde. Jedensfalls erschließt sich daraus nicht, ob es zu »Dämonentor« weitere Romane geben wird. Lesen wir ihn also unter dem Gesichtspunkt der Eigenständigkeit.
Bob Howard arbeitet für eine Abteilung des britischen Geheimdienstes, die unter Eingeweihten als »Wäscherei« bekannt ist. Er ist für die Netzwerke und einzelnen Rechner der Einrichtung verantwortlich und integriert sich mit wachsender Beteiligung in den aktiven Außendienst. Dabei kümmert sich die Abteilung um mathematische Grundlagen zur Erschaffung sogenannter Tore zu anderen Universen, durch die je nach Beschaffung Daten oder auch feste Körper transferiert werden können. Die Wäscherei sorgt dafür, dass diese Mathematik der breiten Bevölkerung unzugänglich bleibt, da die außeruniversalen Wesen oft den schlimmsten Alpträumen entsprungen zu sein scheinen und für die Erde die Vernichtung bedeuten könnten, außerdem ist dieselbe Wirkung durch physikalische Einflüsse zu befürchten, wenn die Tore nicht richtig gesichert werden.
Auch in Deutschland ist Charles Stross kein Unbekannter mehr, denn mit seinen drei Science-Fiction-Romanen »Singularität«, »Supernova« und »Accelerando« wurde er regelmäßig für Preise nominiert. Er schreibt mit außergewöhnlichem Stil und mit außergewöhnlichen Ideen und ist schon von daher lesenswert, plus den hohen Unterhaltungsfaktor seiner Geschichten.
Die drei bisher erschienenen Romane waren Science-Fiction, bei »Dämonentor« fällt die Einordnung nicht so leicht. Durch übernatürliche und okkulte Aspekte macht der Verlag keinen Fehler, wenn er das Buch als Mystery führt, allerdings kennt der Protagonist die mathematischen Hintergründe dieser Geschehnisse und nimmt damit diesen »mystischen« Hauch echter unerklärlicher Geschichten.
Der Protagonist ist ein kleiner Computerfreak, der sein Schicksal gelassen sieht. Es hat ihn für immer in die Wäscherei verschlagen, also macht er das Beste daraus und versucht, dem Papierkram der Bürokratie möglichst aus dem Weg zu gehen. Dabei faszinieren ihn die Theorien über Außerirdische, Paralleluniversen und die Praxis dazu stark. Er versucht, über alle für ihn erreichbaren Quellen auf dem aktuellen Stand der Fälle zu sein, dadurch gerät er mit seinen hochbürokratischen Vorgesetzten aneinander. Zu seinem Glück ist ein höheres Tier der Gesellschaft ein Freund von ihm, ein anderer erkennt sein Potenzial und übernimmt ihn.
Howard stellt sein Licht immer unter den Scheffel, außerdem steht er ziemlich weit unten auf der Karriereleiter. Trotzdem wird schnell deutlich, dass er sich ausgezeichnet auskennt und einer der besten und intelligentesten Agenten der Wäscherei ist, auch wenn weder diese noch er selbst das ohne weiteres eingestehen.
Stross lässt seinen Protagonisten Ich-erzählen, wodurch die Ereignisse mit interessanten Kommentaren gespickt werden können. Außerdem kann er ihn die fiktiven technisch-mathematischen Hintergründe seiner Paralleluniversumstheorie erläutern lassen, was dann auf das Wesen des Protagonisten zurückgeführt werden kann und das Mitteilungsbedürfnis des Autors versteckt.
Zum Unterhaltungswert des Buches kann man nur sagen: eins-a. Stross ist ein begnadeter Erzähler, er lässt Bob Howard in ironischer, teilweise fatalistischer Art über seine Arbeit sprechen und spinnt durchweg einen spannenden Erzählfaden. Der Entwurf dieser geheimen Agentenabteilung mit ihren Intrigen, ihrer Bürokratie und der Würze der Charaktere bietet tatsächlich die Grundlage für eine großartige Serie. Bei der Menge heutiger Serien sollte man nur hoffen, dass Stross es nicht übertreibt und sein Potenzial nach ein paar Romanen um Howard auch anderen Projekten zur Verfügung stellt.
Fazit: »Dämonentor« ist trotz des deutschen Titels ein Buch für jedermann, der sich spannender, intelligenter Thrillerunterhaltung mit einem ironischen Spritzer Mystery hingeben will.
Originaltitel: The Atrocity Archives
Aus dem Amerikanischen von Mechthild Barth
Taschenbuch, 400 Seiten
Der Autor vergibt: 



Michael Connelly – Der Mandant
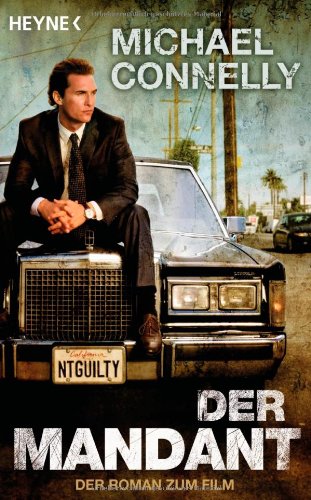
Roberts, Adam – Sternensturm
_Kleiner Ausschnitt einer großen Bibliographie._
Adam Roberts ist ein umtriebiger Autor, der seit 2000 bereits zehn Science-Fiction-Romane veröffentlicht hat, eine Science-Fiction-Kurzgeschichtensammlung und zwei Bücher über Science-Fiction. Dazu kommen noch sechs Parodien, die |Dr. Who| auf die Schippe nehmen, das |Silmarillion|, den |kleinen Hobbit|, |Star Wars|, |Matrix| und den |Da Vinci Code|. Zur deutschen Übersetzung haben es davon „Das Stiehlnemillion – Die Tolkien-Parodie“ geschafft, „Der kleine Hobbnix – Die Tolkien-Parodie“ und „Star-Warped – Die Krieg-der-Sterne-Parodie“.
Nicht zu vergessen, dass Roberts als Dozent tätig ist, an der University of London, um sich zum einen mit Literatur des 19. Jahrhunderts zu befassen, aber auch mit der Postmoderne – insbesondere mit Science-Fiction.
Von Roberts‘ Science-Fiction-Ergüssen sind nur wenige ins Deutsche übersetzt worden: sein Erstling „Salt“ („Sternennebel“), „Stone“ („Sternenstaub“) und das vorliegende „Sternensturm“ (im Original: „Polystom“). Dazu sei gesagt, dass die drei Romane inhaltlich nicht zusammenhängen, auch wenn die deutsche Titelgebung etwas Derartiges suggeriert. Jedenfalls ist „Polystom“ bereits 2003 erschienen, während die fünf Nachfolger noch auf ihre Übersetzung warten: die Kurzgeschichtensammlung „Swiftly“ (2004), „The Snow“ (2004), „Gradisil“ (2006), „The Land of the Headless“ (2007) und „Splinter“ (2007). Nicht vergessen werden sollen auch die unübersetzten Vorgänger von Polystom: „On“ (2001), „Park Polar“ (2002) und „Jupiter Magnified“ (2003)
_Ein verkannter Profi des Besonderen._
Wenn man sich die Lesermeinungen in diversen Online-Buchgeschäften so ansieht, die um Roberts übersetzte Science-Fiction-Werke kreisen, schwinden alle Hoffnungen, dass die besagten Polystom-Nachfolger jemals den Weg in die deutschen Büchereien schaffen. Grund für den allgemeinen Unmut mag vielleicht die etwas ungeschickte Coverwahl von |Heyne| sein, denn hypermoderne Riesenraumschiffe finden sich in „Sternensturm“ nicht, ebenso wenig wie die krasse Hardcore-Science-Fiction, deren Erwartung einem der werbewirksam abgedruckte Kommentar von Stephen Baxter einflüstert. Stattdessen begegnet Roberts der Science-Fiction auf eine wunderbar unkonventionelle Art, die dem Raumschiff-Puristen mit Sicherheit aufstößt, aber hiermit jedem Leser empfohlen sei, der sich auf die etwas andere Science-Fiction einlassen kann und Abstand braucht von altbekanntem Weltraumgeballer.
_Was wäre, wenn …_
… es den Äther tatsächlich gäbe, wenn die Sonne in einer Atmosphäre arbeitete, wenn man zwischen den Planeten mit Zeppelinen und Flugzeugen fliegen könnte, wenn Himmelswale durch den Äther zögen, um sich von interplanetarem Plankton zu ernähren? Dann wären die Planeten um einiges kleiner, als sie es in unserer Welt sind, und es wäre auch nichts Besonderes, wenn einzelne Menschen Verwalter ganzer Welten wären. Dementsprechend ist Polystom ein solcher Verwalter, auf dem Papier zumindest, denn eigentlich ist er der Sohn des verstorbenen „echten“ Verwalters und eher adligem Nichtstun verpflichtet als politischen Aufgaben. Polystoms Herz schlägt für die Poesie und für die Wälder, die sein Gut umwachsen, für sein Flugzeug außerdem und für seinen Onkel Kleonikles, den er des Öfteren auf dem Mond besucht – um sich auszuweinen meistens.
Nun, der Leser jedenfalls erfährt schon auf der ersten Seite des Buches, dass Kleonikles nur noch drei Tage zu leben hat. Bevor dieses Ereignis aber eintritt, streift man durch Polystoms Vergangenheit, erlebt seine gescheiterte Ehe mit der seltsamen Beeswing und erfährt, dass Kleonikles der absurden Theorie nachhängt, es könnte auch Planeten- und Sonnensysteme in einem Vakuum geben. Dann, wenn man dem Leben und Leiden dieser beiden Figuren zugesehen hat, wird Kleonikles wie angekündigt umgebracht und Polystoms Leben nimmt eine weitere Wendung.
Er verpflichtet sich dazu, am Krieg auf dem Schlammplaneten teilzunehmen, wo sich Bedienstete gegen ihre Herren aufgelehnt haben und nun schon Jahre ihrer Niederwerfung trotzen konnten. Polystom lässt einen Teil seiner eigenen Dienerschaft ausbilden und fliegt selbst mit auf den Schlammplaneten, als diensthabender Offizier, um dort schmerzhaft lernen zu müssen, dass Krieg alles andere als poetisch und heldenhaft ist. Außerdem, und das ist viel wichtiger, stößt er dort auf ein Geheimnis, das ihn vor eine schwere und schicksalhafte Entscheidung stellt …
_Weltraumabenteuer mit Figuren-Fokus._
Wo andere Science-Fiction-Romane großen Wert auf ihr Universum legen und auf möglichst abgefahrene Techno-Spielereien, legt Roberts in diesem Roman den größten Wert auf seine Figuren. Das obig skizzierte Szenario mag gähnend langweilig erscheienen, und mit Sicherheit wäre es das auch, würde Roberts seine Feder nicht so pointiert und scharfzüngig führen. Seine Bilder sind frisch und unverbraucht, seine Dialoge treffen voll ins Schwarze und nie hätte ich gedacht, dass man Gehässigkeit so geschickt zwischen die Zeilen eines Buches packen kann.
Sympathische Figuren sucht man in „Sternensturm“ jedenfalls vergeblich. Polystom etwa, diese selbstverliebte, Untergebene verheizende, dummdreiste, naive, standesdünkelnde Heulsuse, stürzt einen ständig in ein Wechselbad der Gefühle: Entweder hasst man ihn, oder man bemitleidet ihn. Seine gescheiterte Ehe etwa … Als man am Anfang des Buches davon erfährt, hat man noch das Standardbild der gescheiterten Ehe vor Augen: eine normale Beziehung, man lebt sich auseinander, wie eine Ehe eben so kaputtgeht. Aber von wegen. Diese „Ehe“ verdient ihre Bezeichnung nur in Polystoms Wahrnehmung, der Leser erlebt ein grauenhaftes Fiasko durch die narzistisch selbstüberschätzende Brille, die Polystom trägt. Alleine schon sein Balzverhalten lässt einen gehässig Tränen lachen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder beides. Das Ganze gipfelt allerdings in einem knallharten Psychoduell, bei dem irgendwann auch der dunkelsten Seele das Lachen im Halse stecken bleibt: Ständig betrachtet man die Geschehnisse aus dem Blickwinkel des „höherwertigen Polystom“, der von seiner Frau Respekt einzufordern versucht, weil sie „diese Ehe als ein Geschenk betrachten und mit Respekt würdigen sollte, da sie gesellschaftlich weit unter ihm stünde.“
Die ganze Gesellschaft in dieser parallelen Welt ist geprägt von einem beinharten Hierarchiesystem und es ist sicher nicht übertrieben anzunehmen, dass Roberts mit „Sternensturm“ einen herben Angriff auf blaublütigen Dünkel verüben will und auf die Natur des Menschen im Allgemeinen. Der ganze Roman ist eine einzige Spitze, vollgepackt mit giftigem Humor, der manchmal so bitter zynisch und pechschwarz ist, dass man sich nur noch hinter vorgehaltener Hand zu lachen traut. Zum Ende hin verflüchtigt sich der Humor allerdings und leidenschaftlicher Zynismus gewinnt die Oberhand: Die Bilder werden zunehmend drastisch, als Polystom den Krieg auf dem Schlammplaneten erlebt, und Roberts‘ Stil überschreitet ein ums andere Mal die Grenze zum Bösartigen. Und hier, man hat schon gar nicht mehr erwartet, nimmt dann doch die Science-Fiction die Zügel in die Hand und überrascht den Leser mit einem unerwarteten Finale.
_Besondere Kost für besondere Leser._
Ja, der Science-Fiction-Anteil von „Sternensturm“ hält sich definitiv in Grenzen, beschränkt sich auf die Beschreibung der alternativen Physik des Universums, auf die Forschungsbeschreibungen von Polystoms Onkel und auf den Clou am Ende. Auch dieser Clou wird nicht jeden Geschmack treffen, ich wage zu behaupten, dass man ihn entweder liebt oder hasst, aber das trifft mit Sicherheit auf das ganze Buch zu. Dementsprechend ist es nicht ganz einfach, die Zielgruppe einzugrenzen, die an „Sternensturm“ ihre Freude haben könnte.
Wer sich ein Buch mit dem Titel „Sternensturm“ sonst nicht kaufen würde, hat jedenfalls schon mal gute Chancen für die Kandidatenliste. Wer sich bei Raumschiffen auf dem Buchcover sonst mitleidig lächelnd abwendet, sollte ebenfalls hellhörig werden. Wer sich auf eine gallige Gesellschaftsfiktion einlassen kann, mit einem Humor, der manchmal so böse zwischen den Zeilen hockt, dass er diese Bezeichnung kaum noch verdient, bekommt ebenfalls Pluspunkte auf seinem Kandidatenindex. Jetzt braucht es nur noch eine Begeisterung für das futuristisch-philosophische Gedankenexperiment, um sich guten Gewissens auf den Weg in das nächste Buchgeschäft zu machen. „Sternensturm“ ist ein mutiges Kleinod von ausgesuchter Gemeinheit!
http://www.heyne.de
|Adam Roberts auf Buchwurm.info:|
[„Sternenstaub“ 2308
[„Der kleine Hobbnix“ 477
[„Star Warped“ 1495
Will Henry: Die James-Bande

Will Henry: Die James-Bande weiterlesen
Ubukata, To – Implosion (Mardock-Trilogie 3)
Band 1: [„Kompression“ 2695
Band 2: [„Expansion“ 3363
_Das Geheimnis der 1800 Seiten._
Das Ursprungsmanuskript der Mardock-Trilogie umfasste 1800 Seiten, hieß es stets, und da es die deutschen Übersetzungen gerade mal auf gute 1000 Seiten bringen, stellt sich dem neugierigen Leser natürlich die Frage: Wo ist der Rest abgeblieben? Von |Heyne| gekürzt? Bei der Übersetzung verloren gegangen? Cora Hartwig, die Übersetzerin der Mardock-Trilogie, hat das Geheimnis dann gelüftet: Das Ursprungsmanuskript der Mardock-Trilogie umfasste 1800 Seiten, wurde dann aber u. A. vom Autor selbst kräftig gekürzt, ehe es überhaupt veröffentlicht wurde.
Außerdem muss bei solchen Seitenangaben beachtet werden, dass die japanische Normseite 17 Zeilen und 40 Anschläge umfasst, während es bei der deutschen Normseite 30 Zeilen und 60 Anschläge sind (eine Normseite entspricht der Standardformatierung, in der Manuskripte bei Verlagen einzureichen sind, wie jede(r) Nachwuchsautor(in) gequält nickend zu bestätigen weiß). Auch diese Information verdanke ich Frau Hartwig und möchte mich an dieser Stelle nochmals herzlich bei ihr bedanken!
_Showdown A-go-go Baby!_
Nun denn, zurück nach Mardock, wo der Leser in „Kompression“ und „Expansion“ eine rasante Achterbahnfahrt durchlebt hat: Im ersten Band durfte der geneigte Leser Rune Balot kennenlernen, die minderjährige Zwangsprostituierte; man war dabei, als sie von Shell Septinos beinahe umgebracht wurde, als sie von zwei Rechtsanwälten aufgegriffen wurde, als sie zu einer biotechnologischen Kampfmaschine umgebaut wurde, als sie ihre Fähigkeiten zu beherrschen lernte, als sie von Shell Septinos und seinen brutalen Häschern gejagt wurde, als Action im Buch eine neue, vorstellungssprengende Dimension erreicht hat.
Im zweiten Band dann begab man sich mit Rune Balot auf die Suche nach Motiven: Wer ist Shell Septinos, ihr Beinahe-Mörder? Wer ist Dimsdale Boiled, die schier unüberwindliche Kampfmaschine im Dienste von Septinos? Was treibt die beiden an? Was hat die October Company damit zu tun? Ein vergeistigter Trip war das, bis zu dem Punkt, da Rune Balot das Casino von Shell Septinos betritt, um dort einen wahren Glücksspiel-Thriller zu erleben, der eine völlig neue Spannungserfahrung vermittelt hat.
Die Spannung ist also groß – wie wird sich das alles im abschließenden Band der Mardock-Trilogie auflösen? Noch immer befinden wir uns im Casino von Shell Septinos, noch immer muss Rune Balot durch geschicktes Glücksspiel an die wichtigen Eine-Million-Dollar-Chips herankommen, da auf diesen die Erinnerungen von Septinos gespeichert sind – seine Motive, seine Verbindungen zur October Company und seine ganze schmutzige Vergangenheit. Wo Rune im zweiten Band noch beim Poker und beim Roulette bestehen musste, gilt es nun, die statistischen Geheimnisse des Black Jack zu ergründen und gegen das Casino einzusetzen.
Außerdem muss Balot gegen die Anwälte der October Company bestehen und natürlich ein letztes Gefecht mit der irrsinnigen Kampfmaschine Dimsdale Boiled austragen. Die perfekte Gelegenheit also, um an der Action des ersten Bandes anzuknüpfen und die angedeuteten Tiefgründigkeiten des zweiten Bandes auszuloten.
_Schwacher Schluss einer starken Trilogie._
Auch in „Implosion“ hat es Ubukata geschafft, dem unkundigen Leser einen völlig neuen Blickwinkel auf das „Glücksspiel“ zu gewähren, und es macht einen Heidenspaß, Rune Balot beim Black-Jack-Spielen zuzusehen. Aber diesmal hat es Ubukata überstrapaziert, denn ein Kartenspiel von 213 Seiten bei einer Story von 342 Seiten ist definitiv zu lang. Natürlich bekommt Rune einen würdigen Gegner, natürlich werden ihre Fähigkeiten ausgereizt und ohne jeden Zweifel war es ganz und gar nicht einfach, dieses Kartenduell zu choreographieren, ohne die Regeln der Wahrscheinlichkeit allzu schwer zu verletzen. Aber irgendwann liest man nur noch Zahlen, liest „Hit“, „Stay“, „Bust“, „Split“ oder „Double Down“, ohne dass man Runes Strategie tatsächlich noch folgen könnte. Trotzdem reißt es einen noch mit, keine Frage, aber die Ermüdungserscheinungen bleiben nicht aus.
So freut man sich denn, dass sich während der letzten Seiten ein actionbetonter Showdown abzeichnet, aber – leider – auch dieser kommt nicht ohne Ermüdungserscheinungen aus. Wo in „Kompression“ Rune Balots Kampf gegen die fürchterliche Bandersnatch-Gang Maßstäbe gesetzt hat, mit einem atemberaubenden Actionspektakel, wie ich es in einem Buch nicht für möglich gehalten hätte, schleppt sich „Implosion“ mit einem konventionellen Zweikampf zum Ende. Noch immer ist es beeindruckend, wie Ubukata Geschwindigkeit vermittelt, wie er die Explosionen förmlich spürbar macht, aber es bleibt dennoch bei einem blassen Nachbild der Action des ersten Bandes.
Eigentlich hätte „Implosion“ ein gewaltiger Schlussakkord sein können, der einen neuen Blickwinkel auf die Ereignisse der ersten beiden Bände erzeugt, der mit neuen Ideen den Leser erneut verblüfft, der wiederum mit den Konventionen spielt und sich über sich selbst erhebt. Stattdessen erfährt der Leser nichts brüllend Neues, der Tauchgang in die Erinnerung von Septinos liefert einem nichts, was man nicht ohnehin schon vermutet hätte, und anstatt im Showdown mit den Konventionen zu brechen, liefert Ubukata schlicht und ergreifend Action-Standard.
Es ist überaus schade: Wo die ersten beiden Bände noch Hunger auf mehr machten, bricht in „Implosion“ sämtliche aufgebaute Spannung zu einem Sammelsurium aus Klischees zusammen und hinterlässt den faden Eindruck einer Story, die sich tatsächlich auf einem Bierdeckel zusammenschreiben ließe. Natürlich hat Ubukata auch hier gute Ideen verarbeitet, seine Szenen sind spritzig, rasant und kompakt – es ist nicht sein Stil, dem die Puste ausgeht, sondern die Story. Auf der Zielgeraden macht sie schlapp. Die Erwartungen werden nicht erfüllt. Unter dem Strich bleibt dennoch ein solides Zukunfts-Abenteuer, das man sich durchaus zulegen kann. Alles andere würde ja auch keinen Sinn machen, denn die ersten beiden Bände sind und bleiben unbedingt empfehlenswert! Und, na ja, schwache Trilogie-Schlusspunkte hat die Phantastik-Anhängerschaft ohnehin schon längst zu verkraften gelernt: Matrix, Fluch der Karibik, Spider-Man …
http://www.heyne.de
Briggs, Patricia – Drachenzauber
Ein Unglück kommt selten allein, sagt man. Das scheint auch für Ereignisse zu gelten, die auf harmlosere Art bemerkenswert sind. Auf jeden Fall lässt sich nicht leugnen, dass Wardwicks jüngere Schwester Ciarra gerade an jenem Tag in den Abwasserkanal von Burg Hurog geflüchtet und Wardwick auf der Suche nach ihr auf die Höhle mit den Drachenknochen und den jungen Oreg gestoßen ist, an dem sein Vater Fenwick den tödlichen Reitunfall hatte.
Nun ist Wardwick also Hurogmeten, der Herr von Burg Hurog, das heißt, er wird es sein, sobald er volljährig ist. Aber er hat kaum Zeit, das Erbe seines Vaters anzutreten. Nur wenige Tage nach der Beerdigung taucht eine entflohene Sklavin in Hurog auf, und natürlich dauert es nicht lange, bis auch ihre Verfolger vor der Tür stehen und sie zurückfordern. Als Wardwick sich weigert, die Frau herauszugeben, kommt es zum Eklat …
Charaktere
Wardwick, genannt Ward, ist idealistisch, ehrenhaft, stur und eine ausgeprägte Beschützernatur. Das macht ihn für nahezu alle, die sich um ihn sorgen, geradezu unerträglich. Er ist aber auch einfühlsam und intelligent, was zu zeigen er bisher mit großem Erfolg vermieden hat, um nicht von seinem Vater als Rivale empfunden und umgebracht zu werden. Seine hervorragend vorgetäuschte Dummheit bringt ihn allerdings auch in gehörige Schwierigkeiten, denn der Hochkönig hat eine Neigung, unliebsame Personen ins Asyl, eine Art Irrenanstalt, sperren zu lassen, und Wards Scharade bietet den dafür denkbar besten Vorwand.
Vorerst ist allerdings nicht der Hochkönig Jakoven sein Problem, sondern Kariarn, der König von Volsag. Er sammelt magische Artefakte, um seine Macht zu vergrößern, und giert deshalb nach den Drachenknochen in der Höhle unter Burg Hurog. Kariarn ist nicht unbedingt größenwahnsinnig. Wenn man sich ihm nicht widersetzt, kann er geradezu kumpelhaft sein. Das ändert aber nichts daran, dass er absolut skrupellos ist.
Jakoven dagegen ist nicht nur skrupellos und machthungrig, er ist auch grausam und tückisch. Während Kariarns Anhänger ihm aus freiem Willen folgen, benutzt Jakoven Magie, Folter und Erpressung, um sich die Menschen gefügig zu machen, wobei seine Erpressung nicht die geradlinige Art Kariarns hat, der seine Gegenüber vor die einfache Wahl stellt: Gehorsam oder Tod. Jakovens Angriff kommt immer von hinten!
Angenehm an Patricia Briggs Charakterbeschreibung ist, dass alle ihre Figuren relativ durchschnittlich geblieben sind. Beide Bösewichte sind menschlichen Grenzen unterworfen. Sie können ihre Gegner nicht durch schiere Übermacht niederwalzen, wie es die bösen, machtgierigen Zauberer in der High Fantasy gerne tun, und sind deshalb gezwungen zu taktieren und sich gewissen politischen Gegebenheiten zu beugen.
Wardwick ist zwar der vollkommene Typus eines Helden, aber auch er ist ein gewöhnlicher Mensch und beschützt die Seinen nicht, weil ein Held prinzipiell die Welt vor dem Untergang rettet, sondern weil er an den Leuten hängt, eine persönliche Bindung zu ihnen hat. Dies und die Tatsache, dass die Autorin den Hinweis auf Wards Heldentum selbst immer wieder augenzwinkernd anbringt, schüttelt jeden Gedanken an Klischee ab.
Das gilt auch für die Handlung. Der Eindruck vom Tsunami-Effekt, von der nur durch ein Wunder aufzuhaltenden, absoluten, alles vernichtenden Katastrophe, die das Gros der Fantasy so gern bemüht, fehlt hier völlig. Es sind kleinere Widrigkeiten, mit denen Ward sich herumschlagen muss, aber deshalb nicht weniger folgenreich für die Bevölkerung. Auch hier werden zwei Tyrannen gestürzt, allerdings nicht durch einen Akt überbordender Selbstaufopferung. Zugegeben, Zähigkeit gehörte durchaus zu den Eigenschaften, die nötig waren, um mit den beiden Antagonisten fertig zu werden, doch es hielt sich innerhalb der Grenzen dessen, was ein Mensch leisten kann.
Die Handlung bleibt dadurch näher am Leser. Ward ist niemand, zu dem man mit offenem Munde aufsieht, seine Geschichte keine, der man mit weit aufgerissenen Augen folgt. Diese Geschichte könnte auch einem von uns passieren. Vorausgesetzt natürlich, es gäbe ein paar nette Zutaten in unserer Welt.
Eine davon sind Drachen. Zu meiner Überraschung hielten sich diese mythischen Wesen allerdings sehr im Hintergrund. Der hauptsächlich vorkommende Drache ist Oreg, Wards Zauberer. Da Oreg aber hauptsächlich in menschlicher Gestalt unterwegs ist, neigt der Leser dazu, in ihm weniger den Drachen als den Zauberer zu sehen. Was der Faszination dieser Figur allerdings keinen Abbruch tut.
Eine weitere sind die Zwerge, die allerdings auch eher selten auftauchen. Der Hauptvertreter dieses Volkes ist Axiel, der aber wie Oreg ein Mischling ist und deshalb so menschlich wirkt, dass man seine Herkunft die meiste Zeit über vergisst.
Und dann ist da natürlich noch die Magie als solche. Angenehm ist auch hier wieder, dass selbst Oreg, mit dem kaum ein anderer Zauberer mithalten kann, nicht über unbegrenzte Fähigkeiten verfügt, sowohl im Hinblick auf die Menge der magischen Kraft, die ihm zur Verfügung steht, als auch bezüglich dessen, was er damit bewirken kann.
Mit anderen Worten, Patricia Briggs hat hier einen Roman abgeliefert, dem zwar das bombastische Weltuntergangspanorama fehlt, der aber genug Geheimnisse, Ränke, Verrat, List und Gegenlist bietet, um zu keiner Zeit Langeweile aufkommen zu lassen, dessen Charakterzeichnung wohltuend frei von Übersteigerung und Klischee bleibt, und der trotz dieser vornehmen Zurückhaltung dennoch genug Ideen bietet, um den Hauch von märchenhaftem Zauber zu entfalten, der Fantasy auszeichnet. Es hat Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen.
Noch eine positive Überraschung jenseits der Erzählkunst der Autorin bescherte dem Leser der Verlag. Zur Abwechslung wurde hier mal nicht zerstückelt – wobei man der Gerechtigkeit halber feststellen muss, dass |Heyne| nicht zu dieser Unart neigt -, sondern es wurden zwei Romane in einem Buch zusammengefasst. Die Leistungen des Lektorats waren dafür nicht ganz von der gewohnt hohen Qualität. Gelegentlich stolperte ich doch über Fehler, die nicht immer nur als einfache Tippfehler durchgehen.
Patricia Briggs schreibt bereits seit fünfzehn Jahren Bücher. Neben Einzelromanen wie „When Demons Walk“ oder „The Hob’s Bargain“ schrieb sie eine Reihe von Mehrteilern – wie die |Sianim|-Serie oder die |Raven|-Duologie – und wirkte in Anthologien mit, darunter „Silver Birch, Blood Moon“ und „On The Prowl“, das im August dieses Jahres auf Englisch erscheint. Einige ihrer Bücher sind bereits wieder |out of print|. Auf Deutsch ist bisher nur „Drachenzauber“, das die beiden Hurog-Bände beinhaltet, erhältlich. Der erste Band der Mercedes-Thompson-Serie „Ruf des Mondes“ soll im November dieses Jahres in die Buchläden kommen.
Taschenbuch 800 Seiten
Originaltitel: „Dragonblood“ und „Dragonbones“
Deutsch von Regina Winter
ISBN-13: 978-3453523098
http://www.heyne.de
http://www.hurog.com/
Andreas Brandhorst – Feuerstürme (Kantaki: Graken-Trilogie 2)
Kantaki
Andreas Brandhorst meldet sich nach langjähriger Pause mit eigenen Romanen zurück. Nachdem er sich weitgehend als Übersetzer betätigte und dabei namhafte Autoren wie Terry Pratchet, David Brin oder Scott Westerfeld übersetzte, startete er 2005 mit seiner umfangreichen und komplexen Erzählung über die Zukunft der Menschheit durch, die er durch die mysteriösen »Kantaki« einleiten ließ (siehe »Diamant«, »Der Metamorph« und »Der Zeitkrieg«). Im Herbst 2006 begann nun die neuerliche Reise in die Welt der Kantaki, die mit »Feuervögel« weit in die Zukunft der ersten Trilogie greift und ein gänzlich verändertes Machtgefüge in der Milchstraße zeigt.
Graken
Brandhorst vermeidet es gekonnt, mit den Erkenntnissen der ersten Trilogie die Eigenständigkeit des Graken-Zyklus‘ zu beeinträchtigen. Anspielungen sind natürlich vorhanden, gliedern sich aber in den Hintergrund der Geschichte, die ihren eigenen Charakter besitzt. War »Feuervögel« ein Roman, der ebenso gut hätte für sich stehen können, baut Brandhorst mit »Feuerstürme« auf diesem soliden Fundament seiner umgekrempelten Kantaki-Welt das komplexe Gewebe von Beziehungen, Geschichte, Handlung und Hintergrund weiter aus. Dieser zweite Band des Dreiteilers steht zu Recht in der Mitte und schreit nach seiner Fortsetzung.
Andreas Brandhorst
ist ein Phänomen. Für die beiden Dreiteiler hat er eine Welt entwickelt, die man sich verstrickter kaum vorstellen kann. Anhand seiner Chronik, des Glossars und der Hintergrundinformationen, die sich am Ende jedes Buches tummeln und ausführlicher noch auf seiner Homepage zu finden sind, lässt sich das Ausmaß der Vorbereitungen für die eigentlichen Romane andeutungsweise erahnen. Dabei ist noch nichts zur Kreativität der Romane selbst gesagt. Nebenbei ist Brandhorst ein viel beschäftigter Übersetzer, mehrere unterschiedlichste Romane übersetzt er jedes Jahr, deren Qualität außerordentlich ist. Und außerdem schreibt er hin und wieder einen Roman für eine große deutsche Science-Fiction-Serie, und seine Beiträge erfreuen sich regelmäßig großer Beliebtheit. Bleibt die Frage nach seinem Neurobooster, der ihm diese gedankliche und technische Geschwindigkeit und Qualität gestattet.
»Feuerstürme«
Aus der Beziehung zwischen Dominik und einer ehemaligen Tal Telassi ging ein Mädchen hervor, das in Gedenken an den jung verstorbenen Vater Dominique genannt wird. In ihr vereinen sich weit größere Kräfte als selbst in ihrem Vater. Doch seit 23 Jahren werden die Tal Telassi unterdrückt, und obwohl die Graken seither keine Aktionen mehr starteten, ist von einem Ende des Konflikts keine Rede, die Allianzen freier Welten erzielen nicht einmal Fortschritte.
Die Tal Telassi erheben sich gegen ihre Unterdrücker, genau als die Graken eine neue, weit energischere Offensive starten. Mit sogenannten Feuerstürmen greifen sie nun die Welten direkt an, benötigen keinen Feuervogel in der Sonne mehr, um das System zu erreichen. Unter ihrem neuen Druck bricht die Allianz auseinander, die Tal Telassi befinden sich in der Schnittmenge der Interessen von Militär und Graken, während Dominique auf ein altes Geheimnis trifft und den »Großen K« begegnet, und in den Randbezirken tritt ein neues Phänomen ins Bild: die Crota, höchste maschinelle Intelligenzen mit biologischen Komplexen für Kreativität und Impulsivität. Sie stellen eine Gefahr für die Graken dar, bedeuten aber für die Galaktiker noch lange keine Hilfe, da die Graken umso schneller und härter vorgehen.
Fazit
Brandhorst ist ein außerordentlicher Schriftsteller, er bereichert das Genre mit seiner Energie und seinen Geschichten. »Feuerstürme« bietet fesselnde Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem ersten Band des Dreiteilers, und es steigert die Sucht nach Brandhorstscher Weltenschöpfung. Wenn auch hin und wieder eine Szene zu technisch abgearbeitet wird, bleibt im Endeffekt das Gefühl, etwas Großartigem auf der Spur zu sein.
Der Autor vergibt: