
Douglas Adams – Der elektrische Mönch (Dirk Gently’s Holistische Detektei 1) weiterlesen

Douglas Adams – Der elektrische Mönch (Dirk Gently’s Holistische Detektei 1) weiterlesen
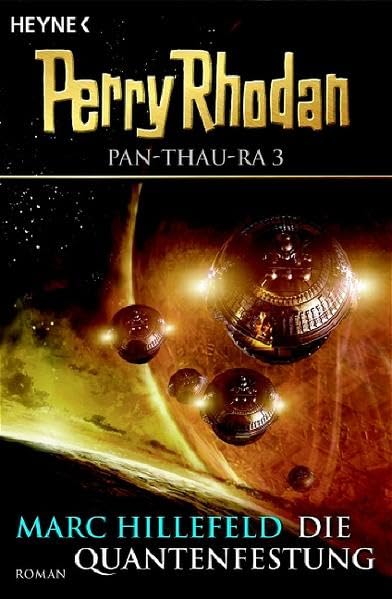
Band 2: »Die Trümmersphäre«
»Die Quantenfestung« bildet den Abschluss der dreiteiligen Spin-off-Serie PAN-THAU-RA, die in der aktuellen Handlungszeit der Perry-Rhodan-Serie angesiedelt ist und sich mit einem weiteren Aspekt der erhöhten Hyperimpedanz befasst: PAN-THAU-RA ist die Bezeichnung eines mondgroßen Raumschiffes, eines so genannten Sporenschiffes, mit dem Beauftragte der Ordnungsmächte des Universums Galaxien bereisten, um Lebenssporen zu »säen« und dem intelligenten Leben den Weg zu bereiten. Es wurde schließlich außerhalb unseres Kontinuums verankert und droht nun wieder zu erscheinen.
Das Sporenschiff ist das Ziel der Aktionen einer der beiden sich bekämpfenden Loowerfraktionen, die es erobern und mit ihm den Krieg zu den Ordnungsmächten tragen, in denen sie eine Bedrohung allen Lebens sehen. Die andere Fraktion versucht, diesen Krieg zu verhindern, da sie die Mächte als unangreifbar einschätzt und befürchtet, mit einem Angriff radikale Sanktionen erst herauszufordern.
Unglücklicherweise spielt sich der Krieg in der Milchstraße ab, wo sich Perry Rhodan mit den Menschen zwischen den Fronten findet. Da die Loower technisch hoch überlegen sind, kann er sich nicht militärisch gegen sie verteidigen, sondern muss andere Wege finden. In den vorhergehenden Romanen verschlug es Rhodan auf eine Odyssee, an deren Ende nun, im letzten Band, das Treffen mit allen ausschlaggebenden Personen des Konflikts steht.
was geht
Hillefeld, bisher noch nicht am Perryversum beteiligt, gelingt es problemlos, sich in die Materie zu vertiefen und im umfangreichen Serienhintergrund zurechtzufinden. Trotzdem ist dieser Roman der schwächste des Zyklus‘, allerdings obliegt ihm auch die undankbare Aufgabe, die Fäden der Geschichte zusammenzuführen und das Finale entsprechend zu gestalten. So beansprucht es die Geduld doch sehr, die vielen Handlungsebenen und die Sprünge zwischen ihnen anzunehmen. Die Ebene von Reginald Bull und seiner Suche nach Rhodan ist dabei die unwichtigste, jene von Julian Tifflor im Heimatsystem der Loower die gekünsteltste, Gucky ist am wenigsten nachvollziehbar, Rhodans eigene Ebene ist eher langweilig und plätschert nebenher und die Geschichte um die Biophoren ist sehr gut geschrieben, entpuppt sich aber als unwichtig und soll wohl nur das Schicksal der Betroffenen beleuchten. Natürlich geht es in Romanen immer um Schicksale, aber dieser dritte Roman der Reihe vereint so viele Schicksale in sich, dass man getrost auf das eine oder andere hätte verzichten können. Dem Autor ist darüber kein Vorwurf zu machen, er musste das Konzept zu einem Abschluss bringen und mühte sich auch redlich.
flickwerk
Über Bull erhält der Leser einen Blick von außen auf das Geschehen und auf die Probleme, mit denen sich die Menschen herumschlagen müssen. Es passt auch zu Bulls Charakter, dass er sich persönlich um die Suche kümmert, aber in einer derartigen Krisensituation würde ein politisches Gebilde wie die Liga Freier Terraner ihren Verteidigungsminister nicht mit einem schrottreifen Schrottsammler losfliegen und die Verwaltung anderen überlassen.
Tifflor trifft auf Alkyra auf eine eingesperrte Frau, die er befreit. Unumgänglich für das Konzept, aber auch unerquicklich für den Autor, der um der Spannung willen die ganze Aktion über den Roman hinziehen muss.
Gucky ist ein größenwahnsinniges, selbstüberschätzendes, mit Minderwertigkeitskomplexen beladenes Wesen, dem einstmals einer der Serienväter ein sinnvolles und liebenswertes Leben einhauchen konnte. Es erwarb legendären Ruhm und muss jetzt zwangsweise weiter durch die Serie geschleppt werden. Dabei sollte man aber immerhin auf seinen Charakter achten: Er würde sich nicht so herumschubsen lassen, wie das in diesem Roman beschrieben wird. Er ist also ein Opfer der Handlung und kommt nicht wirklich zum Zug, so dass es seinem Ansehen unter den Lesern eher abträglich sein dürfte, wie er hier eingesetzt wird.
Rhodans Handlungsebene beschränkt ihn auf die Rolle des Beobachters. Er ist Gefangener der einen Loowerfraktion und wird mitgeschleift, damit er im Finale schlaue Sprüche liefern kann.
Die Biophoren sind die eigentlichen Bewohner des Sporenschiffs und damit direkt betroffen von dem Krieg. Sie schicken ein Team, das mit Worten versuchen soll, den Krieg zu verhindern, und im Notfall die PAN-THAU-RA vernichten soll. Beides klappt nicht, aber sie bekommen ihren Frieden.
Im Endeffekt sind es zwei bisher nicht aufgetretene Wesen, die für die Beilegung des Konfliktes sorgen, und diese Tatsache ruft Widerwillen im Leser gegen die ganze Geschichte hervor. Zweieinhalb Romane lang werden Charaktere aufgebaut und meist gleich wieder umgebracht, der Krieg dient als Hintergrundspektakel für die Handlung, und dann tauchen zwei Wesen auf und befrieden die Feinde. Fertig.
Was ist mit Yun und Shon, die im ersten Roman eine interessante Rolle spielten? Das große Rätsel des ersten Romans bleibt ungelöst: Was erzählte Shon über Funk Perry Rhodan, das ihn veranlasste, die überlegene Loowerflotte anzugreifen und sich dabei selbst um ein Haar in den Tod zu stürzen? Jetzt sieht es nach einem Mittel zum Zweck aus, zu dem Zweck, Rhodan an Bord eines Loowerschiffes und in seine Odyssee zu stürzen.
Der Kinderwart des zweiten Romans ist eine sinnvoll aufgebaute Figur, über die die Beweggründe der beiden Loowerführer dargestellt wurden. Gut.
Bis zum Epilog des dritten Romans stellt sich ein unbefriedigtes Gefühl ein, das Gefühl, mit der weiten Verzweigung der Geschichte übers Ohr gehauen worden zu sein. Denn bis zum Epilog entsteht eine Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung, die das Übliche aussagt: Großer Protagonist rettet Universum vor verheerendem Krieg, danach sind alle froh, dass es vorbei ist, und gehen nach Hause, und alles ist wie zuvor. Bis zum Epilog. Denn der dreht noch einmal alles um und beendet das ausweglose Drama, das sich im Hintergrund (und leider nur dort) abgespielt hat. Er reißt zwar nicht alles heraus, was sich an Mängeln eingestellt hat, aber er ruft wenigstens am Ende noch einmal das Gefühl hervor, eine gute Geschichte gelesen zu haben.
fazit
Hillefeld meistert seine Aufgabe technisch gut und bringt in dem hervorragenden Epilog das an Stimmung und Dramatik, was dem Konzept für den Roman fehlt. Hut ab.
http://www.heyne.de
http://www.perry-rhodan.net/

Mit „Lumen“ findet Christoph Marzis „Lycidas“-Reihe nun ihren gleichzeitigen Höhe- und Endpunkt. In „Lycidas“ 1081 lernt der Leser das Waisenmädchen Emily und ihre Freundin Aurora kennen, die der Alchemist Wittgenstein unter seine Fittiche nimmt. Zusammen tauchen sie ab in die uralte Metropole unterhalb der Tunnel der Londoner U-Bahn und haben dort so manches Abenteuer zu bestehen.
„Lilih“ setzt die Geschichte fort. Wieder wandelt der Leser zusammen mit den Protagonisten durch die uralte Metropole und darf diesmal obendrein einen Ausflug in das Pariser Pendant machen, denn auch unterhalb der Pariser Métro gibt es eine uralte Metropole, in der so manches unheimliche Abenteuer auf Emily und ihre Freunde wartet.
Handlung
In „Lumen“ führt Marzi die Geschichte nun zu Ende. Seit der Handlung aus „Lilith“ sind zwei weitere Jahre vergangen, seit Beginn der Geschichte in „Lycidas“ sogar sechs. Emily ist kein Kind mehr, sondern schon fast erwachsen. Noch immer lebt sie bei Wittgenstein, nur zu ihrer Freundin Aurora scheint die Distanz größer geworden zu sein. Während Emily mit ihrem Freund Adam Stewart glücklich ist, trauert Aurora dem immer noch verschollenen Neil Trent hinterher.
Doch schon bald ereignet sich wieder Mysteriöses in der Stadt der Schornsteine. Nebel wabern durch die Straßen – sonderbare Nebel, die einen eigenen Willen zu haben scheinen. Sie machen die Menschen, die sie berühren, zu willenlosen Marionetten und bringen Furcht und Tod.
Und so machen Emily und Wittgenstein sich erneut auf in die uralte Metropole, um die Ursache der mysteriösen Nebel zu erkunden. Sie stoßen auf ein Netz aus Lügen und Intrigen, bei dem schwer zu ergründen ist, wer die Fäden zieht. Ziel des unbekannten Drahtziehers scheint es zu sein, den Konflikt zwischen den beiden großen Londoner Familien Manderley und Mushroom erneut anzufachen. London drohen neue Unruhen, die sich wie ein Flächenbrand über ganz London auszubreiten drohen. Doch wer profitiert davon?
Unsere Helden machen sich getrennt auf den Weg, das Geheimnis zu lüften und die Verschwörung auszuhebeln. Aurora macht sich mit Lilith im Limbus auf die Suche nach dem Lichtlord, während Emily mit Wittgenstein Spuren im geheimnisumwitterten Prag verfolgt. Doch die Lage spitzt sich zu und es ist ungewiss, ob Emily und ihre Freunde das bevorstehende Unheil verhindern können …
Mein Eindruck
In „Lumen“ setzt Christoph Marzi konsequent fort, was er in den ersten beiden Bänden der Geschichte angefangen hat. Raffiniert verwebt er Mythen, Sagen und Phantasie zu einer spannenden Geschichte. Man steckt als Leser schnell wieder drin in der Welt von Emily und ihren Weggefährten. Marzis Welt ist so plastisch, dass man schon auf wenigen Seiten wieder darin versunken ist.
Die einzige Schwierigkeit besteht darin, das Vergangene zu rekapitulieren. Marzis Geschichte weist eine enorme Komplexität auf und in den ersten beiden Büchern ist so viel passiert, dass man die vielen Details einfach viel zu schnell vergisst. Zwar skizziert der Autor auch in „Lumen“ wieder wichtige vergangene Ereignisse nach, wer jedoch die Lektüre der ersten beiden Bücher noch ganz frisch im Gedächtnis hat, dürfte klar im Vorteil sein.
Jedes Buch setzt einen ganz eigenen Schwerpunkt bei den Mythen, die es in die Handlung einbindet. Es macht schon den Reiz der Geschichte aus, Marzis literarische Vorbilder aufzustöbern. In „Lycidas“ sind Miltons „Das verlorene Paradies“, Neil Gaimans „Niemalsland“ und die Geschichten von Charles Dickens die offensichtlichsten Inspirationsquellen. In „Lilith“ verlegt Marzi den Schauplatz nach Paris und so tauchen dort auch andere Bezüge auf. In erster Linie zu der Gothic-Novel „Vathek“ von William Beckford.
Und so ist eigentlich auch schon mit Erwähnung des neuen Schauplatzes Prag klar, welche literarischen Vorbilder man hier trifft. Ein sehr deutlicher Bezug besteht schon aufgrund des Handlungsortes zu Gustav Meyrinks [„Der Golem“ 1205 und auch gewisse kafkaeske Züge weist der Plot hier auf. An einer Stelle begegnet Wittgenstein gar Gregor Samsa, der allen Lesern von Kafkas „Verwandlung“ noch im Gedächtnis sein dürfte.
Doch Marzi aufgrund solcher Parallelen vorzuwerfen, er würde sich einfach nur munter kreuz und quer durch die Literaturgeschichte klauen, täte ihm Unrecht. Er verheimlicht seine Vorbilder nicht, dafür sind sie viel zu offensichtlich und es macht Spaß, beim Auftauchen einer neuen Figur erst einmal zu recherchieren, woran der Name angelehnt ist.
Auch über das Einbinden anderer Werke hinaus beweist Marzi Phantasie. Sein Plot ist unglaublich lebhaft und geradezu gespickt mit den sonderbasten Figuren und Einfällen. Besonders gelungen ist ihm diesmal die Beschreibung der mysteriösen Nebel, und auch die kuriosen, vergessenen Erfindungen, deren Wege Wittgenstein und Emily im Untergrund kreuzen, sind herrlich zu lesen. Besonders weiß hier die pneumatische Untergrundbahn zu gefallen, die völlig zu Recht nie serienreif wurde.
„Lumen“ ist mehr oder weniger als ein großes Finale angelegt. Es tauchen viele längst vergessene Figuren wieder auf. Der Tod ist bei Marzi ein äußerst dehnbarer Begriff, und so gibt es so manches unverhofftes Wiedersehen. Nicht umsonst legt er seinen Protagonisten immer wieder den Satz |“Nichts stirbt jemals für immer“| in den Mund. Bei Marzi ist so gesehen fast alles möglich. Doch das bedeutet nicht, dass der Plot deswegen weniger spannend wäre. Die Art, wie Marzi Figuren wieder aufleben lässt, wirkt keinesfalls plump, sondern ist aus der Handlung heraus jeweils gut nachvollziehbar und somit nicht beliebig.
Spannung erzeugt auch stets die Ambivalenz der Figuren. Schon in den vorangegangenen Büchern hat Marzi seine Figuren nicht eindimensional oder schwarzweiß skizziert. Gut und Böse sind jeweils sehr relative Begriffe. Die beiden Lager lassen sich nicht strikt voneinander abgrenzen, und so weiß der Leser genauso wenig wie die Protagonisten, wem man vertrauen kann und wem nicht. Das erhöht die Spannung enorm, zumal es für Emily und ihre Weggefährten in diesem Band nun endgültig auf einen Kampf auf Messers Schneide hinausläuft. Nie zuvor schien das Schicksal der Welt an einem so dünnen Faden zu hängen wie diesmal.
Auf Ebene der Protagonisten gibt es ein paar Veränderungen. „Lilith“ endet auch damit, dass eine liebgewonnene Figur aus der Handlung ausscheidet, die eine große Lücke hinterlässt. An dessen Stelle tritt der Alchemist Tristan Marlowe, der sich in Sachen Charme zwar nicht mit seinem Vorgänger messen kann und der damit auf der Sympathienskala recht weit unten rangiert, der aber durch seine Undurchsichtigkeit seinen Reiz hat.
Die Figurenentwicklung hat in den Vorgängerwerken wenig Raum. Zu sehr muss Marzi sich auf die Handlung konzentrieren, als dass er dafür wirklich genügend Zeit gehabt hätte. In „Lumen“ holt er diesbezüglich einiges nach. Wittgenstein öffnet sich Emily, und so erfahren wir einiges über seine Vergangenheit. Er wird dadurch menschlicher und greifbarer, wenngleich eine gewisse kühle Distanz dennoch bestehen bleibt. Auch für Emily und Aurora gibt es etwas Zeit für persönliche Dinge. Die beiden Mädchen würzen die Handlung mit einer Prise Romantik, was dem Plot durchaus gut tut.
Was immer noch stört (wenngleich nicht mehr so sehr wie zu Beginn der Reihe), ist die immer noch sonderbare Erzählperspektive. Wittgenstein tritt als Ich-Erzähler auf, dennoch wird der Plot in unterschiedliche Erzählebenen gesplittet und es gibt schon dadurch einen übergeordneten, allwissenden Erzähler, der im Konflikt zum Ich-Erzähler steht. Das wirkt in meinen Augen etwas unausgereift und so, als wäre bei der Wahl der Erzählperspektive irgendetwas falsch gelaufen. Doch nach zwei Büchern stört das im dritten Buch nun nicht mehr ganz so massiv wie noch zu Anfang.
Unterm Strich
Alles in allem ist „Lumen“ ein durchaus gelungenes Finale, das zwar einerseits bis zum Rand vollgestopft mit Handlung ist (schon fast ein bisschen viel des Guten), andererseits aber endlich auch mal den Figuren etwas mehr Raum gibt. „Lumen“ ist wie zuvor schon „Lycidas“ und „Lilith“ ein ausgesprochener Lesegenuss. Der Plot ist spannend und unglaublich phantasievoll erzählt. Marzis Stil ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber gleichsam gewitzt wie farbenprächtig, und so hält man mit „Lumen“ ist stimmiges Finale einer gelungene Fantasyroman-Serie in Händen – komplex, spannend und voller ambivalenter Figuren.
Taschenbuch: 800 Seiten
ISBN-13: 978-3453810815
http://www.christophmarzi.de/
http://www.randomhouse.de/heyne
Der Autor vergibt: 




Stephen King – Brennen muss Salem weiterlesen
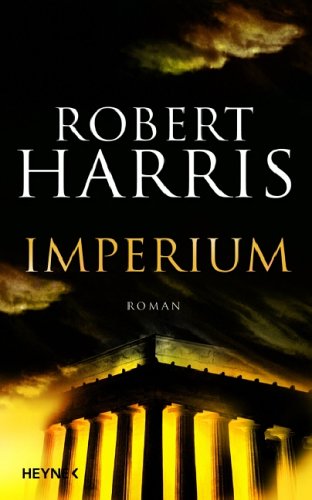
Dr. Cherijo Grey Veil, Tochter des angesehenen und berühmten Joseph Grey Veil, möchte nur noch fliehen. Weg von Terra, und vor allem weg von ihrem tyrannischen Vater, dessen Einfluss sie nicht mehr länger ertragen kann. Während eines Bar-Besuchs lernt sie den Piloten Dhreen kennen, der mit seinem Schiff alsbald nach Kevarzangia Zwei reist und anbietet, die junge Ärztin mitzunehmen. Cherijo willigt ein und startet gemeinsam mit ihrer Hauskatze Jenner auf dem Kolonieplaneten ein völlig neues Leben.
Nahe Zukunft:
Die irdische Zivilisation hat sich merklich gewandelt. Die uns bekannten politischen Verhältnisse sind weitgehend in Auflösung begriffen oder regressiv, so gibt es im Osten eine Neuauflage des Kommunismus mit KGB, und die USA haben ihren Status als führende Weltmacht eingebüßt.
In der Gesellschaft ist ein ausgeprägter Trend zum Cyberspace zu bemerken; so hat jeder fortschrittliche Mensch ständig Zugriff auf das Internet, sei es über Konsolen oder Brillen, die ihre Informationen direkt in das Sichtfeld des Benutzers einblenden. Microsoft ist aus dem Rennen, nur die russischen Kommunisten setzen noch auf ihre Software, nach dem Motto „Was ich bezahlen muss, ist auch höchster Standard“. Doch ansonsten überwiegt die open source und es bilden sich idealistische Gruppierungen, die auch das Leben zu einer echten open source machen wollen. Ihr Vorreiter ist Manfred.
Manfred besitzt eine Datenbrille von höchster Bandbreite, die ihn ständig mit den aktuellsten Informationen konfrontiert. Aus diesem Brei filtert er für sich Interessantes heraus und fügt es seinem externen Speicher hinzu, der sein Gedächtnis erweitert. Er ist ein Infonaut, der seine Informationen an Kunden verschenkt, die es möglicherweise interessieren könnte. Außerdem entwickelt er aus dem Gehalt seiner Recherchen ständig profitable Ideen, die er sofort patentieren lässt und einer Stiftung für freies Gedankengut zur Verfügung stellt, die alle neuen Ideen zu open source macht.
Manfred besitzt sozusagen keinerlei Zahlungsmittel. Aber seine genialen Ideen, die er weltweit verschenkt, um andere Leute reich zu machen, verschaffen ihm eine Kreditwürdigkeit, die allgemein kaum noch zu übertreffen ist. Daraus folgt für ihn, dass er ständig und an jedem Ort der Welt von irgendeinem durch ihn reich gewordenen Menschen oder einer Firma gesponsort wird.
Mit dem Upload einer Hummerspezies in den Cyberspace nimmt die Entwicklung eine neue Richtung an: Im Netz existiert nun eine künstliche Intelligenz, basierend auf den Neuronen der Hummer, die sich an Manfred wendet. Er kann auch ihr zu Menschenrechten verhelfen und schafft damit einen Präzedenzfall, der in der Zukunft der Menschheit noch eine bedeutende Rolle spielen wird, denn im Zuge ihres Strebens nach einem Leben nach dem Tod nehmen ab nun immer mehr Menschen die Möglichkeit eines Uploads in Anspruch.
Damit erhält auch die Raumfahrt neuen Aufwind. Durch die Möglichkeit, Massenspeicher in Form von Miniaturraumschiffen zu den Sternen schicken zu können – als Passagiere hochgeladene Zustandsvektoren von den betreffenden Menschen – erhält diese Form der Reise mehr Effizienz als bis dato vorstellbar. Manfreds geschaffener Präzedensfall bezüglich der Menschenrechte einer KI treibt einen Rückgang der realen Bevölkerung voran und fördert den Zuwachs künstlicher Intelligenzen. Um die Informationsdichte des Sonnensystems bestmöglich auszunutzen, beginnt eine neue Art der Eroberung: Die solaren Planeten werden – beginnend mit Merkur – abgebaut und zu Nanorechnern umstrukturiert, die in einer Wolke um die Sonne kreisen. Damit steigt die Informationsdichte – MIPS, Millionen Informationseinheiten pro Sekunde – rapide an. Die innerste Schale der Wolke nutzt die direkte Sonneneinstrahlung als Energie, ihre Abwärme wird von der nächsten Schale genutzt und so weiter: Eine Dyson-Sphäre entsteht.
Manfreds Tochter macht sich derweil auf, einer außerirdischen Form von systemumfassender Dysonsphäre auf die Spur zu kommen, und lädt sich mit ihren Freunden in das System eines galaxisumspannenden Netzwerks hinein. Sie stellt fest, dass dieser Weg eine ebensolche Sackgasse ist wie die Beschränkung auf einen Planeten …
„Accelerando“ erzählt die Geschichte einer Familie auf dem Weg in die Zukunft, eine Zukunft, die rasanter auf die Menschheit zugestürmt kommt als für möglich gehalten wird. Stross schreibt von einer Singularität, einem Ereignis, nach dem sich die Menschheit in eine Richtung entwickelt, die ein Mensch vor Eintreten des Ereignisses nicht hätte vorhersehen können. Er lässt seine Protagonisten auch darüber spekulieren, zu welchem Zeitpunkt diese Singularität anzusiedeln ist. Möglichkeiten findet er einige: Die Inbetriebnahme des Internet, den erfolgreichen Upload der Hummer und weitere, nicht nur aus seiner Fantasie entspringende Ereignisse aus der Geschichte der Menschheit.
Die beobachtete Familie erlebt diese Entwicklung aus verschiedenen Perspektiven mit, ist unterschiedlich involviert. Manfred zum Beispiel ist in hohem Maße mitverantwortlich für Teile des Geschehens, und ihm, als äußerst schnelllebigem Mann, immer auf der Jagd nach Informationen, fällt ein großer Teil der Last des Fortschritts zu, des Zukunftsschocks, den diese Entwicklung mit sich bringt. Zu einem Zeitpunkt, als er noch auf seine Brille beharrt, hat sich in der Bevölkerung bereits der Einsatz von Implantaten durchgesetzt, die ihr eine viel größere Bandbreite bieten, als es äußeren Hilfsmitteln ohne direkten Zugang zum Hirn eines Menschen möglich ist.
Es ist ein Fortschritt, der nicht einmal vergleichbar ist mit dem Fortschritt von der ersten bewussten Feuermachung bis zum alltäglichen Gebrauch des Internet, denn er richtet sich nicht nur auf die äußeren Lebensbedingungen, sondern in größter Weise auf das Innere, den Informationsgehalt der Seele eines Menschen. Und im Hintergrund steht immer die Idee, dass es eine intergalaktische Sphäre, einen Cyberspace gibt, in dem sich die hochstehenden Zivilisationen tummeln. Trotzdem stimmt diese Idee den Autor nicht optimistisch, sondern er nutzt sie, um den absoluten Weg in den Cyberspace ad absurdum zu führen. Denn wie oben erwähnt, ist Stross klar, dass der eigentliche Weg der Menschheit nicht vorhersehbar ist, durch eine Singularität vom Vorstellungsvermögen der präsingularen Menschen getrennt. Er führt die Idee der Dyson-Sphäre bis zum apokalyptischen Ende und sägt damit an einer Vorstellung, die in vielen Science-Fiction-Lesern vorherrscht: Die Erde als Heimat der Menschheit fiele diesem Fortschritt zum Opfer und geht in seiner Vision sogar weitgehend unbeachtet den Weg in ihre Einzelteile.
Was bei diesem Roman noch stärker als bei den anderen beiden in Deutschland veröffentlichten Romanen deutlich wird, ist Stross‘ umfassende Recherche und seine ebenso umfassende Allgemeinbildung. Er handhabt kulturelle und gesellschaftliche Details aus vielen verschiedenen Ländern und Bereichen mit einer Selbstverständlichkeit, die zumindest suggeriert, dass sie zu seinem Wortschatz und seinem Wissensspeicher gehören. Das macht es dem Leser in manchen Fällen natürlich schwer, seinen Gedanken zu folgen. Es bleiben immer Details, die ohne eigene Recherche nicht einordenbar sind, aber im Grunde sind all diese Dinge ohne Belang für das Verständnis der eigentlichen Geschichte, die sich sehr spannend und unterhaltsam vor dem Leser ausbreitet. Relevante Begriffe benutzt er dagegen entweder sehr häufig oder erklärt sie im Folgenden ausreichend, um zumindest eine Vorstellung vom Sachverhalt zu vermitteln, die den Leser zufrieden stellt und dem Lesefluss nicht im Weg steht.
Natürlich ist der Roman schon an sich für Leser, die entweder ganz andere Interessengebiete haben oder deren erster Ausflug in das utopische Genre dieser Roman ist, schwer verdaulich. Glücklicherweise hat es diese Thematik auf der Kinoleinwand zu einem breiteren Publikum gebracht als auf Papier; gerade in diesen Jahren wurden einige hochwertige SF-Romane verfilmt. Es fällt also kaum jemand völlig unbedarft ins kalte Wasser, denn gerade die Cyberspace-Thematik ist spätestens seit „Matrix“ allgemein zugänglich.
Bemerkung
Durch die Gestaltung des Layouts suggeriert Heyne, „Accelerando“ wäre ein weiterer Roman aus dem Universum des Eschaton und würde in irgendeiner Weise in Verbindung zu „Singularität“ und „Supernova“, den beiden vormals erschienenen Romanen von Charles Stross, stehen. Hier muss gewarnt werden, denn trotzdem durchaus das Eschaton erwähnt wird, steht „Accelerando“ völlig eigenständig da und hat keinerlei Beziehung zu den oben genannten Romanen. Marketing.
„Accelerando“ ist meiner Meinung nach der bisher beste Roman von Stross und ein Highlight des Jahres 2006. Er birst vor Ideen und zieht den Leser in seinen Bann. Er leidet weder unter seiner Komplexität, die auch nur den Hintergrund der Geschichte bildet, noch wirkt er überladen. Es scheint ein Merkmal Stross’scher Schreiberei zu sein, dass jeder seiner Romane fast unter Ideenüberschuss leidet. Charles Stross schreibt einen Roman mit einem Hintergrund, auf dem andere Autoren ihre gesamte Karriere aufbauen würden – und das macht er jedes Mal so.
Der Autor vergibt: 




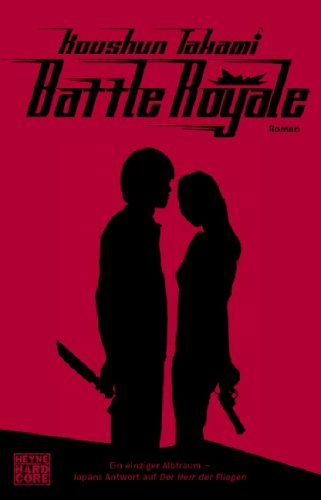
Koushun Takami – Battle Royale weiterlesen
Auf jeder Schule gibt es sie: Die Schülerinnen, die heimlich für diesen einen niedlichen Referendar oder Lehrer schwärmen. Diese Konstellation hat die Australierin Emily Maguire genutzt, um daraus ein ganzes Buch zu entwickeln. Allerdings geht sie in „Zähme mich!“ einen ganzen Schritt weiter …
Sarah Clark ist vierzehn, als ihre erotische Beziehung zu Mr. Carr beginnt. Er ist ihr Englischlehrer und verheirateter Vater, sie ist eine kleines Mädchen, das sich schwer in seinen Lehrer verliebt und von Sex nicht genug kriegen kann. Zwei Jahre lang treffen sie sich jeden Nachmittag und Sarah erlebt die Wonnen der Liebe, während sie gleichzeitig eine Menge über Shakespeare lernt.
Bareneed ist ein Städtchen an der neuenglischen Atlantikküste, das seinen Namen – „Blanke Not“ – inzwischen zu Recht trägt. Die einst blühende Fischerei liegt am Boden, seit die schier unendlichen Kabeljau-Schwärme verschwunden sind. Arbeits- und Hoffnungslosigkeit machen den Bewohnern zu schaffen, Alkoholismus und häusliche Gewalt sind die Standarddelikte, wenn Polizist Brian Chase zum Einsatz ausrückt.
Seit kurzem geht zusätzlich das Gespenst einer unbekannten Seuche um. Kerngesunde Männer und Frauen leiden unter Attacken mörderischen Jähzorns, stellen plötzlich das Atmen ein und sterben; eine Ursache können die Ärzte nicht finden. Erst noch unbemerkt, dann immer offener mischen sich bewaffnete Soldaten ins Stadtbild. Sie scheinen Bareneed zu bewachen und seine Bürger an einem Verlassen des Orts zu hindern. Kenneth J. Harvey – Die Stadt, die das Atmen vergaß weiterlesen
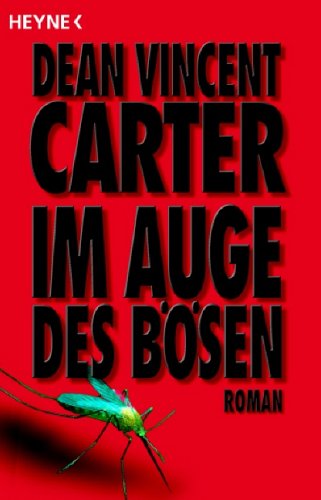
_Lesers Freud ist ESAs Leid._
Die European Space Agency hat mit Alastair Reynolds nämlich einen Astrophysiker verloren, der sein Know-How lieber in faszinierenden Science-Fiction-Storys unterbringt, als sie in Fachpapieren zu veröffentlichen. Mittlerweile lebt der vierzigjährige Waliser in Norwegen und widmet sich voll und ganz seinem Schriftsteller-Dasein. Veröffentlicht hat er bisher sechs Romane, von denen fünf beim |Heyne|-Verlag erschienen sind: „Unendlichkeit“, „Chasm City“, „Die Arche“, „Offenbarung“ und eben „Ewigkeit“. Dazu sei gesagt, dass sich alle Romane (und der Kurzgeschichtenband „Träume von Unendlichkeit“), im „Revelation Space“ Universum abspielen. Bis auf „Ewigkeit“. Nun denn.
_Slasher gegen Stoker._
Wir befinden uns im 23. Jahrhundert. Die Erde ist unbewohnbar geworden nach dem so genannten „Nanocaust“. Alle Aufzeichnungen und Datenspeicher wurden dabei gelöscht und den Menschen ist damit die eigene Geschichte verloren gegangen. Wegen dieses Ereignisses haben sich die Überlebenden in zwei ideelle Gruppen aufgespalten: Die Stoker, welche technischen Weiterentwicklungen nur mit höchster Skepsis entgegentreten, und die Slasher, die behaupten, die Wiederholung einer solchen Katastrophe könne nur dadurch verhindert werden, dass man den technischen Fortschritt vorantreibt, so schnell es nur geht.
Jedenfalls zanken sich jene Gruppen um die Erde und die Geschichte, die unter ihren eisigen Massen begraben liegt. Verity Auger ist Archäologin der Stoker und lebt ihre Wut gegen die Slasher mit Inbrunst aus. Dumm nur, dass sie auf einer Ausgrabungsexpedition das Leben eines jungen Mannes aufs Spiel setzt und deswegen vor die Wahl wenig wünschenswerter Alternativen gestellt wird: das Exil – wenn nicht sogar die Todesstrafe – oder eine gefährliche, hochbrisante Geheimmission. Nicht schwer zu erraten, für welche Alternative Verity sich entscheidet.
Und die zweifelhaften Freuden wollen nicht enden. Ausgerechnet ihr Ex-Mann ist einer der Hauptkoordinatoren der Mission. Er hat sich mit der Erforschung des Hypernetzes befasst, einem brachliegenden Transportnetz, das von einer fremden, verschollenen Rasse errichtet wurde, und bei diesen Erkundungen ist ihm eine Art Kapsel aufgefallen, die einen Planeten enthält, der verdächtig nach der Erde aussieht. Tatsächlich ist dem auch so, eine Erde, deren Zeitrechnung sich gerade im Jahr 1959 befindet, auf der es keinen zweiten Weltkrieg gegeben hat und auf der die technologische Entwicklung aus diesem Grund noch nicht so weit vorangeschritten ist.
Verity Auger wird aber nicht die erste Reisende sein, die sich auf diese mysteriöse Zwillingserde begibt. Vor ihr hat Susan White die Expedition ins Unbekannte angetreten, um Informationen zurückzuschicken, vor allem Schallplatten, Zeitungen und Bücher. Über die genauen Motive von Susans Forschungen wird Verity nicht eingeweiht, wohl aber, dass sie ermordet wurde und einen Packen handschriftlicher Korrespondenz zurückgelassen hat, deren Beschaffung Veritys ausgemachtes Ziel sein wird …
_Der Detektiv und die Büchse der Pandora._
Was uns zum zweiten Handlungsstrang führt. Parallel-Erde, Paris, im Jahre 1959: Wendell Floyds Detektei leidet unter chronischer Auftragsarmut, und so nimmt er sich gezwungenermaßen eines Mordfalls an; nämlich dem von Susan White. Der Vermieter der jungen Frau will nicht an Selbstmord glauben und gewährt dem Privatdetektiv Zutritt zur Wohnung und allem, was er wissen muss. Neben dem seltsamen Drang, Schallplatten und Bücher aus Paris herauszuschaffen, will sich nichts Verdächtiges zeigen, nur ein scheinbar defektes Radiogerät und eine Enigma-Maschine erwecken den Verdacht des Schnüfflers. In einem Frankreich, das unter aufkeimendem Faschismus zu leiden hat, wird einer Leiche mit derartig zweifelhaftem Besitz sofort der Spion-Stempel auf die verstorbene Stirn gedrückt. Fall erledigt, eigentlich. So richtig wollen sich die Fakten aber nicht ineinander fügen. Dazu waren Susans internationale Kontakte zu mannigfaltig, die Objekte ihrer Nachforschungen zu abstrus und ihre Briefkorrespondenz zu seltsam. Noch dazu taucht da plötzlich eine junge Frau auf, die diese Briefe für sich beansprucht. Ihr Name, erklärt sie Wendell Floyd, sei Verity Auger.
Von da an schaukeln sich die Dinge hoch. Die faschistisch unterwanderte Polizei macht Floyd die Nachforschungen zur Hölle, er wird verfolgt und Verity Auger ist bei weitem nicht diejenige, für die sie sich ausgibt. Er findet keine Lösungen bei seinen Nachforschungen, sondern immer verstörendere Fragen, unheimliche Kinder lauern an den Orten seiner Ermittlungen und allmählich wird klar, dass er eine Verschwörung aufzudecken im Begriff ist, die nicht nur für seine Welt verheerende Auswirkungen hätte …
_Science Fiction Noir._
Das ist John Clutes Bezeichnung für das, was Alastair Reynolds hier abgeliefert hat, und der Begriff sitzt. Auf der einen Seite haben wir die klassische Detektiv-Geschichte, auf der anderen Seite haben wir den Entwurf einer Gesellschaft, deren Geschichte abhanden gekommen ist und deren Splittergruppen sich in kalten und heißen Kriegen aufreiben. Reynolds hat diese beiden Extreme sehr gekonnt miteinander vermengt und die Stimmungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, tatsächlich unter einen Hut gebracht.
Dabei streut er seine Informationen geschickt aus. Ständig ist man selbst am Grübeln, welche Hintergründe Susan Whites Tod denn nun haben könnte. Spannung ist außerdem ein wichtiges Element: Auf der einen Seite haben wir französische Nazi-Soldaten, die Wendell Floyd ans Leder wollen, auf der anderen Seite muss sich Verity Auger beeilen, diese Parallelwelt zu verlassen, denn die Hypernetz-Verbindung, durch die sie in ihre Welt zurückkehren kann, ist von äußerst instabiler Struktur. Pulverdampf und ins Gesicht gezogene Polizeihüte gibt es also genauso wie atemberaubende Verfolgungsjagden durch das hochfaszinierende Hypernetz.
Es gibt Spionage und Verrat, Intrigen und unerwartete Verbündete, es gibt abgefahrene Zukunftsentwürfe, beeindruckende Technologien und Gedankenexperimente auf Hardcore-Niveau. Dabei verschwimmen die Figuren nicht zu Statisten hinter einem astrophysikalischen Ideengebilde, im Gegenteil: Verity Auger hat eine wunderbar zynische Art und ist mit einer riesigen Klappe gesegnet, die sie in pfiffigen Dialog-Duellen gnadenlos einsetzt. Ihre Vorurteile gegen die Slasher fußen alleine auf Sturheit, und dementsprechend fällt es ihr so gar nicht leicht, dass ihr Schicksal mehr als einmal von diesen hochgezüchteten Techno-Großkotzen abhängt. Der Leser hat natürlich seinen Spaß dabei.
Wendell Floyd dagegen ist ein Detektiv, wie er im Buche steht. Obwohl ihm Verity von Anfang an sympathisch ist, denkt er gar nicht daran, über die Lücken in ihrer Geschichte hinwegzusehen, und fühlt ihr ständig auf den Zahn, trifft auch einen Nerv nach dem anderen dabei und bleibt selbst dann am Ball, als ihm aufgeht, dass die komplette Wahrheit nicht unbedingt seine bevorzugte Geschmacksrichtung haben dürfte.
Jedenfalls liest sich die 800-seitige Schnitzeljagd wie im Flug. Zwar kann man manche Hintergründe erraten, wenn man sorgfältig genug nach Indizien Ausschau hält, aber das spricht ja nur für eine gewissenhaft gebastelte Storyline, die auf erzwungene Wendungen verzichtet. Und wenn sich dann das Geheimnis hinter allem offenbart hat, zieht die Spannungskurve noch mal so richtig an, besonders der Flucht durch das instabile Hypernetz wird alles an Spannungspotenzial abgewrungen – intensiv!
Reynolds ist mit „Ewigkeit“ ein flockiger, unverkrampfter Wanderer zwischen den Welten geglückt. Im wahrsten Sinne des Wortes: Parallel-Welt-Roman, Science-Fiction und Detektiv-Thriller vereinigen sich zu einem kurzweiligen Lesevergnügen, das auch mit augenzwinkernden Anspielungen nicht hinterm Berg hält – Slasher-Roboter etwa, die stolz darauf sind, nicht nach den Asimovschen Gesetzen programmiert worden zu sein. Ein erfrischender Genremix, den man sich guten Gewissens auf den Einkaufszettel pinseln kann.
http://www.heyne.de
|Ergänzend unsere Rezensionen zu:|
[„Unendlichkeit“ 503
[„Chasm City“ 540
[„Die Arche“ 541
Die Schwestern Kimberly und Thelma sowie ihre Gatten Keith und Wesley haben ihrem Schwiegervater, dem reichen Geschäftsmann Andrew Collins, und seiner Ehefrau Billie zum Geburtstag eine Seereise nach den Bahamas geschenkt. Sie kommen mit und haben auch die jüngste Tochter Constance sowie deren Freund Rupert Conway eingeladen.
Die Reise endet katastrophal: Während sich die Familie und Rupert auf einer unbewohnten Insel tummeln, fliegt die Jacht, auf der sie reisen, samt ‚Kapitän‘ Wesley in die Luft. Die Überlebenden sind ohne Funkgerät gestrandet. Niemand weiß, wo sie sich aufhalten, was eine Suche stark erschweren oder gar unmöglich machen wird.
Andrew, ein ehemaliger Offizier, übernimmt das Kommando. Seine Familie ist nur bedingt kooperativ; interne Spannungen sorgen für ständige Streitereien. Den Ernst des Schiffbruchs blendet man aus. Er ist ohnehin von nebensächlicher Bedeutung, wie sich herausstellt. In der Nacht verschwindet Keith spurlos; Rupert findet ihn später: Er hängt mit eingeschlagenem Schädel und einem Strick um den Hals an einem Baum.
Panik bricht aus. Wer hat Keith umgebracht? Lauert ein Killer auf der Insel? Ist es womöglich einer der Schiffbrüchigen? Hässliche, bisher sorgfältig verschwiegene Tatsachen kommen ans Tageslicht. Die Familie Collins ist einander nicht gerade grün. Andrew ist ein Patriarch, der seine Schwiegersöhne verachtet, die er – wohl zu Recht – verdächtigt, vor allem das Familienvermögen geheiratet zu haben.
Ist Wesley wirklich bei der Explosion umgekommen? Plant er Andrew und seine Familie nach und nach umzubringen, um dann das Collins-Erbe anzutreten? Arbeitet Gattin Thelma mit ihm zusammen? Viele Fragen tauchen auf, die es rasch zu klären gilt, denn der Killer legt keine Pause ein …
Die Welt ist einfach (und schlecht)
Viel Potenzial scheint Laymons Geschichte eigentlich nicht zu besitzen. Der Verfasser erzählt sie zudem in sehr einfachen Worten und geradlinig. Die Anzahl der möglichen Plotvarianten scheint begrenzt. Aber man darf sich nicht täuschen lassen. Laymon entpuppt sich als Meister im Legen falscher Fährten. Der Purist wird ihm im Verlauf der Lektüre faule Tricks vorwerfen, denn Laymon schreckt nie davor zurück, das Plotgerüst dreist ins Wanken zu bringen.
Plötzlich bringt er völlig neue und unerwartete Elemente in die Handlung ein. Unsere Vermutungen darüber, wer oder was sich hinter dem mörderischen Geschehen verbirgt, werden ad absurdum geführt: Der Verfasser legt uns aufs Kreuz, was freilich sein gutes Recht ist, zumal es funktioniert und der Handlung, die im Mittelteil gefährlich ins Schlingern gerät, eine neue Richtung gibt und belebt.
Dies ist außerdem ein weiterer der verfassertypisch garstigen Thriller, die mit der Geschwindigkeit und Unaufhaltsamkeit eines umstürzenden Mülleimers über seine Leser kommt. Man könnte den Plot minimalistisch nennen, denn er bedient sich einer Kulisse, die man durchaus als Klischee bezeichnen kann: die einsame Insel, umgeben vom Meer, das sich weder überqueren noch Rettung erwarten lässt. Freilich funktioniert diese Umgebung vorzüglich als Labor, in dem sich unter kontrollierten Bedingungen allerlei Experimente durchführen lassen.
Wieder einmal der Herr der Fliegen
Hier geht es um eine isolierte Gruppe von Menschen, die sich einer unbekannten Gefahr ausgesetzt sehen. Hinzu kommt die Tatsache der Strandung, ein Faktor, der den Stress der Situation erhöht, da niemand kommen wird, um die Versuchskaninchen vor brenzligen Situationen zu bewahren. Im Gegenteil: Der Ernst der Lage, d. h. in diesem Fall der Tod einiger oder sämtlicher Beteiligten, ist fest im Szenario einkalkuliert.
Das dritte und nicht geringste Problem ist die Uneinigkeit der Gestrandeten. Sie kennen einander seit Jahren und tragen viele ungelöste Konflikte mit sich herum. In der Zivilisation gibt es die Möglichkeit, einander aus dem Weg zu gehen. Auf der Insel wird man zu Nähe und Kooperation gezwungen. Allerdings stellt sich heraus, dass die verdrängten Probleme allzu groß sind; nicht einmal die unmittelbare Not, die Bedrohung durch einen unsichtbaren Killer kann für Abhilfe sorgen. Dass die Gruppe so rasch auseinander- und dann dem Mörder zum Opfer fällt, beruht vor allem auf den ständigen Streitigkeiten, die für eine Spaltung der Gruppe sorgen, deren Mitglieder so angreifbarer werden.
Wer Laymon und sein Werk kennt, wird nicht enttäuscht bzw. die bekannten Elemente finden. Der Autor nennt die Dinge beim Namen. Streit, Kampf, Folter und Mord finden selten im barmherzigen Zwielicht statt. Laymon richtet den Scheinwerfer auf die richtig hässlichen Dinge und schildert sie mit der ihm eigenen brutalen Deutlichkeit. „Gewaltpornografie“ nennen das seine Gegner und verdammen ihn; sie scheinen in ihrer Argumentation zu verdrängen, dass Pornografie primär Unterhaltung sein soll. Die Gewalt bei Laymon hat indes gar nichts Unterhaltsames an sich; sie ist schmutzig, blutig und eklig.
Die eigentliche Kritik richtet sich deshalb eher gegen die Tatsache, dass Laymons hässliche Schmuddelgeschichten spannend sind. „Die Insel“ gehört zwar nicht zu den besten Werken seines Verfassers, doch hat man sich erst eingelesen, will man auf jeden Fall wissen wie es weiter- und ausgeht. Ist das nicht ein praktikabler Maßstab für den Unterhaltungswert einer Geschichte?
Der Held als Widerling
Für die betont simple Sprache gibt es eine gute Begründung: „Die Insel“ ist kein ‚richtiger‘ Roman, sondern ein Tagebuch, das Rupert Conway über seine Tage als Schiffbrüchiger führt. Er ist ein 18-jähriger Mann, der weder wirklich erwachsen noch geistig eine Leuchte ist. Das gilt es berücksichtigen, wenn Rupert schreibt. Überhaupt darf nie vergessen werden, dass wir die Ereignisse stets durch den Filter der Rupertschen Schreibe erleben. Können wir ihm trauen? Er beteuert mehrfach die Wahrheit seiner Darstellung, doch da ist Ruperts Plan, seine Aufzeichnungen als Grundlage für einen späteren Roman zu nutzen. Er manipuliert also auf jeden Fall. Geht er so weit zu lügen, Geschehnisse zu verschweigen, zu verdrehen?
Rupert ist definitiv kein in sich ruhender Charakter. Er steckt noch tief in der Pubertät, ist mit mehreren attraktiven, chronisch leicht bekleideten Frauen auf einer Insel gefangen. Bald sind deren Ehemänner verschwunden; Rupert hat also theoretisch freie Bahn. Seine Gedanken kreisen unentwegt um Sex, nicht einmal Lebensgefahr und Tod können das ändern. Dieser Wesenszug lässt Rupert unsympathisch erscheinen. Er ist allerdings auch eine fabelhafte Tarnung für mögliche andere, finstere Beweggründe.
Mit Rupert auf der Insel sitzt der Collins-Clan fest, eine wahrlich schrecklich nette Familie, die hinter der polierten Oberschicht-Fassade nichts als Lügen, Intrigen, Unterdrückung und sogar Wahnsinn verbirgt. Die Isolation zwingt sie zusammen, die Tünche wird abgewaschen, die sorgsam unterdrücken Gefühlen brechen sich Bahn.
Das Element der Verunsicherung
Wer ist Täter, wer Opfer? Nicht nur Rupert wird in tiefe Verwirrung gestürzt. Immer wieder wechselt Laymon die Perspektiven. Scheinbar Tote tauchen quicklebendig wieder auf. Welches Spiel wird hier gespielt? War der Schiffbruch von Anfang an Teil einer irrsinnigen Familienintrige? Geschickt kappt Laymon jegliche Möglichkeit die Protagonisten in ‚Gut‘ und ‚Böse‘ einzuteilen. Er ist es, der allein die Fäden in der Schreibhand behält. Erst im Finale fallen die Masken.
Dabei hätte der Verfasser sicherlich raffen können. Vor allem im Mittelteil verzettelt sich Laymon in Streitigkeiten und Verfolgungsjagden, die letztlich Leerlauf darstellen, weil sie die eigentliche Handlung nicht voranbringen. „Die Insel“ ist ein rohes Werk, das über weite Strecken wie vom Verfasser ohne Nachbearbeitung zusammengehauen wirkt. Das mag gewollt sein, dürfte jedoch die Realität widerspiegeln, denn Laymon war ein überaus schreibfreudiger Schriftsteller, der in manchen Jahren vier Romane und zahlreiche Kurzgeschichten auf den Markt brachte. Man muss seinen ‚primitiven‘ Stil mögen, sonst wird man ihn ablehnen, was schade wäre, denn solange er seine Obsessionen im Griff behielt, konnte dieser Mann sein Garn spinnen, auch wenn es ziemlich blutig zu sein pflegte – oder man ihn ließ: In Deutschland dauerte es einige Zeit, bis die üblichen Tugendapostel auf Laymon aufmerksam wurden. Ab der 13. Auflage der „Insel“ schritt die Zensur (hier unter dem Deckmantel der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften) ein und ließ nicht wenige Passagen streichen oder ‚abschwächen‘ – eine Information, die Leser berücksichtigen sollten, wenn sie Lektüre ohne Fremdeingriffe vorziehen.
Autor
Richard Carl Laymon wurde 1947 in Chicago, Illinois, geboren, wo er auch aufwuchs. Ein Studium in Englischer Literatur begann er an der Willamette University, Oregon, und schloss es mit einem Magistertitel an der Loyola University, Los Angeles, ab. Anschließend arbeitete Laymon u. a. als Schullehrer, Bibliothekar sowie Rechercheur für eine Anwaltskanzlei.
Als Schriftsteller debütierte Laymon 1980 mit den Psychothrillern „Your Secret Admirer“ und „The Cellar“ (dt. „Haus der Schrecken“/„Im Keller“). In den folgenden beiden Jahrzehnten veröffentlichte er mehr als 60 Romane und zahlreiche Kurzgeschichten. Dabei beschränkte er sich nicht auf die Genres Horror und Thriller, sondern schrieb u. a. auch Romanzen oder Westernromane. Laymons Erfolg hielt sich in den USA lange in Grenzen; seine eigentliche Fangemeinde hielt ihm in Europa die Treue. Dafür dürften seine ungeschminkt derben und an blutigen Effekten nicht sparenden, die puritanische Sexfurcht der US-Gesellschaft ignorierenden und anklagenden Geschichten verantwortlich sein. Dennoch wurden Laymon-Werke mehrfach für renommierte Buchpreise nominiert. Im Jahre 2000 wurde „The Travelling Vampire Show“ (dt. „Die Show“) mit dem „Bram Stoker Award“ für den besten Horror-Roman des Jahres ausgezeichnet.
Den Preis konnte Richard Laymon nicht mehr selbst in Empfang nehmen. Er starb am 14. Februar 2001 an einem Herzanfall. Über sein Leben, vor allem jedoch über sein Werk informiert diese Website.
Taschenbuch: 559 Seiten
Originaltitel: Island (London : Headline Book Publishing Ltd 1995)
Übersetzung: Thomas A. Merk
http://www.randomhouse.de/heyne
eBook: 609 KB
ISBN-13: 978-3-641-02910-4
http://www.randomhouse.de/heyne
Der Autor vergibt: 




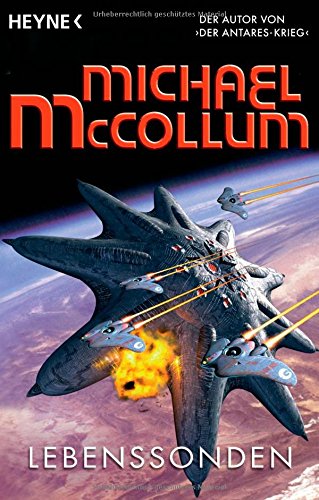
Selbst die schnellsten Raumschiffe und Funksignale benötigen Jahrhunderte oder gar Jahrtausende, um viele Lichtjahre entfernte Planetensysteme zu erreichen. Seit mehreren hunderttausend Jahren entwickelt man sich technologisch weiter, aber der Traum, schneller als das Licht zu fliegen, bleibt eine Utopie. Schließlich wird die Frage, ob es möglich ist, schneller als das Licht zu fliegen, existenziell: Die Rohstoffe im System der Schöpfer werden knapp. Man startet das Projekt der LEBENSSONDEN, die nur eine Aufgabe haben, nämlich Kontakt zu anderen Spezies herzustellen, ihre Erkenntnisse zu speichern und zurückzubringen. Man erhofft sich davon entscheidende Impulse in der Forschung; Kontakte mit anderen Rassen führten in der Vergangenheit oft zu Quantensprüngen in der technologischen Entwicklung. Im Idealfall würde eine Sonde eine Rasse mit überlichtschnellem Antrieb entdecken und mit dieser, sofern sie ihr nicht als Bedrohung der Schöpfer erscheinen, ins Geschäft kommen.
Kurz nach der Landung auf dem Planeten Herodor geht in den pilgerüberfluteten Straßen der Stadt Civitas Beati die Post ab. Passend zur aktuellen Warhammer-40k-Sommerkampagne liefern sich Kommissar Gaunt und seine Jungs vom ersten und einzigen Tanith eine zünftige Straßenschlacht, die gegen Ende wahrhaft apokalyptische Ausmaße annimmt. An mehreren Fronten wird hier der gut organisierte Blutpakt zurückgetrieben, um die schlecht geschützte Stadt vor ihrem endgültigen Ende zu bewahren. Das jedoch ist alles nur ein Vorgeschmack. Im zweiten Teil des Buches müssen sich die Tanither nach einer größeren Weltraumschlacht gegen die Hauptstreitmacht und gegen neun Profiattentäter erwehren, deren Auftrag es ist, der Reinkarnation der heiligen Sabbat endgültig ihren Märtyrertod zu geben.
_Schreibstil_
_SF-Veteran aus Kanada,_
der in Deutschland bisher kaum eine Schlacht liefern konnte: Seit 1986 hat Robert Charles Wilson 12 Romane auf die Science-Fiction-Fraktion losgelassen (und einen Kurzgeschichten-Band), er war mehrfach für den Hugo-Award nominiert, aber auch für den World Fantasy-Award, den Nebula-Award und den Aurora-Award.
Nach Deutschland haben es bisher nur fünf Romane geschafft – drei davon sind vergriffen: „Bis ans Ende aller Zeit“, „Darwinia“ und „Bios“. Die zwei erhältlichen Werke haben wir nun dem |Heyne|-Verlag zu verdanken, er hat sich dem 2001 erschienenen [„Die Chronolithen“ 1816 angenommen und veröffentlicht nun „Spin“, das aktuellste Werk des kanadischen Ideenjongleurs.
_Lights out, Everybody!_
Hätte Gott das vom Himmel geschrieen, hätten sich Tyler Dupree und die beiden Lawton Zwillinge vielleicht nicht so sehr den Kopf zerbrochen, als in einer Nacht unbekannten Datums plötzlich die Sterne vom Himmel verschwanden. So aber steht die Welt Kopf: Wer hat die Sterne ausgesperrt? Was ist die Ursache? Wird die Sonne am nächsten Tag überhaupt wieder aufgehen? Aber der Reihe nach:
Tyler Dupree ist eigentlich ein ganz einfacher Bursche von durchschnittlicher Intelligenz, er lebt mit seiner Mutter in einem kleinen Bungalow neben dem imposanten Lawton-Haus, von jedem nur „Das Große Haus“ genannt. Tylers Mutter jedenfalls arbeitet im „Großen Haus“ als Haushälterin, und Tyler selbst befreundet sich mit Jason und Diane Lawton. Die Zwillinge sind die Nachkommen von Carol, einer depressiven Alkoholikerin, und von E.D. Lawton, einem herrschsüchtigen Industrie- und Forschungsmagnaten, der vor allem in Luft- und Raumfahrt große Erfolge erzielen konnte.
Tyler ist so eng mit den beiden Lawtons befreundet, dass er den Druck miterlebt, den E.D. auf seinen Sohn ausübt, aber auch den Schmerz von Diane Lawton, weil sie von ihrem Vater nur kühle Gleichgültigkeit zu spüren bekommt. Gerade als die ersten Knospen der Pubertät in der Beziehung zwischen Jason und Diane erblühen, gehen die nächtlichen Lichter aus, die Erde wird vom sogenannten Spin eingehüllt.
Für Jason wird der Spin zur Besessenheit. Zusammen mit seinem Vater ist er auf der Suche nach einer Erklärung für die Erscheinung, auf der Suche nach den „Hypothetischen“, welche die Fäden hinter den Kulissen ziehen müssen. Diane hingegen wird von einer tief greifenden Furcht erfasst, was die Hypothetischen betrifft, ihre Suche nach Antworten bringt sie auf religiöse Pfade, in das Jagdrevier seltsamer Sekten, die seit dem Spin wie Schimmelpilze wuchern.
Tyler selbst betrachtet die Geschehnisse mit einiger Distanz, er gewöhnt sich, wie der Rest der Welt, an die verschwundenen Sterne, beginnt ein Medizinstudium und arbeitet fortan als Arzt im Forschungsinstitut von Jason Lawton. Der versorgt ihn dabei stets mit brandneuen Informationen über den Spin: Erste Sonden wurden durch die Spinmembran ins All geschossen und ihre Messergebnisse sind so unglaublich wie weitreichend für die Forschung und die gesamte Welt. So ist Tyler immer ein Teil der wahnwitzigen Projekte, die Jason durchführt, und darf als Erster von den Erkenntnissen kosten, die diese Projekte hervorbringen. Dann allerdings kippen die Verhältnisse, Jason erkrankt, die religiöse Erlösung bleibt aus und allmählich scheint das Ende der Welt unvermeidlich …
_John Irving auf dem Science Fiction Trip_
Man sieht es vielleicht an obiger Zusammenfassung: „Spin“ legt einen unglaublichen Wert auf Figuren und deren Schicksale. Wilson beobachtet die einzelnen Charaktere mit der Lupe und verfolgt auch alle Nebenströmungen ihrer Entwicklung bis zur letzten Seite. Ähnlich wie John Irving beschreibt er selbst so profane Dinge wie ein jugendliches Fahrradrennen vollkommen lebensecht und spritzig, er lässt die Persönlichkeit der Figuren dabei sichtbar werden und vermittelt gleichzeitig die Melancholie der vergänglichen Jugend – Beeindruckend!
Auch auf die Entwicklung der Welt nach dem Spin hat er ein scharfes Auge: welche Bewegungen entstehen, warum tun sie das, in was für Splittergruppen zerfallen sie, kurzum, wie sieht er denn aus, der Mensch des Post-Spin, der Bürger einer Welt, die sich von einer unbekannten Macht vom Universum ausgesperrt fühlt? Dazu starrt „Spin“ geradezu vor tiefen, philosophischen Überlegungen, in schöne Bilder verpackt und ernsthaft vorgetragen. Wilsons Sprache überhaupt ist überdurchschnittlich: flotte Dialoge, floskelfreie Vergleiche und treffsichere Metaphern; sogar Rückblenden weiß Wilson spannungssteigernd einzusetzen (Anfangs jedenfalls, aber dazu kommen wir später) – Wunderbar!
_Geduldsprobe für den Ideensüchtigen._
Der Science-Fiction-Fan allerdings wird schon längst unruhig auf dem Stuhl herumrutschen: Familienchronik, Sozialfiktion, treffende Vergleiche und philosophische Ausschweifungen – schön und gut, aber wo verdammt noch mal bleibt die Science-Fiction?! Eine berechtigte Frage. Nun sollen an dieser Stelle keine falschen Vorstellungen entstehen: Das Geheimnis um den „Spin“ und die „Hypothetischen“ steht immer im Raum, es wird auf Hardcore-Ebene diskutiert, es gibt wahnwitzige Experimente, unglaubliche Erkenntnisse und eine visionäre Idee hinter allem … aber all das ist eben nur Hintergrundbeleuchtung für die Familiengeschichte um die Lawtons und ihren Kumpel Tyler Dupree.
Wo sich der Charakter-Fan an zahlreichen Details laben kann, entwickeln sich die Science-Fiction-Elemente mit der Geduld wandernder Kontinente. Ja, Tylers Beziehung zu Diane ist zwiegespalten, ja, die zu Jason auch. Ja, die Welt regt sich über den Spin auf, ja, der Spin hat unterschiedlichste Auswirkungen auf unterschiedlichste Kulturen. Seufz. Wie Wüstenforschung ist das. Nebensächlichkeiten (aus phantastischem Blickwinkel) in dünenhaftem Überfluss, schön arrangiert, meisterlich fast, aber so trocken, dass der Science-Fiction-Leser fast verdurstet. Gott sei Dank gibt es doch ein paar Ideen-Oasen, aber so erfrischend sie auch sein mögen, sie sind schnell leer getrunken und müssen lange vorhalten.
Die Rückblenden sind dabei zweifelhafte Verbündete: Wo sie am Anfang des Buches noch Spannung erzeugen, weil sie die vorstellungssprengenden Ausmaße des Spins andeuten, nehmen sie später Dinge vorweg, die sich dann im „normalen Zeitfluss“ der Story erst entwickeln müssen.
_Alles eine Frage der Zielgruppe._
Wer also Richard Morgan oder John Clute auf seinem Einkaufszettel stehen hat, sollte sich nur mit äußerster Vorsicht an „Spin“ heranwagen; auch wenn die Auflösung schon etwas hermacht, ist der Weg dorthin ein quälend langer. Als Alternative kann ich da nur „Quarantäne“ von Greg Egan empfehlen, sozusagen eine Ultra-Hardcore-Version von „Spin“ – qualmender Schädel und entrücktes Weltverständnis garantiert!
Wer bei der Erwähnung von John Irving große Augen bekommen hat, muss allerdings ebenfalls aufpassen: Mit Irvings Figuren kann Wilson nicht mithalten. Zwar geht er gewaltig in die Tiefe, aber trotz all des beeindruckenden Schmuckwerks sind die Basischaraktere schon ein wenig Klischee (der hyperbegabte Sohn, der vom strengen Vater zu Höchstleistungen angetrieben, aber nie gelobt wird, usw.) Außerdem: Science-Fiction-Anfänger könnten bei diversen Fachdiskursen um „autokatalytische Rückkopplungsschleifen“ schon dem Bedürfnis erliegen, nach der Aspirin-Packung zu greifen.
Wer nun aber genau zwischen diesen beiden Extremen existiert und sich für eine Familienchronik erwärmen kann, die mit mittelharter Science-Fiction serviert wird, der hat 550 Seiten anspruchsvolles Lesevergnügen vor sich.
Mutige Sache, Mr. Wilson! An wahrer Qualität scheiden sich eben immer die Geister.
Homepage des Autors: http://www.robertcharleswilson.com/
http://www.heyne-verlag.de
[„Die Chronolithen“ 1816
[„Darwinia“ 92
London im Jahre 1858: Sechs Jahre sind vergangen, seit Edmund Whitty, Sonderberichterstatter der Zeitung „Falcon“, eine zentrale Rolle bei der Entlarvung des Frauenmörders „Chokee Bill“ spielte. Viele Schlagzeilen und gutes Geld hat ihm dies beschert, doch die Tage des Ruhmes sind lange vorbei. Whitty steckt in einer Pechsträhne. Seit einiger Zeit schnappt ihm ausgerechnet sein erbitterter Konkurrent, Alastair Fraser, die Schlagzeilen weg. Seit Wochen hat Whitty keinen Artikel mehr verkaufen können und steckt in Geldnöten, die umso ernster sind, als er beim „Captain“, einem gefürchteten Wucherer, in der Kreide steht.
In seiner Not übernimmt Whitty einen dubiosen Auftrag: Für einen Detektiv aus den USA soll er das betrügerische Medium Bill Williams entlarven. Die Séance endet im Fiasko, als Williams plötzlich vom Geist David Whittys beherrscht zu sein scheint Sorgfältig hat der Journalist bisher verborgen halten können, dass sein vor sechs Jahren ertrunkener älterer Bruder in der Tat womöglich nicht einem Bootsunfall zum Opfer fiel. Woher kennt Williams die Familientragödie der Whittys? Und wieso wird Edmund wenig später ein Foto zugespielt, das David beim verbotenen Liebesspiel mit einer Minderjährigen zeigt? Soll Edmund erpresst werden? Lebt sein Bruder etwa noch? John MacLachlan Gray – Der Tag der weißen Steine weiterlesen
_Was wäre wenn Luc Besson Japaner wäre?_
Dann würde er wohl To Ubukata heißen und hätte statt „Leon, der Profi“ wohl „Kompression“ geschrieben. Na ja, vielleicht reichen die Parallelen dafür dann doch nicht ganz. Ubukata jedenfalls bezeichnet jenen Film um den tragischen Anti-Helden und seine minderjährige Muse als entscheidende Inspirationsspritze, welche die Geburtswehen des Mardock-Zyklus ausgelöst hat. Aus einer Kurzgeschichte mit geplanten 50 Seiten ist nun ein 1800-seitiges Werk (in der deutschen Fassung ca. 900 Seiten) geworden, und mit „Kompression“ darf nun auch der deutsche Leser in eine Trilogie eintauchen, die der 29-jährige Manga- und Anime-Spezialist verfasst hat.
_Pulverdampf und Techno-Terror._
Mardock City ist eine kalte Stadt, mit einer Wendeltreppe als Wahrzeichen, Symbol für all jene, die hier versuchen, mit aller Gewalt an die Spitze zu kommen. Shell Septinos ist schon weit auf dieser Treppe gekommen, und dabei hat er Unzählige in die Tiefe gestoßen. Manche dieser Unglücklichen glitzern als blaue Diamanten an seinem Finger, die verdichtete Asche ihrer Leichen, und Rune Balot soll die nächste werden.
Sie ist eine minderjährige Geisha und hat eine ganz besondere „Spezialität“, mit der sie ihre Kunden zu befriedigen weiß: Wie eine Puppe liegt sie da, zieht sich in sich selbst zurück und betrachtet den Akt wie von weiter Ferne, der an ihr vergangen wird. Daher auch ihr Pseudonym: „Rune Balot“ ist ein Küken, das in seiner eigenen Schale zu Tode gekocht wird.
Wahrscheinlich hätte Shell Septinos auch genau das geschafft, wenn da nicht Eufcoque gewesen wären und Doc Martin: Die beiden sind schon lange hinter Shell Septinos her, weil sie wissen wollen, wie und warum er die Identitäten seiner ermordeten Mädchen manipuliert hat. Aus diesem Grund unterziehen sie Rune Balot auch der umstrittenen Scramble-09-Technologie, die sie zu einer höchst effektiven Kampfmaschine macht. Das ist auch nötig: Shell Septinos hat nicht vor, sich sein Geheimnis von einer 15-Jährigen entreißen zu lassen …
_Bildgewaltige Japan-Action._
In die berühmt-berüchtigte Kategorie „Story, die auf einen Bierdeckel passt“ muss sich auch „Kompression“ stecken lassen. Sicher, die Hintergründe der Figuren sind interessant und auch Mardock-City weiß mit so manchem klugen Detail zu überraschen, aber die wirkliche Stärke sind hier die Bilder. Rune Balots Scramble-09-Technologie beispielsweise. Sie hat die Fähigkeit, elektronische Dinge mit ihrem Geist zu beeinflussen, zu „snarken“, und sie nimmt ihre komplette Umgebung um sich wahr, als wäre ihre Haut mit jedem Winkel verbunden.
Und Ubukata hat kein Potenzial dieser Idee verschwendet, ständig entdeckt Rune Balot neue Anwendungsgebiete ihrer Fähigkeiten und setzt sie auch überall ein. Besonders interessant wird das, als sie sich mit Eufcoque vereinigt. Der ist ebenfalls ein Scramble-09-Produkt und hat die Fähigkeit, sich in Gegenstände aller Art zu „morphen“, unter anderem in ein unerschöpfliches Waffenarsenal …
Auch die Antagonisten lassen keine schaurigen Erwartungen offen: Dimsdale Boiled ist Shells Sicherheitsmann, und als er erfahren muss, dass Rune keinesfalls ein verängstigtes Mädchen ist, das man mit einem Fingerschnipsen von der Bildfläche pusten kann, ruft er die unsägliche Bandersnatch-Crew auf den Plan. Wiederum kommt einem hier Ubukatas optische Schreibe zugute, Bandersnatch ist eine perverse Bande von Menschenjägern, die ihre Opfer ausschlachten wie organische Ersatzteillager. Jedes Bandersnatch-Mitglied hat einen kranken Fetisch für Körperteile, die sie als Trophäen an sich selbst transplantieren, und als sie Bilder von der süßen Rune Balot zu Gesicht bekommen, kann es keiner von ihnen erwarten, diesen lebendigen Süßwarenladen leer zu räumen … Brrr! Selten habe ich Gegenspieler derartig verabscheut und selten habe ich mich mehr gefürchtet, weil sie Erfolg haben könnten!
Womit eine Überleitung zum dritten Optik-Element von Ubukatas Werk geschaffen wäre: den Action-Szenen. So schwierig es im Film ist, innere Konflikte darzustellen, so schwierig ist es für einen Buchautor, rasante und spannende Action-Szenen zu schreiben. Aber To Ubukata kann das. Zwar verliert man sich manchmal im Wust der Details, aber das liegt auch daran, dass Ubukata beinahe völlig auf ausgelutschte Action-Floskeln verzichtet, und nach unverbrauchten Darstellungen sucht. „Ohrenbetäubende Explosionen“ gibt es keine, stattdessen einen Showdown, der einen geradezu in den Lesesessel presst. „Manga in Buchform“ trifft es hier wirklich auf den Punkt, die Feuerstürme, Gewalttätigkeiten und bluttriefenden Nahaufnahmen blitzen im Stakkato vor dem geistigen Leserauge auf – klasse!
_Adrenalin in drei Dimensionen._
Auch wenn die Story etwas blass ist, die Figuren sind es nicht. Septinos hat einen Grund, weshalb er all den Mädchen neue Identitäten verpasst und sie dann umbringt, Eufcoque hat eine Geschichte, und der Doc ebenso. Rune Balots Schicksal ist zwar nicht brüllend originell, aber glaubwürdig und drastisch dargestellt, Dimsdale Boiled hat ganz eigene Motive, weshalb er Shell Septinos folgt, und sogar die Bandersnatch-Gang hat einen Lebenslauf, der sie zu diesen kranken Monstren hat werden lassen.
Dazu kommt, dass einem Rune Balot wirklich ans Herz wächst, sie ist eine sympathische, mutige, aber auch zerbrechliche und tragische Gestalt, um die man sich bald ebenso sorgt wie Eufcoque. Der ist ein ähnlicher Sympathieträger, und die Beziehung der beiden wächst auf eine Art zusammen, die sich auf angenehm skurrile Weise von den Hollywood-Klischees abhebt. Inwiefern? Nun, wenn man Eufcoque erst mal kennen gelernt hat, wird das schlagartig klar …
_Hetzjagd hin zu einem extremen Cliffhanger._
Unter dem Strich bleibt also eine krass bebilderte Materialschlacht, die, wie es der Klappentext verspricht, wohl tatsächlich Fans von Manga und Matrix zusagen dürfte. Nun denn, hinsetzen, Buch aufschlagen, keine literarischen Tiefen erwarten, vereinzelte Klischees ignorieren und mitreißen lassen. Ich jedenfalls bin ziemlich gespannt auf „Mardock 2: Expansion“, das im Februar ’07 herauskommen wird, und nicht nur wegen des Cliffhangers am Ende dieses Buches. Mal ehrlich: Die Story an dem Punkt anzuhalten, ist fast schon seelische Grausamkeit und für den Buchmarkt erstaunlich mutig. Ein weiterer Pluspunkt also.
http://www.heyne.de
Eine freudige Nachricht noch für alle Anime-Fans: Zwar steht der Erscheinungstermin noch nicht fest, aber To Ubukata wird „Mardock Scramble“ (so der Originaltitel der Serie) als Anime adaptieren. Produziert wird das Ganze in den renommierten Gonzo-Studios. Wer des Japanischen mächtig ist kann schon mal auf http://www.mardock.jp vorbeisegeln, um sich vorab einen Eindruck zu verschaffen.
Stattdessen hat Clive Barker das Tor zu einer anderen Welt aufgestoßen, zu Abarat, einem Archipel seltsamer Inseln, seltsamer Kriege, seltsamer Wesen und seltsamer Bräuche. Ein Auftakt ist dieser Band, und drei weitere werden folgen, werfen wir also einen Blick auf diejenige, um die sich alles dreht:
Fear and Loathing in Chickentown.
Candy Quackenbush lebt in Chickentown, Minnesota, und könnte sich nichts Langweiligeres vorstellen als das. Ihr Vater trinkt und schlägt sie, ihre Mutter hat sich schon längst in ihr Schicksal ergeben, und ihre Geschichtslehrerin piesackt sie mit der Hausaufgabe, Interessantes über ihre Heimatstadt herauszufinden. Nun, aber Candy denkt gar nicht daran, irgendwelche staubtrockenen Lehrbuchfakten zusammenzutragen, sondern wendet sich an eine tratschige Supermarkt-Kassiererin, um in skurrilere Tiefen ihrer Heimatstadt abzutauchen.