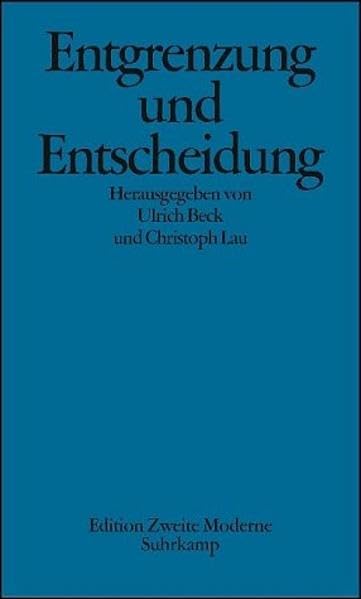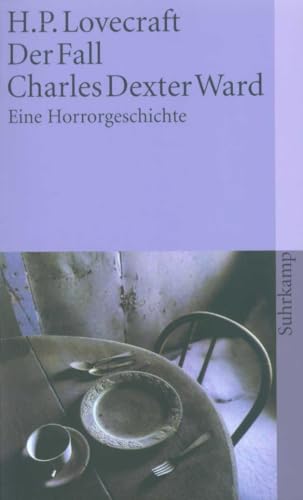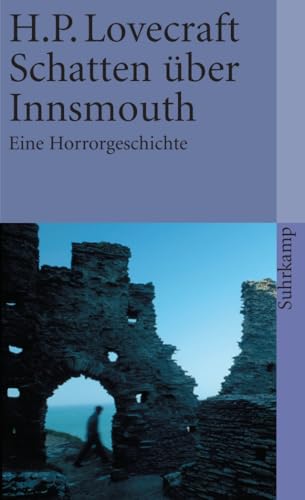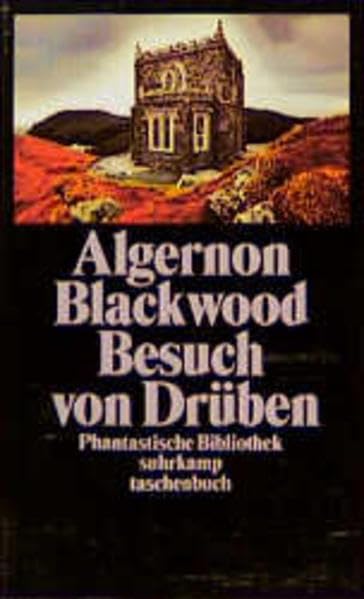Inhalt:
– Der Nachkomme (The Survivor, 1954), S. 7-30: Nicht nur mit der Geduld des Krokodils ausgestattet, trotzt Dr. Charrieres seit Jahrhunderten dem Tod.
– Das Erbe der Peabodys (The Peabody Heritage, 1957), S. 31-55: Als Mr. Peabody pietätvoll das Gerippe seines Urgroßvaters im Sarg umdreht, wird uralter Hexenzauber neu belebt.
– Das Giebelfenster (The Gable Window, 1957), S. 56-74: Der Blick in fremde Welten fasziniert, bis deren unfreundliche Bewohner auf den heimlichen Beobachter aufmerksam werden.
– Der Vorfahr (The Ancestor, 1957), S. 75-90: Der Geist triumphiert über die Materie, aber reizt man diese dabei zu stark, schlägt sie irgendwann grausam zurück.
– Der Schatten aus dem All (The Shadow Out of Space, 1957), S. 91-112: Durch Raum und Zeit reist der entsetzte Erdenmann, als er sich unfreiwillig für einen uralten kosmischen Krieg rekrutiert sieht.
– Das vernagelte Zimmer (The Shuttered Room, 1959), S. 113-150: Was der Großvater gefangen hielt aber nicht vernichten konnte, wird vom ahnungslosen Enkel freigesetzt.
– Die Lampe des Alhazred (The Lamp of Alhazred, 1957), S. 151-161: Ihr Licht enthüllt Wunder und Schrecken, und einem Träumer weist sie den Weg in eine bessere Welt.
– Der Schatten in der Dachkammer (The Shadow in the Attic, 1964), S. 162-183: Was der böse Onkel dem Neffen als Erbe hinterließ, besucht ihn des Nachts in seinem Schlafzimmer.
– Die dunkle Brüderschaft (The Dark Brotherhood, 1966), S. 184-211: Sie sehen aus wie Edgar Allan Poe – und sie planen eine Invasion der besonders umständlichen Art.
– Das Grauen vom mittleren Brückenbogen (The Horror from the Middle Span, 1967), S. 212-233: Eine Flutwelle setzt frei, was bisher sorgfältig in seinem Mausoleum gefangen lag.
– Originaltitel & Copyright-Vermerke: S. 234
Unterhaltsam auf den Spuren des Meisters
Der deutsche Phantastik-Fan kennt August Derleth – falls ihm der Name überhaupt etwas sagt – höchstens als literarischen Nachlassverwalter des Grusel-Großmeisters H. P. Lovecraft (1890-1937). Derleth ist es zu verdanken, dass dieser schon lange jenen verdienten Ruhm erntet, der ihm zeitlebens verwehrt blieb. Doch Derleth war selbst ein fleißiger Autor. Seine Horrorgeschichten bilden einen vergleichsweise geringen Anteil an einem eindrucksvollen Gesamtwerk.
Weil Derleth sich hier jedoch stark an Lovecraft anlehnte und dessen Cthulhu-Zyklus durch eigene Beiträge vermehrte, wurde er primär durch seine Pastichés bekannt. Falsch aber folgerichtig erscheint die hier vorgestellte Sammlung unheimlicher Geschichten unter Erstnennung von Lovecrafts Namen. Sie entstammen jedoch allein der Feder Derleths, dessen Namen allerdings die Kundschaft längst nicht so lockt wie das Zauberwort „Lovecraft“.
Doch die in „Die dunkle Brüderschaft“ gesammelten Storys stellen mustergültig heraus, was die Phantastik Lovecraft verdankt, weil Derleth es zwar sehr gut kopieren aber nur ausnahmsweise nachschöpfen konnte. Vor allem Leser, die Lovecrafts Werk nicht kennen, sondern einfach für handfesten Grusel schwärmen, werden diese Einschränkung getrost ignorieren und ignorieren dürfen, denn eines sind Derleths Geschichten (bis auf eine Ausnahme: s. u.) garantiert: unterhaltsam!
Neugier bringt nicht nur die Katze um
Man sollte sie nach und nach lesen, denn auf diese Weise wird weniger offenbar, dass diese Storys recht einfallsarm einem bestimmten Muster folgen: Ein durchschnittlicher Zeitgenosse gerät durch Erbschaft, beruflich oder Zufall ahnungslos dorthin, wo düstere Mächte – oft in Gestalt zauberisch aktiver Vorfahren – kraftvoll ihr Unwesen trieben. Er (nie sie!) findet Spuren, die sein Interesse wecken und entsprechende Nachforschungen in Gang setzen. Das Resultat ist stets fatal: Längst vergangene Schrecken erweisen sich als höchst lebendig. Der unglückliche Forscher gerät in ihren Bann. Hat er Glück, kostet ihn die Erkenntnis, dass diese Welt keineswegs so funktioniert, wie es die ‚offizielle‘ Wissenschaft behauptet. ‚nur‘ seine geistige Gesundheit. Meist kommt es übler, wobei der Tod nicht einmal das schlimmste Schicksal darstellt.
Lovecraft postulierte eine von Derleth übernommene und ausgebaute (Universal-) Geschichte, die von der Existenz intelligenten Lebens weit vor der Entstehung des Menschen ausging. Kosmische Entitäten treiben ein Spiel, das der beschränkte menschliche Geist nur in Ansätzen begreifen kann: „Der Mensch ist schließlich nur eine kurzlebige Erscheinung auf dem Antlitz eines einzigen Planeten in einer der ungeheuren Welten, die das ganze All ausfüllen“ (aus: „Die dunkle Brüderschaft“, S. 108). Dieses rudimentäre Wissen wird immer wieder zur Quelle eines Entsetzens, das nicht nur auf offensive Attacken aus dem Jenseits, sondern auch auf ein Zuviel an Wissen zurückgeht, das der einzelne Mensch, der sich plötzlich buchstäblich mit einem ganzen Universum fremder und feindseliger Kreaturen konfrontiert sieht, nicht meistern kann.
Mit Jenseits ist hier übrigens nicht die Heimat der Toten gemeint. Derleth übernimmt Lovecrafts Prämisse eines Kosmos‘, dessen Raum und Zeit nicht stabil gefügt, sondern im Fluss sind. Die dem Menschen vertraute Realität bildet nur eine von unzähligen möglichen Welten, die zu allem Überfluss durch Dimensionsportale miteinander verbunden sein können. Obwohl diese Geschichten von Angst und Entsetzen erzählen, gründen sie nicht nur im Horror, sondern auch oder vor allem in der Science Fiction. Der Schrecken entsteht durch die absolute Fremdheit der kosmischen Wesen, deren Handeln womöglich nicht einmal böse im menschlichen Sinne, sondern primär unverständlich ist.
Schrecken aus zweiter Hand?
„Die dunkle Brüderschaft“ sammelt Geschichten, in denen August Derleth den Cthulhu-Mythos kommentierte und ergänzte. Er beschwört den Geist des Vorbilds und lässt ihn sogar mehrfach selbst auftreten (so als „Ward Phillips“ in „Die Lampe des Alhazred“ und als „Arthur Phillips“ in „Die dunkle Brüderschaft“). Derleth geht dabei Lovecrafts Imaginationskraft meist ab; er kopiert seinen Meister, den er freilich gut kennt. Der erfahrene Leser kann die Schnittstellen, d. h. die imitierten Vorlagen, leicht namhaft machen. „Der Schatten aus dem All“ ist beispielsweise eine Variation des Lovecraft-Kurzromans „Berge des Wahnsinns“.
Die älteren Geschichten lesen sich notabene besser als die Storys des ‚späten‘, schon nicht mehr gesunden und ausgelaugten Derleth. So ist die Titelstory „Die dunkle Brüderschaft“ ein missglücktes Werk, das zunächst stimmungsvoll an Lovecrafts Liebe zu den historischen Stätten Neuenglands erinnert, un plötzlich in eine Überfall-aus-dem-All-Plotte abzurutschen; Derleth kreiert dabei Invasoren, die es an Planungsdämlichkeit problemlos mit dem Bug-Eyed-Monster-Pärchen Kang & Kodos aus der TV-Serie „Die Simpsons“ aufnehmen. Auch was der finstere Onkel Uriah in „Der Schatten in der Dachkammer“ eigentlich plante, bleibt unklar; das abrupte Ende der Story legt nahe, dass der Verfasser es selbst nicht wusste.
Wagt es Derleth, sich wenigstens teilweise vom übermächtigen Lovecraft zu emanzipieren, gelingt ihm eigenständig Spannendes und Unheimliches. Mit „Das vernagelte Zimmer“ stellt er eine richtig gute Gruselgeschichte vor – ideenreich, effektvoll, sorgfältig getimt. Diesen August Derleth liest man gern; er weckt die Neugier auf Storys, die nicht dem Cthulhu-Mythos angehören. Diese fanden ihren Weg leider nur ausnahmsweise nach Deutschland, wo sie zudem über unzählige, längst vergessene Sammelbände verstreut und in der Regel nicht annähernd so nah am Original und so lesenswert übersetzt wurden wie die die Geschichten in „Die dunkle Brüderschaft“.
Autor
August William Derleth wurde am 24. Februar 1909 in Sauk City (US-Staat Wisconsin) geboren. Schon als Schüler begann er Genre-Geschichten zu verfassen; ein erster Verkauf gelang bereits 1925. Die zeitgenössischen „Pulp“-Magazine zahlten zwar schlecht, aber sie waren regelmäßige Abnehmer. 1926 nahm Derleth ein Studium der Englischen Literatur an der „University of Wisconsin“ auf. Nach dem Abschluss (1930) arbeitete in den nächsten Jahren u. a. im Schuldienst und als Lektor. 1941 wurde er Herausgeber einer Zeitung in Madison, Wisconsin. Diese Stelle hatte Derleth 19 Jahre inne, bevor er 1960 als Herausgeber ein poetisch ausgerichtetes (und wenig einträgliches) Journal übernahm.
Obwohl August Derleth ein ungemein fleißiger Autor war, basiert sein eigentlicher Nachruhm auf der Gründung von „Arkham House“ (1939), des ersten US-Verlags, der speziell phantastische Literatur in Buchform veröffentlichte. Der junge Derleth war in den 1930er Jahren ein enger Freund des Schriftstellers H. P. Lovecraft (1890-1937). Dass dieser heute als Großmeister des Genres gilt, verdankt er auch bzw. vor allem Derleth, der (zusammen mit Donald Wandrei, 1908-1987) das Werk des zu seinen Lebzeiten fast unbekannten Lovecraft sammelte und druckte.
Lovecraft hinterließ eine Reihe unvollständiger Manuskripte und Fragmente. Derleth nahm sich ihrer an, komplettierte sie in „postumer Zusammenarbeit“ und baute den „Cthulhu“-Kosmos der „alten Götter“ eigenständig aus. Die Literaturkritik steht diesem Kollaborationen heute skeptisch gegenüber. Als Autor konnte Derleth seinem Vorbild Lovecraft ohnehin nie das Wasser reichen. Er schrieb für Geld und erlegte sich ein gewaltiges Arbeitspensum auf, unter dem die Qualität zwangsläufig litt.
Solo war Derleth mit einer langen Serie mehr oder weniger geistvoller Kriminalgeschichten um den Privatdetektiv Solar Pons erfolgreich, der deutlich als Sherlock-Holmes-Parodie angelegt war. Insgesamt veröffentlichte Derleth etwa 100 Romane und Sachbücher sowie unzählige Kurzgeschichten, Essays, Kolumnen u. a. Texte; hinzu kommen über 3000 Gedichte.
Nach längerer Krankheit erlag August Derleth am 4. Juli 1971 im Alter von 62 Jahren einem Herzanfall. Zum zweiten Mal verheiratet, lebte er inzwischen wieder in Sauk City, wo er auf dem St. Aloysius-Friedhof bestattet wurde.
Taschenbuch: 234 Seiten
Originaltitel: The Watchers Out of Time (Sauk City : Arkham House 1974)
Übersetzung: Franz Rottensteiner
http://www.suhrkamp.de
Der Autor vergibt: