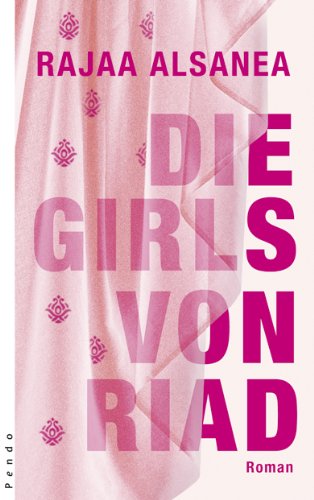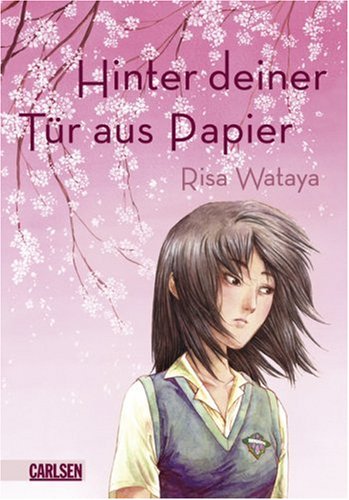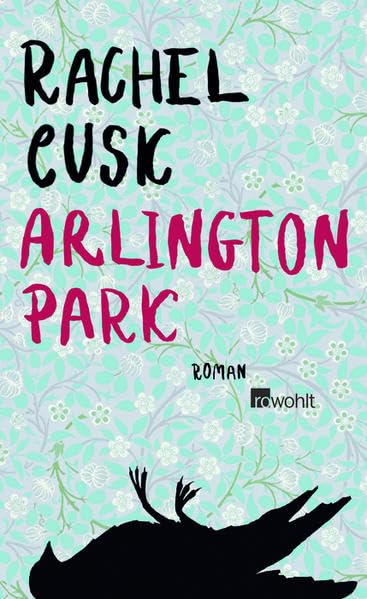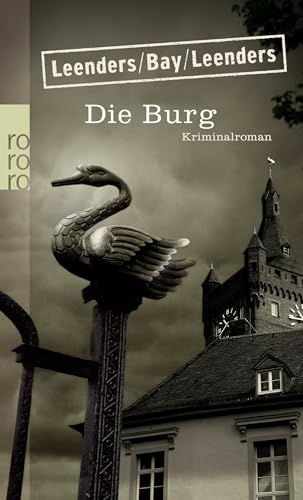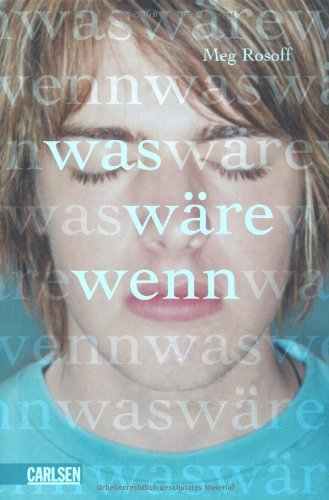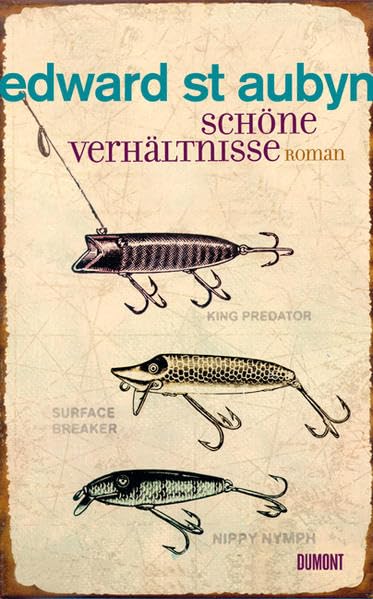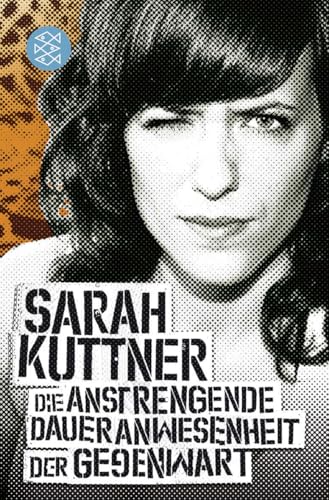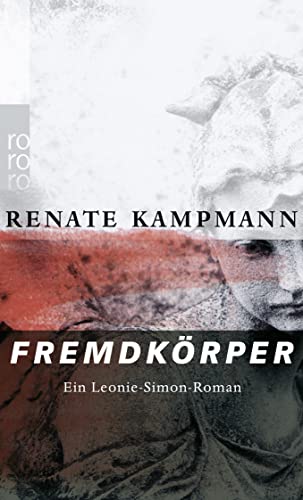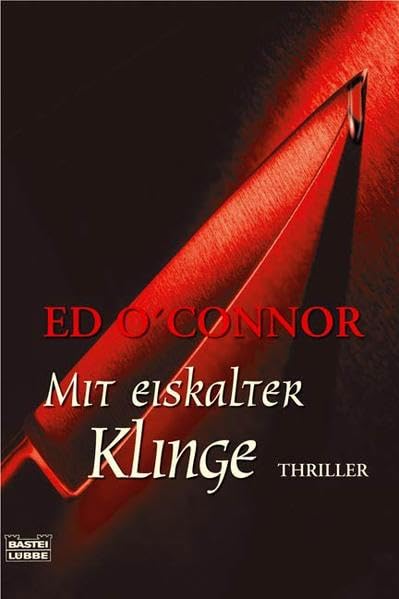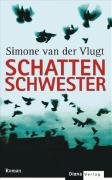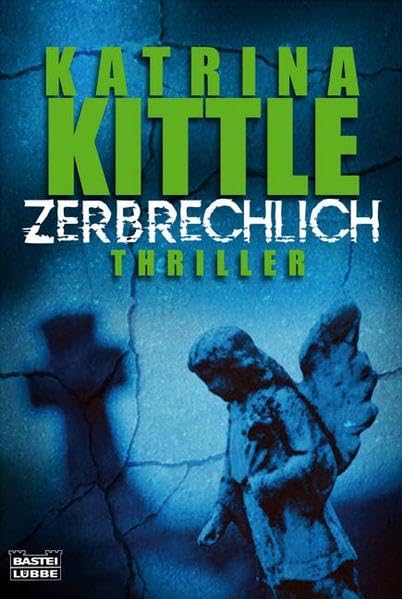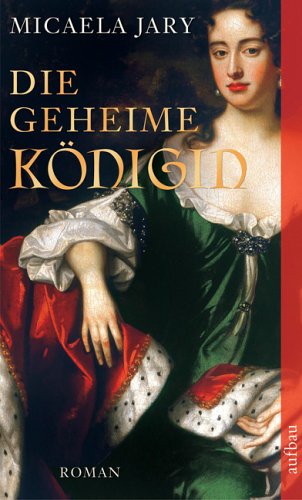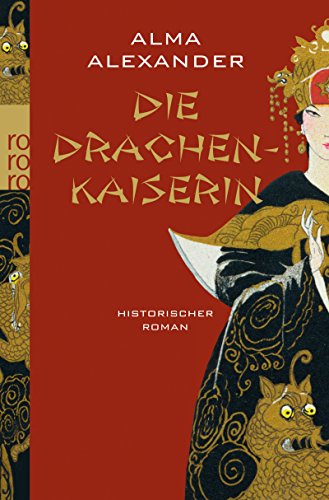Tess Gerritsens erster Roman aus der Jane-Rizzoli-Reihe, [„Die Chirurgin“, 1189 erhielt viel internationales Lob. Das Erfolgsrezept des blutliebenden Serientäters ging auf. Wieso sollte man also nicht das gleiche Thema noch einmal verarbeiten?
In ihrem Krimi „Der Meister“ setzt die Autorin die Geschichte aus „Die Chirurgin“ fort. Detective Jane Rizzoli, die einzige Frau in der Mordkommission des Boston Police Department, hat gerade den perversen Serientäter Warren Hoyt, der sie beinahe getötet hat, hinter Gittern gebracht. Eines Tages wird sie in ein hübsches Bostoner Villenviertel gerufen, wo die Leiche von Dr. Richard Yeager in dessen Haus gefunden wurde. Der Arzt lehnt an der Wand, gefesselt und mit durchgeschnittener Kehle. Das Vorgehen erinnert stark an jenes des „Chirurgen“, wie Hoyt genannt wurde. Als sie die verschwundene Frau des Arztes vergewaltigt und ebenfalls erstochen in einem abgelegenen Waldstück finden, wird Jane Rizzoli klar, dass jemand den Chirurgen imitiert. Panik macht sich in ihr breit, was besonders dem zu Rate gezogenen Agenten des FBI Anlass zur Sorge gibt, ob sie diesen Fall leiten sollte.
Doch Jane setzt sich durch und ermittelt weiter. Wie sehr sie sich damit in Gefahr bringt, wird ihr erst klar, als sie alarmierende Neuigkeiten aus dem Hochsicherheitsgefängnis, in dem Warren Hoyt einsitzt, erreichen. Dem Mann, der eine perverse Freude am Töten hat, ist es gelungen zu fliehen, und er hat nicht nur eine Rechnung mit Jane offen, sondern auch einen Gleichgesinnten, der die Yeagers getötet hat …
Die Geschichte, die Tess Gerritsen in „Der Meister“ erzählt, ist wahrlich nichts Neues. Wir haben einen perversen Serientäter, der es auf die Ermittlerin abgesehen hat und aus dem Gefängnis flieht. Wir haben die einzige Frau im Bostoner P.D., die sich entsprechend gegen die Vorurteile ihrer männlichen Kollegen durchboxen muss. Wir haben das FBI, das sich ganz selbstverständlich in den Fall einmischt. Und wir haben Blut, sehr viel davon.
Nun ist es natürlich so, dass mittlerweile jedes Buch zwangsläufig auf Elemente zurückgreift, die in dieser Form schon in anderen Büchern vorkamen. Allerdings kommt es darauf an, wie man diese Elemente verknüpft, und Gerritsen tut dies recht lustlos, ohne eine eigene Note zu kreieren. Dadurch wirkt der Krimi abgeklatscht und die Spannung geht verloren, weil man als Leser ständig enttäuscht wird, wenn man etwas Originelles erwartet.
Wenn wenigstens Detective Jane Rizzoli originell wäre, dann gäbe es einen Grund, das Buch dennoch zu lesen. Wie schon angeklungen, ist dies jedoch nicht der Fall. Abgesehen davon, dass der Charakter der Frau von sich aus nicht gerade mit Originalität gesegnet ist, hat die Umsetzung von „Der Meister“ vor allem ein Manko: den Schreibstil.
Gerritsen, deren Stil kaum durch Eigenheiten geprägt ist, erzählt aus Janes Sicht in der dritten Perspektive. Mit einem Minimalmaß an Emotionen und nur wenig Platz, um ihre Persönlichkeit entfalten, bleibt Jane dem Leser mehr oder weniger verschlossen. Obwohl sie die Ermittlerin ist, steht sie als Person nicht wirklich im Vordergrund, da nur wenig aus ihrem Privatleben, ihrer Vergangenheit oder ihrer ganz persönlichen Feierabendgedankenwelt nach außen dringt.
Das Buch wirkt dadurch kühl und distanziert, aber nicht auf eine anregende, sondern auf eine lustlose Art und Weise. Der Zugang zur Geschichte wird erschwert und der Schreibstil ist weit davon entfernt, packend zu sein. Die theoretischen Abhandlungen über Autopsie und Spurensicherung sind eine Spur zu lang, zu prall und zu fachwortverseucht, um den Leser konstruktiv zu informieren, und ihr gehäuftes Auftreten lässt das Buch als Spannungsroman auch nicht in einem besseren Licht erscheinen.
Insgesamt ist „Der Meister“ ein Thriller, auf dessen Lektüre man auch verzichten kann. Der Plot wurde in dieser Form in tausend anderen amerikanischen Krimis besser durchexerziert und ziert sich wie eine Jungfrau, wenn es darum geht, Freundschaft mit dem Leser zu schließen. Das sind nicht gerade die besten Voraussetzungen für einen Pageturner, weshalb man den „Meister“ am besten stillschweigend in der Versenkung verschwinden lässt.
http://www.blanvalet-verlag.de
http://www.tess-gerritsen.de
http://www.tessgerritsen.com/
_Tess Gerritsen bei |Buchwurm.info|:_
[„Schwesternmord“ 1859
[„Todsünde“ 451
[„Der Meister“ 1345
[„Die Chirurgin“ 1189
[„Roter Engel“ 1783
[„Akte Weiß: Das Geheimlabor“ 2436