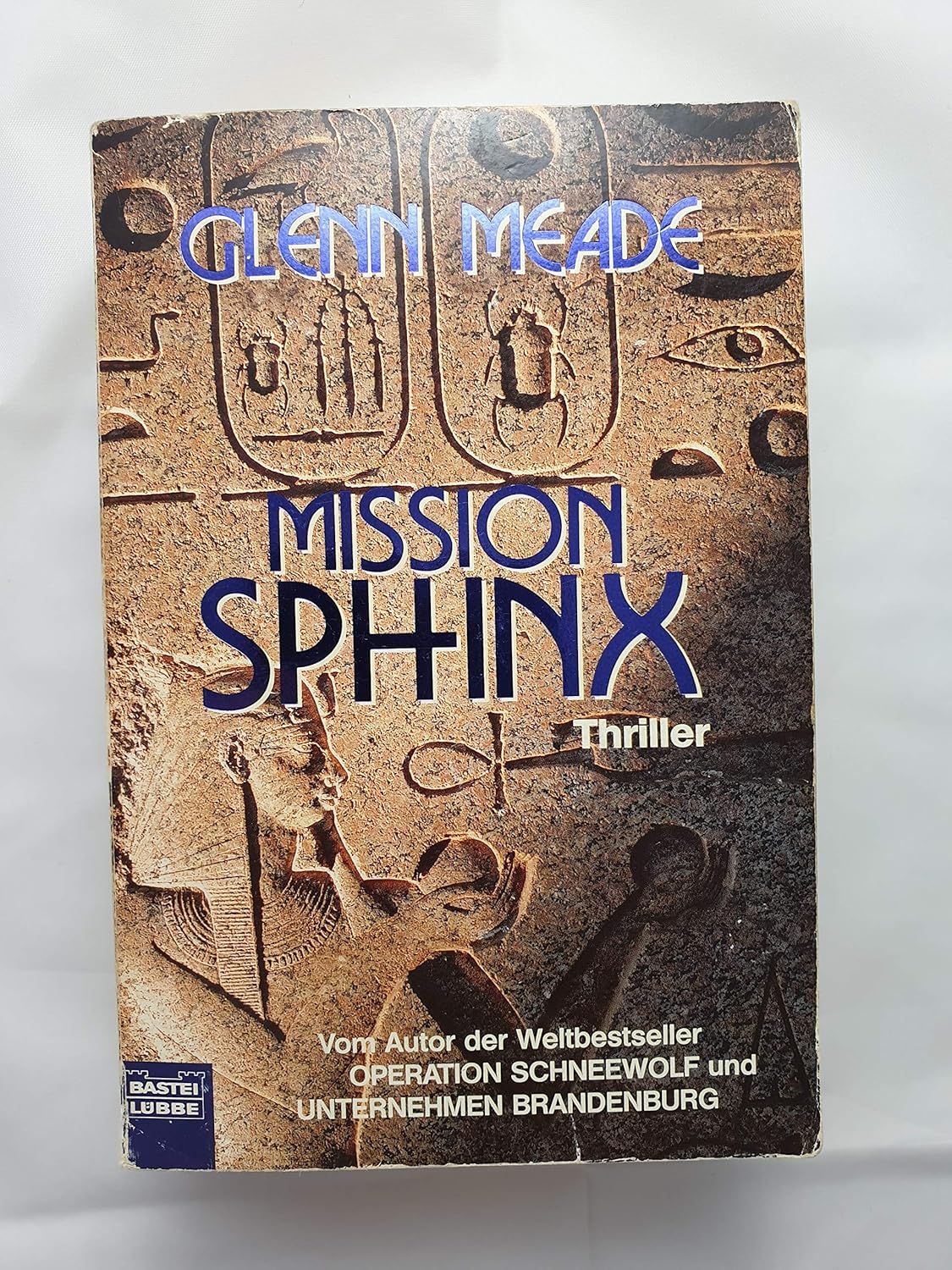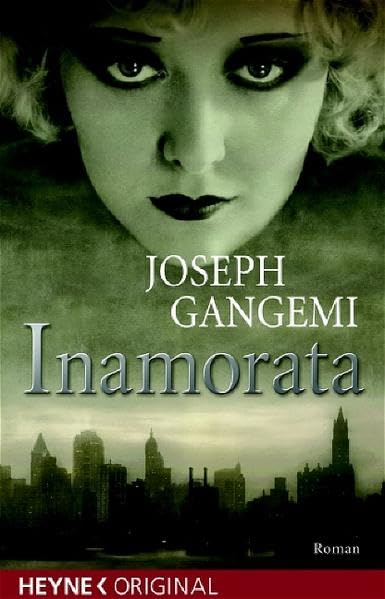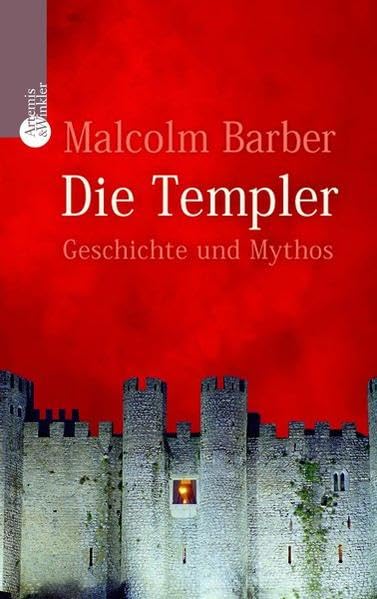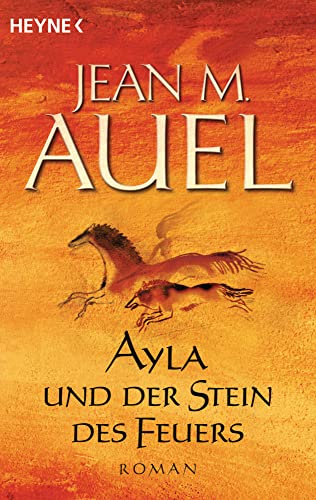Alle Beiträge von Michael Drewniok
Glenn Meade – Mission Sphinx
1939 reist Playboy und Abenteurer Jack Halder, Sohn einer Dame aus der New Yorker Gesellschaft und eines preußischen Großgrundbesitzers, nach Ägypten, um an archäologischen Ausgrabungen teilzunehmen. Begleitet wird er von seinem besten Freund Harry Weaver, dessen Vater als Verwalter für die Familie Halder gearbeitet hat. Im Schatten der Stufenpyramide des Pharaos Djoser lernen sie die Archäologin Rachel Stern kennen und verlieben sich beide in die junge Frau. Die unbeschwerte, gemeinsam verbrachte Zeit endet abrupt, als Hitler seine Truppen in Polen einmarschieren lässt: Der II. Weltkrieg hat begonnen. Die Wege der drei Freunde trennen sich.
Vier Jahre später hat der Krieg seinen Höhepunkt erreicht. Jack Halder ist nach Deutschland zurückgekehrt. Zwar lehnt er das Hitler-Regime ab, aber seit seine Familie einem Luftangriff zum Opfer fiel, hat er den Alliierten Rache geschworen. Er ist zu einem der besten Spione der Abwehr geworden und hat sich auf Unternehmungen im nordafrikanischen Raum spezialisiert.
Rachel Stern musste als Jüdin die volle Grausamkeit des „Dritten Reiches“ erleiden. Daher bleibt ihr kaum eine Wahl, als ihr die Abwehr das ‚Angebot‘ unterbreitet, mit Jack Halder nach Ägypten zu gehen, um dort mit ihm ein hochbrisantes Unternehmen vorzubereiten: In Kairo werden sich im November 1943 US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill treffen – für die Nazis eine Gelegenheit, beide Staatsoberhäupter auszuschalten.
Die deutschen Aktivitäten in Ägypten sind nicht unbemerkt geblieben. Im Generalhauptquartier für den Nahen Osten arbeiten Briten und Amerikaner fieberhaft daran, den Anschlag zu verhindern. Lieutenant Colonel Harry Weaver vom Nachrichtendienst der US-Army wird die Leitung über ein Team übertragen, das die Attentäter entlarven soll. In der Wüste, den Labyrinthen alter Städte wie Kairo oder Alexandria und in den Ruinen Sakkaras beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel. Für Jack, Harry Rachel wird die Auseinandersetzung zu einer besonderen Zerreißprobe. Obwohl sie nun Gegner sind, finden sie erneut zueinander – bis sich herausstellt, dass eine/r von ihnen ein Verräter ist …
Vergangenheit und heikle Vergangenheit
Mit einem historischen Thriller, der zur Zeit des „Dritten Reiches“ spielt, lässt sich das Wohlwollen der Literatur-Kritik besonders in Deutschland schwerlich gewinnen. Angesichts der jüngeren Geschichte ist durchaus verständlich, dass es problematisch kann, die Welt zur Zeit des II. Weltkriegs als Abenteuer-Spielplatz für tapfere Helden und finstere Bösewichte zu benutzen. Das gilt erst recht, wenn auch die Prominenz des „Dritten Reiches“ persönlich auftritt. Die Versuchung ist groß, dieser die Züge typischer Hollywood-Schurken aufzuprägen, was der Handlung eines Romans zum Vorteil gereichen, angesichts des realen Grauens, das diese Männer vor gar nicht so langer Zeit entfacht haben, jedoch leicht einen schalen Nachgeschmack hinterlassen kann.
An dieser Stelle soll nicht erörtert werden, ob die unbekümmerte US-amerikanische oder britische Sicht auf dieses heikle Thema generell zu verurteilen oder unkommentiert zu akzeptieren ist; dies muss jede/r selbst für sich entscheiden. In den genannten Ländern (doch nicht nur dort) ist es jedenfalls legitim, das „Dritte Reich“ als Schablone für reine Unterhaltungsgeschichten zu verwenden. Am besten fährt der kritische Leser wohl, wenn er sich vor Augen führt, dass Meades Nordafrika trotz aller aufwendigen Recherchen (die der Autor in einem Nachwort beschreibt) rein fiktiv ist und mit der zeitgenössischen Realität etwa so viel gemeinsam hat wie das Rom Ben Hurs, der Wilde Westen John Waynes oder die Gotham City Batmans. Der spielerische Einsatz operettenhafter Nazi-Schergen negiert in keiner Weise die banale Bösartigkeit ihrer realen Vorbilder. Nur sehr schlichte oder vom Ungeist übertriebener „political correctness“ angekränkelte Gemüter setzen das eine mit dem anderen gleich.
Thriller mit vorab bekanntem Ausgang
Glenn Meade vermeidet die schlimmsten Fangstricke, indem er „Mission Sphinx“ auf einem Nebenschauplatz des II. Weltkriegs ansiedelt. Schriftstellerische Freiheiten kann man ihm vor der farbigen Kulisse des Nahen Ostens leichter verzeihen. Zwar vermag er der Versuchung nicht ganz zu widerstehen und bringt mit General Walter Schellenberg und Admiral Wilhelm Canaris vom deutschen Sicherheitsdienst zwei reale Figuren der Zeitgeschichte ins Spiel, aber er erspart seinen Lesern den in diesem Genre üblichen, von wagnerianischem Theaterdonner und Schwefeldunst begleiteten Auftritt von NS-Größen wie Göring, Himmler oder gar Hitler selbst.
Ansonsten müht sich Meade entschlossen, das große Manko seiner Geschichte zu überspielen: Da er einen gewissen Anspruch auf historische Genauigkeit erhebt, kann er es sich nicht erlauben, die Realität umzuschreiben. Im Klartext: Der Leser weiß, das alliierte Kommando-Unternehmen wird scheitern, denn weder Roosevelt noch Churchill sind 1943 einem Anschlag zum Opfer gefallen. So gilt es, dieses Scheitern an das Ende einer möglichst packenden Handlung zu stellen, um die Spannung zu erhalten, obwohl zumindest das historische Finale vorgegeben ist. Dies gelingt Meade im Großen und Ganzen gut. Dennoch seien einige kritische Anmerkungen gestattet.
Die dramatisch-tragische Geschichte dreier ‚normaler‘ Menschen in der Hölle des Krieges ist schon tausendfach erzählt worden. In dieser Hinsicht kann Meade mit keinen Überraschungen aufwarten. Sind seine drei Helden wider Willen erst einmal in Nordafrika eingetroffen, löst sich der Plot in eine einzige, vielhundertseitige Verfolgungsjagd auf. „Mission Sphinx“ könnte in diesem Teil um einige hundert Seiten gekürzt und die künstlich aufgeblähte Geschichte zu ihren Gunsten gestrafft werden. Die endlose Jagd durch die Wüste ist reiner Selbstzweck; sie wird wenigstens mit Schwung und Einfallsreichtum abgespult.
Kulissen statt Schauplätze
„Mission Sphinx“ spielt in Nordafrika, einem zumal in der Mitte des 20. Jahrhunderts fernen, fremden Land mit einer uralten, reichen Kulturgeschichte. Davon ist in dem Roman leider nur beiläufig die Rede. Kairo, Sakkara, Alexandria sind für Meade nur klangvolle Namen für exotische Orte aus 1001 Nacht und fantastische Kulissen für die aus Europa und Amerika importierten Helden und Bösewichter. Einige Szenen inmitten malerisch untergegangener Pharaonen-Herrlichkeit sind ein Muss für einen Roman, der in Ägypten spielt – dies unabhängig davon, wie logisch das im Gefüge des Handlungsgerüstes tatsächlich ist.
Der einheimischen Bevölkerung bleibt nur eine Statistenrolle. Als Individuen treten höchstens hinterlistige Handlanger der Nazis oder treuherzige Gehilfen der Helden auf, denen der Autor großzügig ihren Augenblick literarischen Ruhms gewährt, wenn sie eine verirrte Kugel trifft, was gleichzeitig den Guten Anlass für rührselige Gefühlsausbrüche bietet, die ihre edle Gesinnung unterstreichen sollen.
Auffällig sind die Verrenkungen, die Autor Meade unternehmen muss, um die Figur des Jack Halder als tragischen Helden aufzubauen. Deutscher Spion und hochrangiger Angehöriger des Sicherheitsdienstes darf er sein, Nazi aber auf keinen Fall. Also wird aus Halder ein „guter Deutscher“, der Hitler hasst und ihm nur dient, weil er als Soldat dazu verpflichtet ist – so sind sie halt, die Deutschen, wie Meade ‚weiß‘. Der Autor erledigt solche Schwarzweiß-Malereien lieber sofort, ehe er es später für das Drehbuch einer (erhofften) Verfilmung sowieso tun muss.
Diese (und andere, hier unerwähnt bleibende) Klischees mindern das Vergnügen an der Lektüre nicht entscheidend, solange man sich über eines im Klaren ist: „Mission Sphinx“ ist gewiss nicht der Fixstern am Literaturhimmel, als den die Kritik dieses Buch (besonders in den USA) der potentiellen Leserschar verkauft, sondern reine Kolportage – ein Unterhaltungs-Produkt, dessen Umfang eine Bedeutsamkeit suggeriert, die ihm indes nicht zukommt, das seinen eigentlichen Zweck aber hervorragend erfüllt.
Autor
Glenn Meade wurde am 21. Juni 1957 in Finglas, einer Vorstadt von Dublin, geboren, in der hauptsächlich Arbeiter lebten. Eigentlich wollte er Pilot werden, was an einer Augenkrankheit scheiterte. So studierte Meade Ingenieurswesen und bildete in New Hampshire Piloten am Flugsimulator aus. Später wurde er Journalist und schrieb u. a. für die „Irish Times“ und den „Irisch Independent“.
Parallel dazu begann Meade zu schreiben. Zunächst verfasste (und produzierte) er zwölf Stücke für das Strand Theatre in Dublin, mit denen die Darsteller auch auf Europa-Tournee gingen. Anfang der 1990er Jahre inspirierte der Fall der Berliner Mauer Meade zu einem ersten Roman. „Brandenburg“ (dt. „Unternehmen Brandenburg“) erschien 1994 und wurde auch außerhalb Großbritanniens ein Bestseller.
Meade verlegt seine Geschichten gern in die Vergangenheit. In diese Kulissen bettet er konventionelle Thriller-Elemente ein, die er mit ausladenden Liebesgeschichten anreichert. Meade-Romane sind lang und reich – an Handlung wie an Klischees. Wohl genau diese Mischung erfreut ein breites Publikum, weshalb Meades Werke in mehr als 20 Sprachen erscheinen.
Mit seiner Familie lebt und arbeitet Glenn Meade in Dublin und in Knoxville, US-Staat-Tennessee.
Taschenbuch: 748 Seiten
Originaltitel: The Sands of Sakkara (London : Hodder & Stoughton 1999)
Übersetzung: Susanne Zilla
http://www.luebbe.de
Der Autor vergibt: 



Jay Bonansinga – DIe Eismumie (Frozen)
FBI-Profiler Ulysses Grove ist am Ende. Seit Monaten hält ihn der „Sun-City-Killer“ in Atem, der durch die USA geistert und anscheinend wahllos Menschen mit einem Pfeilschuss in den Nacken tötet. Anschließend bahrt er die Leichname sorgfältig auf und arrangiert ihre Arme in einer typischen Geste, die zu enträtseln dem Fachmann einfach nicht gelingt. Schließlich bricht Grove zusammen und wird in einen Arbeits- und Erholungsurlaub geschickt: Im fernen Alaska fanden zwei Touristen im Eis eines Gletschers die Mumie eines vor 6000 Jahren umgekommenen Mannes. Die Archäologen der University of Alaska sind in heller Aufregung, zumal der Tote einem Verbrechen zum Opfer fiel.
Mord in der Steinzeit! Die Presse horcht auf. Maura County vom „Discovery Magazine“ rät den Wissenschaftlern, sich der Hilfe eines Kriminologen zu sichern. Eher widerwillig fügt sich Groves in diese Rolle. Er fühlt sich abgeschoben und will zu ‚seinem‘ Fall zurück. Eine bizarre Laune des Schicksals eröffnet ihm diese Möglichkeit: Der Steinzeitmensch, „Keanu“ genannt, zeigt die gleichen Verletzungen wie die Opfer des „Sun-City-Killers“! Da Groves nicht an Geister glaubt, denkt er an einen Nachahmungstäter. Ermittlungen ergeben, dass es am Fundort der Mumie zu einem Zwischenfall kam: Richard Ackerman, einer der beiden Finder, zeigte Anzeichen einer geistigen Verwirrung und verschwand wenig später spurlos. Jay Bonansinga – DIe Eismumie (Frozen) weiterlesen
Joseph Gangemi – Inamorata
Im Dezember des Jahres 1923 glaubt Martin Finch, mittelloser Psychologie-Student an der US-Renommieruniversität Harvard im US-Staat Massachusetts, das große Los gezogen zu haben: Der berühmte Professor William McLaughlin heuert ihn als Assistenten an. Finch soll ihn bei seinem Bemühen unterstützen, die parapsychischen Fähigkeiten spiritistischer Medien zu überprüfen. Bisher entlarvte der Gelehrte nur Taschenspieler und Betrüger; ein leibhaftiger Geist ist ihm niemals begegnet.
So bleibt es auch, denn Finch entpuppt sich als findiger Detektiv, der falsche Geisterbeschwörer mit klugen Tricks bloßstellt. Als McLaughlin nach einem Unfall ausfällt, bietet Finch an, ihn zu vertreten. Sein Chef willigt ein, weil der aktuelle Fall ihm sehr am Herzen liegt: Der berühmte Schriftsteller und Hobby-Spiritist Sir Arthur Conan Doyle hat McLaughlin auf ein bemerkenswertes Medium in Philadelphia aufmerksam gemacht. Die junge Mina Crawley, Gattin eines deutlich älteren Chirurgen, gehört zur High Society ihrer Heimatstadt. Lange hatte sie Bitten um ein Treffen zurückgewiesen, bis sie jetzt endlich einwilligte. Joseph Gangemi – Inamorata weiterlesen
Elizabeth Moon – Heldin wider Willen
Jener Sektor des menschlich besiedelten Universums, auf den sich hier unser Augenmerk richtet, wird neofeudal regiert von einer Allianz mächtiger Adelsgeschlechter. Da Usurpatoren & Freibeuter über-All lauern, hält man sich ein schlagkräftiges Militär. Kühne Kommandanten steuern die gewaltigen Raumkreuzer des „Regular Space Service“ dorthin wo’s brennt. Darin brennen schneidige junge Burschen und Mädels in schicken Uniformen für jene ekstatischen Momente zwischen Befehlsausgabe und „Sir-jawoll-Sir!“-Bestätigung.
Zum Heer der hoffnungsvollen Nachwuchs-Kampfhähne und -hennen zählt Lieutenant Esmay Suiza. Sie ist Mitglied einer Familie mit langer Militär-Tradition, aber leider geschlagen mit den Erinnerungen an eine gar schlimme Jugend auf dem Hinterwäldler-Planeten Altiplano und – was schwerer wiegt – mit der Gabe des selbstständigen Denkens, die in Soldatenkreisen seit jeher als Fluch gilt. Neulich ist es Esmay gelungen, nicht nur eine Meuterei an Bord der stolzen „Despite“ zu vereiteln, sondern sogar mit dem unter ihrer Führung zurückeroberten Schiff in eine Raumschlacht zu ziehen und den vielfach überlegenen Feind in die x-te Dimension zu blastern. Eine tolle Leistung, die aber so leider nicht im Militär-Protokoll vorgesehen ist, sodass sich Esmay weder belobigt noch befördert, sondern als Meuterin vors Kriegsgericht gestellt wird: Wo kämen wir dahin, wenn jeder Soldat sich zukünftig vom Menschenverstand leiten ließe? Esmay sieht‘s ein und ergibt sich gefasst in ihr Schicksal.
Weil sie ja trotzdem irgendwie richtig gehandelt hat, stößt man sie nicht ohne Raumanzug aus einer Schleuse der „Despite“, sondern versetzt sie auf das ölige Reparaturschiff „Koskiusko“ irgendwo am Arsch des Spiralnebels Omega Harrington. Da die Lex Kirk – dramatische Ereignisse spielen sich ungeachtet jeder Logik stets dort ab, wo der Held oder die Heldin sich gerade aufhalten – auch in Esmays Universum Gültigkeit besitzt, tauchen die Piraten und Terroristen der gefürchteten „Bluthorde“ auf, die besagtes Schiff erobern und entführen. Die Besatzung unterwirft sich feige den Schurken, aber tief in den Eingeweiden der „Koskiusko“ rührt sich Widerstand. Angeführt von Esmay und ihrer neuen Liebe, dem Haudegen Barin Serrano, stemmen sich die mutigen Krieger gegen die teuflische Übermacht, bis schließlich – man glaubt es kaum – … aber das soll an dieser Stelle Überraschung bleiben …
Disziplin und Abenteuer
Elizabeth Moon blieb es einst überlassen, diesen Rezensenten mit der aufregenden Welt der „Military Science Fiction“ vertraut zu machen. Wenn man schon Neuland betritt, dann besser in Begleitung eines ortskundigen Führers. Moon hat selbst gedient – sogar in Vietnam! Man darf daher davon ausgehen, dass diese Autorin weiß, worüber sie schreibt, wenn sie nun tief eintaucht in die Soldatenwelt der Zukunft. Wer sich nur einigermaßen auskennt im Militärischen, wird mir bestätigen, dass Strukturen und Rituale hier ähnlich stabil und jeglicher historischen Entwicklung enthoben sind wie sonst höchstens in der katholischen Kirche. Somit kann Moon ihr Hintergrundwissen auch vor imaginärem Hintergrund voll ausspielen.
Ungeachtet der Häme, in die der skeptische Rezensent leicht verfällt, wenn es gilt, ein Werk wie „Heldin wider Willen“ zu würdigen, ist dieses Fachwissen ein Wort der Anerkennung wert. Zudem ist Esmay Suiza kein Kampfroboter aus Fleisch und Blut, sondern ein Mensch mit allen positiven und negativen Charaktereigenschaften. Kadavergehorsam & Drill-Masochismus sind seit den Tagen der „Starship Troopers“ glücklicherweise ziemlich out, was andererseits der pazifistisch eingestellten Kritik auch wieder nicht Recht ist: Der Feind, den es zu bekämpfen gilt, soll sich gefälligst weiterhin als Schwein gebärden.
Esmay und ihre Gefährten sind Soldaten – Punkt. Wer mit dieser Ausgangssituation nicht klarkommt, sollte sich die Lektüre von „Heldin wider Willen“ schenken. Zweitens: Esmay & Co. wurden von der Unterhaltungs-Industrie rekrutiert. Moons Geschichte beschäftigt sich nicht mit dem Mikrokosmos Militär, seinen in die Zukunft extrapolierten Regeln oder gar seinen Schattenseiten, sondern ist primär dem kindlichen Spaß an Remmidemmi und Zerstörung geschuldet.
Alte Werte in ebensolchen Schläuchen
Esmays Universum ist ein Abenteuer-Spielplatz, auf dem sich das Gute stellvertretend für die Leserschaft tüchtig austobt und die Bösen anders als in der frustrierenden Realität endlich einmal auf die Bretter schickt. Die Jugendtraumata der Heldin und andere Indizien scheinbarer Tiefgründigkeit sind nichts als Feigenblätter; es ist schick, wenn ein Held eine kleine Macke hat – es lässt ihn oder in unserem Fall sie menschlicher wirken.
Wer die Regel der populärkulturellen Vereinfachung nicht kennt, zwischen Realität und Fiktion nicht trennen will oder gar zu gern über die Verrohung der Welt, die kühl kalkulierte Befriedigung niederer Instinkte & das nahe Ende der Zivilisation lamentiert, liegt ebenfalls falsch bei unserer „Heldin wider Willen“.
Eng wird es für Elizabeth Moon allerdings, wenn man nunmehr kritisch unter die Lupe nimmt, wie sie sich im Rahmen der selbst gewählten Spielregeln schlägt. Hier fällt Nachsicht schwer, da die Verfasserin ihrem Publikum ein gar zu schlichtes Garn vorsetzt. Was da über fast 600 Seiten abrollt, ist buchstäblich eine Räuberpistole, die schon in den Pulp-Magazinen der 1930er Jahre ein wenig zu oft abgefeuert wurde. Dabei ist grundsätzlich nichts gegen eine Wiederbelebung des wunderbaren Weltraum-Schwachsinns à la Flash Gordon einzuwenden. Die „Star Wars“-Saga zeigt, wie man‘s richtig macht, indem man sich nicht gar zu ernst nimmt. Leider meint Moon es jederzeit bitter ernst mit ihrem Krawall-Epos: Witz und Selbstironie sind Elemente, die in der „Military Science Fiction“ jenseits des berüchtigen Landser-Humors ganz und gar nicht geduldet werden.
Die Seele der Soldatin
Richtig übel wird es, wenn Moon Gefühl ins Spiel kommen lässt – oder das, was sie dafür hält, wobei schriftstellerisches Unvermögen eine gewichtige Rolle spielen dürfte. Esmays Reise ins Herz der eigenen Finsternis ist besonders im ersten Drittel und noch einmal im Finale eine qualvoll in die Länge gezogene Lektion in sentimentalem Edelkitsch und unfreiwilliger Komik.
Echter Ärger kommt auf, wenn Moon Esmays ewigen Clinch mit den Vorgesetzten schildert. Diese gebärden sich als Herrscher über das Universum oder wenigstens jene Bereiche, in denen Rangabzeichen getragen werden. Dort verteilen sie zum Besten der Welt und ihrer ruppig geliebten Untergebenen fleißig Arschtritte, für die sie von den auf diese Weise Niedergestreckten umso heftiger respektiert werden. Esmays Befehlshabern unterläuft vielleicht der eine oder andere Fehler, der hier und da ein paar Köpfe rollen lässt, aber sie haben die Autorität und damit letztlich immer Recht: Hier endet zumindest dieses Rezensenten Bereitschaft, in jene Bereiche der SF-Welt vorzudringen, wo er noch nie zuvor war.
Nicht verantwortlich kann die Autorin indes für jene Verwirrung gemacht werden, die den Leser auf den ersten einhundert Seiten immer wieder befällt. Da rekapituliert Esmay ausführlich dramatische Ereignisse, die sie augenscheinlich gerade überstanden hat. Aus dem Text geht klar hervor, dass der Leser eigentlich mehr darüber wissen müsste. Tatsächlich ist „Heldin wider Willen“ der vierte Teil eines groß angelegten Zyklus‘, der sich locker um den Serrano-Clan rankt. Aus unerfindlichen Gründen startet der Bastei-Lübbe-Verlag mittendrin; ob‘s daran liegt, dass unbedingt eine starke Frau à la Honor Harrington in die Riege der verkaufsstarken SF-Helden aufgenommen werden sollte?
Autorin
Susan Elizabeth Norris Moon wurde am 7. März 1945 in McAllen, einer Stadt im Süden des US-Staates Texas, geboren. Nach einem Studium der Geschichte und einem Intermezzo als Rettungs-Sanitäterin drängte es sie 1968 dazu, Nützliches für ihr Land zu tun. Also meldete sie sich erst zum Marine Corps und ging dann nach Vietnam, wo sie allerdings nicht mit Napalm oder M16, sondern am Computer half, möglichst viele „Charlies“ zu erwischen.
1969 kehrte Moon in die USA zurück und heiratete einen ehemaligen Kommilitonen und Kameraden. Mit ihrem Mann zog sie nach dem Ende ihrer aktiven Dienstzeiten in einen Vorort der texanischen Hauptstadt Austin, wo das Paar noch heute lebt. Moon begann ein Biologiestudium, das sie 1975 abschloss.
In den 1980er Jahren begann Moon Kurzgeschichten zu schreiben. „The Sheepfarmer‘s Daughter“ wurde 1986 ihr Romandebüt sowie Startband einer Fantasy-Trilogie. Anschließend widmete sich Moon der „Military Science Fiction“. Vor dem gemeinsamen Hintergrund eines menschlich besiedelten Universums entstanden verschiedene Zyklen, die Abenteuer mit militärischen Werten boten. Bei einem entsprechend gepolten Publikum bereits sehr beliebt, konnte Moon die Literaturkritik erst mit ihrem Roman „The Speed of Dark“ (dt. „Die Geschwindigkeit des Dunkels“) begeistern, der Geschichte eines autistischen Computerprogrammierers, für den sie 2003 mit einem „Nebula Award“ ausgezeichnet wurde.
Elizabeth Moons Website
Taschenbuch: 588 Seiten
Originaltitel: Once a Hero (Riverdale/New York : Baen Books 1997)
Übersetzung: Thomas Schichtel
http://www.luebbe.de
Der Autor vergibt: 




Barber, Malcolm – Templer, Die. Geschichte und Mythos
|“Die Anfänge“| (S. 8-48): Der einst mächtige und von zahlreichen Sagen umwitterte Orden der Templer entsteht bescheiden im Rahmen der Kreuzzugsbewegung, deren Beginn ins Jahr 1095 fällt: Papst Urban II. ruft die Christen auf, ihre Brüder und Schwestern in Palästina und Syrien, den biblischen „Kernlanden“ des christlichen Glaubens, vor den Attacken der heidnischen Sarazenen (Türken), Ägypter und Äthiopier zu schützen. Im Verlauf eines ersten Kreuzzugs werden die „heiligen“ Lande befreit, doch die lateinischen Eroberer müssen sich in den Städten verschanzen oder Burgen errichten, denn niemals erkennen die einheimischen Machthaber die neuen Herrscher an. So bleibt der christliche Traum vom Pilgerzug ins gelobte Land ein gefährlicher, oft tödlicher, denn die Straßen der stets im Kampf befindlichen Kreuzfahrerstaaten sind nicht sicher. Es entsteht der Plan zur Gründung einer Gemeinschaft zum Schutz besagter Pilger. Fromm sollen diese Männer sein aber auch gut bewaffnet und kriegstauglich. 1119 ist es so weit: Der Templerorden wird gegründet.
|“Das Konzept“| (S. 49-79): Die Vereinigung der Templer unterscheidet sich von Anfang an von rein monastischen Orden. Zwar sollen seine Mitglieder fromm und gehorsam, aber sie dürfen nicht arm sein, denn Ausbildung und Unterhalt einer schlagkräftigen Truppe sind kostspielig. Die Angehörigen des Ordens sind meist von Adel und vermögend, sie spenden reichlich, der Orden selbst treibt lukrative Geschäfte, er wird von päpstlicher Seite mit einträglichen Schenkungen bedacht – Grundlagen für einen unerhörten Aufstieg aber auch Ursachen für den späteren Untergang, denn der Orden wird rasch finanziell unabhängig und militärisch von entscheidender Bedeutung im Heiligen Land, was ihn selbstbewusst und nach Meinung seiner zahlreich werdender Feinde hochmütig werden lässt.
|“Der Aufstieg der Templer im Osten“| (S. 80-129): Die historische Realität gibt jedoch den Templern viele Jahre Recht – ohne ihre Schwerter, ihr Geld und ihre Kontakte geht gar nichts im Heiligen Land. Was der Papst und gläubige Herrscher in Europa zur „Befreiung“ Palästinas und Syriens beschließen, ist vor Ort nur mit den Templern zu verwirklichen. Sie haben sich Burgen und Stützpunkte geschaffen und harren aus, während die Lateiner nur „Gastspiele“ im Rahmen von Kreuzzügen geben und oft nicht einmal dann die türkischen und später die mongolischen Kräfte im Osten in Schach halten können.
|“Von Hattin bis La Forbie“| (S. 130-166): Aber die Templer sind nicht unfehlbar. Ihre bekannte Präsenz im Osten macht sie zudem angreifbar. Verlieren die Lateiner eine Schlacht gegen die Türken, beginnt rasch die Suche nach einem Sündenbock, denn Verrat muss im Spiel sein, endet ein von Gott befohlener Kreuzzug als Desaster – und das kommt zwischen den Schlachten von Hattin 1187 und La Forbie 1244 immer wieder vor, denn jeder Waffenstillstand mit den Sarazenen ist brüchig. Zu schaffen machen den Kreuzzüglern auch innere Uneinigkeit und äußere Schwäche, so dass der Christenheit Region um Region im Osten verloren geht.
|“Die letzten Jahre der Templer in Syrien und Palästina“| (S. 167-202): Dennoch bleiben die Christen auch nach 1244 dank der Templer noch fast ein halbes Jahrhundert im Osten präsent. Der Orden verschanzt sich in gewaltigen Burganlagen und trotzt den unablässig anstürmenden Türken. Aus dem Westen ist Hilfe nicht mehr zu erwarten, mehrere Kreuzzüge finden ihr fatales Ende. Es kommt der Tag, da herrschen im Heiligen Land nur noch die Templer und auch sie nur noch in ihren Burgen, bis auch diese eine nach der anderen erobert werden. Mit dem Fall von Akkon endet 1291 faktisch die christliche Herrschaft in Palästina und Syrien. Die Templer ziehen sich auf die Insel Zypern zurück.
|“Templerleben“| (S. 203-223): Viele Legenden ranken sich um den Templeralltag. Von geheimen Riten und verschwörerischen Ränken gegen Papst und Könige wird gemunkelt, sogar dem Teufel huldigt man angeblich. Außerdem sollen die Templer gewaltige Reichtümer angehäuft und so gut versteckt haben, dass ihnen bis heute niemand auf die Spur gekommen ist. Tatsächlich sind die Regeln des Ordens niemals geheim gewesen. Ihr Wortlaut ist bekannt; er spiegelt das Bild einer mönchsähnlich lebenden Gemeinschaft wider, die zumindest in ihren frühen Jahren im Dienste Gottes handelten. Ein Hüter mythologischer Mysterien ist der Templerorden niemals gewesen; dies sind Interpretationen aus späteren Jahren und Jahrhunderten.
|“Das Imperium der Templer“| (S. 224-238): Im 13. Jahrhundert bilden die Templer einen der mächtigsten geistlichen Ritterorden der mittelalterlichen Welt. 7000 Ritter, „Sergeanten“, dienende Brüder gehören ihm an. Hinzu kommt eine ungleich größere Zahl angeschlossener Mitglieder: Amtleute, Hilfskräfte, Rentenempfänger. Mindestens 870 Burgen, Komtureien und Filialen stehen in fast allen Ländern der westlichen Christenheit. Der Orden unterhält eigene Kampftruppen für die „heiligen“ Kriege in Palästina und Syrien und auf Zypern, es existiert eine eigene Mittelmeerflotte. Präsent ist der Orden außer im Osten auch in Frankreich und auf der iberischen Halbinsel, die zu diesem Zeitpunkt noch weitgehend arabisch besetzt ist. Wie im Heiligen Land sollen die Ritter die Heiden bekämpfen und sie womöglich auf den afrikanischen Kontinent zurückwerfen. Ihre „Internationalität“ und das daraus erwachsende Wissen lässt die Templer zu einem ökonomischen Machtfaktor werden. Der Orden ist bemerkenswert reich und amtiert als Bank für zahlreiche Päpste, Könige und Adlige.
|“Der Untergang des Ordens“| (S. 239-277): Angeblich völlig überraschend kommt 1312 das Ende für den Templerorden: Papst Clemens V. erklärt ihn für aufgelöst, Philipp der Schöne, König von Frankreich, sorgt für die Umsetzung dieser Anordnung. Das Verhängnis hat sich indes schon lange abgezeichnet. Der Templerorden wird für den Verlust des Heiligen Landes verantwortlich gemacht. Kritik an der Selbstherrlichkeit und Verderbtheit der Templer hat es zudem immer gegeben – nun findet sie Gehör. Einige Versuche, nach 1291 im Heiligen Land wieder Fuß zu fassen, scheitern. Dem Orden, der seine eigentliche Aufgabe nicht mehr wahrnehmen kann, misslingt es, seine immensen Unterhaltskosten oder seine enormen Einkünfte aus Schenkungen und Stiftungen zu rechtfertigen. Ihm wird außerdem sein Reichtum zum Verhängnis. Der in Finanznöten gefangene französische König bemächtigt sich des Templervermögens, um seine zahlreichen Gläubiger zu befriedigen. Philipp ist womöglich außerdem davon überzeugt, dass die Templer tatsächlich zu einem Ketzerorden degeneriert sind. So fallen die einst so mächtigen Ritter den drastisch veränderten Zeitläufen zum Opfer.
|“Von Molays Fluch zum ‚Foucaultschen Pendel'“| (S. 278-292): Von einem „Fluch“ der untergegangenen Templer ist im Mittelalter selbst keine Rede. Erst in der Neuzeit wird dieser als reizvolles literarisches Thema eher spielerisch in die Welt gesetzt. Die Freimaurer berufen sich auf die Templer als glanzvolle „Vorgänger“, andere moderne „Orden“ und Vereinigungen eifern ihnen nach. Verschwörungsfetischisten komplettieren im 20. Jahrhundert die Fraktion derer, die in den Templern eine vom zeitgenössischen Establishment systematisch ausgerottete Geheimorganisation im Besitz „übernatürlichen“ Wissens sehen möchte.
Eine Gesamtdarstellung der Geschichte des Templerordens gehört zu den fachlichen Herausforderungen, der sich nur wirklich fähige Historiker mit Erfolg stellen: Wie schaffe ich es, eine unerhört komplexe Materie möglichst knapp und trotzdem verständlich, ohne entstellende Verkürzungen oder Auslassungen darzustellen? Schon über Einzelaspekte der Templerhistorie wie das genaue Gründungsdatum des Ordens sind eigene Bücher verfasst worden. Unter solchen Umständen ist die wissenschaftliche und literarische Leistung von Malcolm Barber noch höher einzuschätzen: Um zu wissen, wo er kürzen und zusammenfassen durfte, musste er den Gesamtstoff gesichtet & gewichtet haben – eine Arbeit, die ihn mehrere Jahre in Anspruch nahm und in die Archive vieler Länder führte. Das Ergebnis kann sich sehen bzw. lesen lassen: Sachlich, manchmal trocken in Worte gefasste Realität kommt mit der Intensität eines Tatsachenthrillers daher.
Gut tut die sachliche Abrechnung mit dem unerträglichen Esoterik-Quatsch, welcher der Templergeschichte vor allem seit dem 20. Jahrhundert übergestülpt wird. Die Ritter des Ordens bzw. ihrer Nachfolger sollen an einem streng geheimen Ort den heiligen Gral hüten und auch sonst diverse Mysterien im Auge behalten. Von vergrabenen Schätzen und genialen Todesfallen ist die Rede, über vom Vatikan unterdrückte Bibelsequenzen und die mögliche Einmischung von Außerirdischen wird gemunkelt – Dummgefasel der übelsten Sorte, mit dem sich indes viel Geld verdienen lässt. Mit der historischen Realität hat das nicht das Geringste zu tun und Barber lässt den Befürwortern solchen Bockmistes keine Schlupflöcher.
Dass „Die Templer“ dem Fachbuch näher stehen als dem Sachbuch, verrät u. a. der eindrucksvolle Anmerkungsapparat: Auf den Seiten 293-327 geben 754 Endnoten Auskunft über die Vielzahl der Quellen, die Verfasser Barber in jahrelanger Archivarbeit zu Rate zog. Die Liste der verwendeten Titel umfasst weitere 19 eng bedruckte Seiten (S. 328-347). Ein Personenregister unterstützt die Suche nach zentralen und Randfiguren der Templergeschichte (S. 348-354). Ebenfalls hilfreich sind eine knapp gefasste Zeittafel (S. 355/56), ein Verzeichnis der Großmeister des Templerordens (S. 356) sowie vier Karten, welche die Templerhäuser und -burgen im Westen des Abendlandes, die wichtigsten Burgen in Syrien und Palästina, die Niederlassungen des Ordens in der französischen Provence sowie seine Besitzungen im Languedoc verzeichnen (S. 357-360).
Dem Handbuchcharakter des Werks sind mögliche Abbildungsstrecken zum Opfer gefallen. Das ist verständlich, denn diese hätten den Seitenumfang vergrößert, ist aber schade, denn selbstverständlich haben die Templer bereits ihre Zeitgenossen fasziniert, die uns eine Vielzahl bemerkenswerter und wissenschaftlich aussagekräftiger Bild- und Schriftquellen hinterlassen haben (was wichtig ist, da die Unterlagen der Templer selbst nach ihrem Sturz und fast vollständig vernichtet wurden). Hinzu kommen Templerburgen, Gewandungen, Ausrüstungsgegenstände und andere Zeitzeugen des mittelalterlichen Alltags, die ihrerseits anschaulich Aufschluss geben über das Templerleben. Doch Barber hat sich entschieden und stützt sich primär auf das geschriebene Wort, was ihm andererseits dabei hilft, sein Werk geschlossen zu halten.
Malcolm Barber lehrt als Mittelalterhistoriker an der englischen Universität Reading. Er hat sich auf die Geschichte der geistlichen Orden zur Zeit der Kreuzzüge spezialisiert und viele Artikel in diversen Fachzeitschriften als auch (populär-)wissenschaftliche Bücher über damit verbundene Themen verfasst. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ihm dabei der Wind manchmal kräftig ins Gesicht bläst; Kritik erhebt sich u. a. an Barbers Interpretation der Katharerhistorie. Das vorliegende Werk wurde deutlich weniger gezaust. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass es erst mit mehr als zehnjähriger Verspätung in Deutschland erschien und sich das Geschichtsbild auch in Sachen Templer und auf der Grundlage neuer Erkenntnisse seither entwickelt hat. Barber selbst hat seinen Beitrag dazu geleistet, was freilich in erster Linie den Historiker zur Beachtung der neueren Literatur verpflichtet; der Laie kann weiterhin bedenkenlos zu diesem Werk greifen.
Algernon Blackwood – Der Griff aus dem Dunkel. Gespenstergeschichten
In einer Novelle und fünf Kurzgeschichten gewinnt Algernon Blackwood (1869-1951), Meister der angelsächsischen Gruselliteratur, ihm wichtigen Themen (Naturmystik, Mehrdimensionalität, Tod als Übergang) neue, spannende Seite ab:
– Das Haus der Verdammten (The Damned, 1914), S. 7-110: William und seine Schwester Frances werden von der reichen Witwe Mabel auf deren Landsitz in der Grafschaft Sussex eingeladen. Aus dem erhofften Urlaub auf dem Lande wird nichts, denn in „The Towers“ spukt es mächtig. Mabels verstorbener Gatte, der Bankier Samuel Franklyn, war ein Laienprediger übelster Sorte: ein bigotter, fanatischer Eiferer, der mit Inbrunst die ewige Verdammnis auf alle Sünder herab beschwor. Selbst der Tod konnte Samuel und seinen Missionseifer nicht stoppen; sein niederträchtiger Geist beherrscht „Two Towers“, die willenlose Mabel und tausend körperlose Seelen, Samuels Opfer, die ihr Gehorsam nicht ins Paradies, sondern in eine düstere Zwischenwelt fehlgeleitet hat, der sie nun verzweifelt und zornig endlich entkommen wollen. In einem letzten Aufflackern ihres Widerstandes hat Mabel Frances und William zu sich gerufen, doch die Geschwister können dem Ansturm der Verdammten ebenso wenig standhalten wie sie. Algernon Blackwood – Der Griff aus dem Dunkel. Gespenstergeschichten weiterlesen
Joe R. Lansdale – Sturmwarnung
Galveston, eine Stadt an der Ostküste der USA: An einem Septembertag steht „Lil‘ Arthur“ John Johnson vor der härtesten Herausforderung seines 22-jährigen Lebens. Der talentierte Nachwuchsboxer hat den Champion des örtlichen Boxclubs besiegt und den Meistertitel gewonnen – an sich ein sportliches Ereignis, doch Johnson ist schwarz, und der Gegner war weiß. Im Texas des Jahres 1900 gilt dieser Sieg als ungeheuerliche Niederlage der „überlegenen weißen Rasse“, die es unbedingt zu tilgen gilt. Ronald Beems, Präsident des „Sporting Clubs“, muss sich vor seinen rassistischen weißen Clubmitgliedern ‚rehabilitieren‘. Dafür gilt es den verhassten Johnson, der seine Krone behalten will und sogar vom sportlichen Aufstieg träumt, nicht nur zu besiegen sondern zu vernichten.
Beems meint das buchstäblich: Er heuert den brutalen Schläger John McBride an, der Johnson im Ring totschlagen soll. Die Polizei ist geschmiert, sie wird den illegalen ‚Kampf‘, der ohne Boxhandschuhe, d. h. mit den blanken Fäusten und ohne Regeln auszutragen ist, nicht verhindern. Johnson ist sich der Tatsache durchaus bewusst, dass man ihn nicht boxen, sondern sterben sehen will. Ehrgeiz und Stolz verbieten ihm vom Fight zurückzutreten.
Die gesamte Gemeinde fiebert dem öffentlichen Ende des „Niggers“ entgegen. Darüber entgeht den Bürgern, dass sich über der Küste zum Golf von Mexiko Schlimmes zusammenbraut. Das Barometer fällt, der Wasserpegel steigt. Doch man bleibt unbesorgt, denn diese Vorzeichen wollen zu einem Sturm noch nicht passen. Also werden keinerlei Maßnahmen getroffen. Aber man fühlt sich zu sicher. Während McBride und Johnson zum Kampf auf Leben und Tod antreten, nähert sich über dem Meer der Sturm des Jahrhunderts, der die Stadt und die meisten ihrer Bewohner auslöschen wird …
Boxkampf als Rassenkampf
Historische Eckpfeiler stützen das Handlungsgerüst dieses Kurzromans. Da ist primär die Rassendiskriminierung in den Südstaaten der USA um 1900. Die Zeit der Sklaverei liegt gerade dreieinhalb Jahrzehnte zurück, bis zur (zumindest gesetzlichen) Gleichstellung von Schwarz und Weiß wird noch mehr als ein halbes Jahrhundert vergehen. Die meisten Schwarzen stehen sich eher schlechter als die ehemaligen Sklaven. Seit sie nicht mehr als „bewegliches Gut“ gelten, das zum Zwecke der optimalen Arbeitsausnutzung ‚geschont‘ werden muss, betrachtet sie die weiße Mehrheit auf dem Arbeitsmarkt als Konkurrenten und gesellschaftlich als Bedrohung.
Gleichzeitig wächst eine neue schwarze Generation heran, die sich wie Arthur John Johnson nicht mehr mit der Rolle des bescheidenen, ausgebeuteten Tagelöhners und Arbeiters begnügen will, sondern mehr vom Leben fordert – für die weißen Rassisten, die keinesfalls von ihrer Macht und ihren wirtschaftlichen Privilegien auf Kosten der Schwarzen lassen wollen, eine unerträgliche Herausforderung. So ist das Zusammenleben der Rassen geprägt von Misstrauen und latenter Gewalt, die immer wieder offen ausbricht; die Leidtragenden sind fast ausschließlich von schwarzer Hautfarbe.
Vor diesem Hintergrund gewinnt der Kampf zwischen McBride und Johnson eine ganz neue Dimension. Der sportliche Aspekt ist Nebensache. Tatsächlich steht hier „Weiß“ gegen „Schwarz“ im Ring; Sieg oder Niederlage stützen oder stürzen Weltbilder. Verstärkt wird die Konfrontationssituation durch die besondere Variante des Boxkampfs, die in Galveston gewählt wird. Während in der offiziellen Welt des Sports schon seit 1867 die „Regeln für das Boxen mit Handschuhen“ des Marquess von Queensberry gelten, zieht eine brutalisierte Zuschauerminderheit den ‚ehrlichen‘ Kampf mit blanken Fäusten und ohne Regeln vor. Da dabei der Boxer schwer verletzt oder getötet werden kann, ist diese Art des Boxens verboten. Deshalb müssen solche Kämpfe illegal organisiert und heimlich ausgefochten werden.
Der Sturm des Jahrhunderts
Nicht grundlos spielt in diesem Roman das Wettergeschehen eine wichtige Rolle. Schon mehrfach fielen Hurrikans und Wasserwände über die Südostküsten der USA her, versenkten wie New Orleans ganze Großstädte, richteten Milliardenschäden an und kosteten Menschenleben. So war es auch im Jahre 1900, als ein Sturm unerhörten Ausmaßes Kurs auf Galveston nahm und die Stadt dem Erdboden gleichmachte. So absolut war die Zerstörung, dass niemals festgestellt werden konnte, ob nun 6000 oder 12000 Menschen der Katastrophe zum Opfer fielen. „Isaacs Sturm“ nannte der Schriftsteller Erik Larson sein bereits klassisches Buch über das Desaster von Galveston, das durch den Meteorologen Isaac Cline mitverschuldet wurde, der die Vorzeichen falsch deutete und auf dessen Fachwort man sich verließ, bis es zu spät war.
In dieser Geschichte geht es wie gesagt um mehr als einen Boxkampf. Autor Lansdale präsentiert uns eine Parabel: So wie Galveston und seine Bürger untergehen, weil sie ihrer Probleme nicht Herr werden können und den großen Sturm unbeachtet lassen, so kann es der Gesellschaft insgesamt ergehen, wenn sich die ethnischen, religiösen oder anderweitig differenzierten Gruppen nicht zusammenraufen. Insofern ist Lansdales Galveston ein Symbol und eine Ankündigung dessen, was im gerade angebrochenen 20. Jahrhundert folgen wird. Die Last der Vergangenheit wird zur Hypothek auf die Zukunft, die nie wirklich beginnen kann, solange die Beems auf dieser Erde das Sagen haben.
Lansdale-typisch kommt diese Lektion ganz und gar nicht trocken daher. Drastischer als er vermag kaum jemand eine brutalisierte, verkommene, erbarmungslose Welt in Szene zu setzen. Seine Protagonisten sind verroht, ihr Handeln und Denken beschreibt Lansdale ohne Rücksicht auf feinfühlige Leser. Sex oder Gewalt, Sex und Gewalt; in der schwülen Ruhe vor dem Sturm brodelt es in Galveston wie in einem Dampfkochtopf. Dass Lansdale diese Sprache bewusst als Stilmittel einsetzt, verraten jene Kapitel, in denen er den Sturm und sein Toben beschreibt. Hier schöpft er aus einem völlig anderen Wortschatz, schafft eindrucksvolle Stimmungsbilder, weiß die unwirkliche Apokalypse sicht- und spürbar zu machen.
Der große Gleichmacher
Die Welt ist schlecht und weil dem so ist, wird sie von entsprechenden Menschen bevölkert. Zumindest auf Galveston trifft dies zu. Keine der Hauptfiguren ist wirklich sympathisch. Auch John Johnson, der doch prädestiniert wäre für die Rolle des schwarzen Helden, der die Bande sprengt, die seine finsteren Zeitgenossen ihm übergeworfen haben, ist vor allem ein ganz normaler Mensch, der seinen eigenen Vorteil im Auge hat. Zwar denkt er auch an seine Familie doch als diese auf seine Hilfe angewiesen ist, lässt er sie im Stich, um seinem Stolz zu frönen.
Leicht macht es Lansdale seinen Lesern auch nicht mit den ‚Bösen‘. McBride ist ein egoistischer Mistkerl, der alle negativen menschlichen Eigenschaften in seiner Person vereinigt. Dennoch er ist kein Dummkopf, und ein großer Teil seiner Rücksichtslosigkeit basiert auf dem genauen Wissen um die gesellschaftlichen Realitäten seiner Epoche. Auch McBride wird niemals zur geachteten Oberschicht gehören. Seine momentane Prominenz verdankt er einzig seinen Fäusten. Deshalb kostet er die Privilegien, die ihm geboten werden, nach Herzenslust aus und verachtet jene, die sie ihm bieten.
McBride verprügelt seine Sparringspartner, seine Ringgegner, seinen Auftraggeber Beems. Er scheint nur an sich zu denken, doch als der Leser ihn richtig hasst, sieht man ihn plötzlich mit Johnson ein Baby aus den Trümmern von Galveston retten: Seinen Kontrahenten im Ring hasst McBride nicht; ihn zu verprügeln war nur ein Job. Der hat durch den großen Sturm sein Ende gefunden, also gibt es für McBride keinen Grund mehr, sich mit Johnson zu schlagen.
Somit ist der eigentliche Schurke der Rassist Ronald Beems? Lansdale foppt uns auch hier: Beems ist vor allem ein Schwächling, der panisch seine unterdrückte Homosexualität gleichzeitig zu leben und zu verbergen trachtet. Vordergründig hasst er Johnson, gleichzeitig begehrt er ihn. Trotz seiner Position in der Gesellschaft von Galveston ist Beems wie Johnson ein Gefangener, dem schriftlich fixierte und unausgesprochene Gesetze und Regeln ein selbst gestaltetes Leben versagen.
Eine ganze Anzahl von Nebenfiguren lässt Lansdale neben dem Dreieck Johnson – McBride – Beems auftreten. Sie bilden einen Querschnitt durch die Bevölkerung von Galveston. Knapp skizziert der Verfasser Figuren, die im Gedächtnis bleiben. Sie stehen stellvertretend für die vielen Opfer, die der Hurrikan von 1900 forderte. Der Sturm macht keinen Unterschied zwischen ‚guten‘ und ‚schlechten‘ Menschen; sie sterben ohne Unterschied oder überleben durch manchmal absurde Zufälle. Dieser Verzicht auf ein Schwarz-Weiß-Schema, das die Figuren allzu vieler Romane oder Filme in zwei Gruppen teilt, komplettiert die erfreulich lange Liste positiver Argumente, die sich für eine Lektüre von „Sturmwarnung“ anführen lassen.
Anmerkung
„Sturmwarnung“ basiert auf die zum Roman erweiterte Novelle „Der große Knall“, die 1997 Douglas E. Winters große Anthologie „Millennium“ (dt. „Offenbarungen“) einleitete, die sich literarisch mit den großen Veränderungen des 20. Jahrhunderts beschäftigte.
Autor
Joe Richard Harold Lansdale wurde 1951 in Gladewater im US-Staat Texas geboren. Als Autor trat Lansdale ab 1972 in Erscheinung. Gemeinsam mit seiner Mutter veröffentlichte er einen Artikel, der viel Anerkennung fand und preisgekrönt wurde. Mitte der 1970er Jahre begann er sich der Kurzgeschichte zu widmen. Auch hier stellte sich der Erfolg bald ein. Lansdale wurde ein Meister der kurzen, knappen Form. In rasantem Tempo, mit einer unbändigen Freude am Genre-Mix und am Auf-die-Spitze-Treiben (dem „Mojo-Storytelling“) legte er Story um Story vor.
Texas, sein Heimatstaat, war und ist die Quelle seiner Inspiration – ein weites Land mit einer farbigen Geschichte, erfüllt von Mythen und Legenden. Lansdale ist fasziniert davon und lässt die reale mit der imaginären Welt immer wieder in Kontakt treten. In seinen Geschichten ersteht der Wilde Westen wieder neu. Allerdings kann es durchaus geschehen, dass dessen Bewohner Besuch vom Teufel und seinen Spießgesellen bekommen. Es könnten auch Außerirdische landen.
Nach zwei Lansdale-Kurzgeschichten entstanden Kurzfilme („Drive-In Date“, „The Job“). Kultstatus erreichte Don Coscarellis Verfilmung (2002) der Story „Bubba Ho-tep“: Ein alter Elvis Presley und ein farbiger John F. Kennedy jagen eine mordlustige Dämonen-Mumie. Lansdale schrieb außerdem Drehbücher für diverse Folgen der Serien „Batman: The Animated Series“ und „Superman: The Animated Series“.
Der private Joe R. Lonsdale lebt mit seiner Frau Karen und den Kindern heute in Nacogdoches, gelegen selbstverständlich in Texas. Er schreibt fleißig weiter und gibt ebenso fleißig Kurzgeschichtensammlungen heraus. Außerdem gehören Lansdale einige Kampfsportschulen, in denen diverse Künste der Selbstverteidigung gelehrt werden.
Homepage von Joe Lansdale
Paperback: 166 Seiten
Originaltitel: The Big Blow (New York: Subterranean Press 2000)
Übersetzung: Hannes Riffel
Cover und Innenillustrationen: Marcus Rössler
Der Autor vergibt: 




Paul Chambers – Die Archaeopteryx-Saga. Das Rätsel des Urvogels
In 15 Kapiteln informiert Verfasser Paul Chambers populärwissenschaftlich über die Stammesgeschichte der Vögel. Als ‚Aufhänger‘ dient ihm dabei der Archaeopterix, der als erster „Urzeitvogel“ 1861 im bayrischen Solnhofen als Versteinerung gefunden (Kap. 1: „Der Glücksfund des Doktors“) und zum ‚Leitfossil‘ für die Rekonstruktion des Vogel-Stammbaums wurde. Der Archaeopterix stellte für die Zeitgenossen vor ein Rätsel, da er die Merkmale eines Reptils und eines Vogels vereint.
Er tauchte in einem Augenblick auf, als die Forscherwelt sich in einem religiös begründeten Streit zusätzlich entzweite. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Theorie einer Evolution der Arten nicht nur neu, sie widersprach auch der kirchlichen Lehre, wonach Gott Tiere (und Pflanzen) wie in der Bibel beschrieben geschaffen habe und diese unveränderlich seien. Das ‚Mischwesen‘ Archaeopterix verkörperte jenen Widerspruch, den die Anhänger der Evolution erwartet und deren Gegner gefürchtet hatten (Kap. 2: „Das fehlende Glied“; Kap. 3: „Der gefiederte Rätsel“). Paul Chambers – Die Archaeopteryx-Saga. Das Rätsel des Urvogels weiterlesen
Robert Louis Stevenson/Lloyd Osborne – Der Ausschlachter

Robert Louis Stevenson/Lloyd Osborne – Der Ausschlachter weiterlesen
King, Stephen – Colorado Kid
Das geschieht:
Moose-Lookit ist eine kleine Insel vor der Küste des US-Staates Maine. Die wenigen Bewohner leben vom Sommertourismus, ansonsten bleibt man unter sich. Über die Ereignisse des Insellebens informiert seit einem halben Jahrhundert der „Weekly Islander“, der vom neunzigjährigen Vince Teague und seinem Partner Dave Bowie herausgegeben wird. In diesem Sommer gesellt sich ihnen die 22-jährige Praktikantin Stephanie McCann hinzu. Die junge Frau kommt gut mit den beiden alten Männern klar und zeigt als Journalistin echtes Talent.
Eines Tages hört Stephanie vom „Colorado Kid“. Als sie neugierig nachfragt, erzählen ihr Teague und Bowie vom größten ungelösten Rätsel ihrer langen Laufbahn. 25 Jahre zuvor hatte man am Strand die gut gekleidete Leiche eines unbekannten Mannes gefunden, der offenbar an einem Stück Steakfleisch erstickt war. Er trug keine Papiere bei sich, es gab keine Anzeichen für ein Verbrechen. Die Nachforschungen der Polizei blieben erfolglos, die Leiche ohne Identität, bis mehr als ein Jahr später zufällig Name und Herkunft des Mannes entdeckt wurden: Von seinem Arbeitsplatz im US-Staat Colorado war der Zeichner James Cogan eines Tages plötzlich verschwunden, hatte seine Familie verlassen und war auf unbekannte Weise und in Rekordzeit nach Maine gereist, wo er am Strand von Moose-Lookit gestorben war.
Oder hatte man ihn ermordet? Die Indizien ließen sich in dieser Richtung deuten, aber bestätigen konnten Teague und Bowie diesen Verdacht nie. Ein Vierteljahrhundert später diskutieren sie den Fall Cogan mit Stephanie McCann und ordnen die Fakten neu, um der Kollegin eine wertvolle Lektion über den Journalistenberuf zu erteilen …
Nicht jede Ausgrabung fördert Gutes zutage
Seltsame Ideen sind keine seltene Erscheinung auf dem modernen Buchmarkt, gilt es doch ein Medium lukrativ zu halten, das im digitalen Zeitalter ein wenig altmodisch geworden ist. Immer gern gedrückt wird die Nostalgie-Taste, denn früher war bekanntlich alles besser, auch der Kriminalroman. In unserem Fall soll die Erinnerung an die Pulps der 1940er und 50er Jahre geweckt werden: billig hergestellte, mit grellen Umschlägen versehene Krimireißer voller Sex & Gewalt, die oft von den Großen des Genres in Rekordzeit in die Tasten (damals noch von Schreibmaschinen) gehauen wurden. Nicht selten verbargen sich in diesem Ghetto des Schrillen und Brutalen echte Klassiker, denen die Eile gut bekam, die ihre Verfasser an den Tag legen mussten in einer Zeit, als nur Cents pro Wort gezahlt wurden.
Die Pulp-Tradition wurde 2004 in der US-Reihe „Hard Case Crime“ wiederbelebt. Mehr oder weniger bekannte Autoren schreiben neue Thriller der alten Art, die mit Titelbildern im plakativen Stil versehen und als Taschenbücher preisgünstig auf den Markt geworden werden. Auch Stephen King, der stets bestrebt ist, Marktnischen auszuloten, ließ sich anheuern. Mit „The Colorado Kid“ steuerte er im Oktober 2005 den 13. Band zur Serie bei.
Abergläubische Zeitgenossen könnten darauf hinweisen, dass dieses Experiment aufgrund der Unglückszahl scheitern musste. Das wäre freilich auch die Antwort eines verzweifelten King-Fans, für den der Meister einfach nichts falsch machen kann. Aber er kann, und er hat es hier eindrucksvoll – und glücklicherweise seitenschwach – unter Beweis gestellt.
Vom Rätsel über das Indiz zur Lösung
„Colorado Kid“ wird von King nicht als „hard boiled thriller“ angelegt, sondern ist eher ein philosophischer Exkurs über das Wesen des (journalistisch aufbereiteten) Rätsels. Drei Menschen unterhalten sich über einen Vorfall, der sich vor langer Zeit ereignete und ungeklärt blieb. Wie in einem ‚richtigen‘ Krimi werden Tatort, Indizien und Verdächtige präsentiert. Doch eine Auflösung bleibt aus. Wie so oft im realen Leben gibt es zu wenige Fakten, um das Puzzle zu vervollständigen. Stephanie McCann hat begriffen, was ihre Mentoren sie eigentlich lehren wollten: Ein Rätsel ohne Zugang ergibt keine Geschichte, sondern schafft nur Verdruss und sollte deshalb ungeschrieben bleiben.
Zu Kings Pech trifft Teagues & Bowies Lehrsatz auf auch „Colorado Kid“ voll und ganz zu. Selten ziehen sich knapp 180 großzügig bedruckte Seiten so in die Länge wie hier. Man kann und mag nicht glauben, dass wirklich Stephen King dieses Stückchen Nicht-Unterhaltung zu Papier gebracht hat. Er legt „Colorado Kid“ wie einen seiner epischen Romane an. Zwei Drittel des Buches sind bereits gelesen, und wir befinden uns immer noch in der Einleitung, dem durchaus gelungenen Stimmungsbild einer von der Zeit ein wenig vergessenen Maine-Insel und ihrer angenehm kauzigen Bewohner. Erst dann scheint King einzufallen, dass er ja eine Geschichte zu erzählen hat, nur dass da wie gesagt keine Geschichte ist. Diesen Widerspruch spannend aufzulösen ist ihm gänzlich misslungen.
Aus Figuren werden Menschen
Auf der anderen Seite ist „Colorado Kid“ keineswegs schlecht geschrieben. King, der geborene Geschichtenerzähler, der sich erfolgreich auch jenseits der Phantastik tummelt, hat nach wie vor ein Schreibhändchen für Figuren, die vor dem geistigen Auge Gestalt annehmen. Das ist eine echte Gabe, zumal sich die Handlung in diesem Büchlein auf ein Gespräch zwischen drei Personen beschränkt. Was sich ereignet hat, wird nur erzählt, und das nicht am Stück. Immer wieder unterbrechen Dialoge die Rückblenden ins Jahr 1980, dazu kommen Sprünge, wie sie für eine Unterhaltung typisch sind.
Dennoch ist King die schwierige Aufgabe gelungen, zwischen zwei alten Männern und einer jungen Frau eine besondere, von anzüglichen Untertönen völlig freie Beziehung zu schaffen. Hier diskutieren drei Profis, die sich miteinander wohl fühlen. Als ‚vierte Person‘ tritt Moose-Lookit dazu, die kleine Insel, die auf jene, die für ihr Flair anfällig sind, eine eigenartige Anziehungskraft ausübt. James Cogan musste, Stephanie McCann darf es erfahren, denn im Verlauf der Geschichte schält sich allmählich heraus, dass sie auf Moose-Lockit bleiben und als Journalistin arbeiten wird.
Solche literarischen Kabinettstückchen reichen unterm Strich aber nicht aus. „Colorado Kid“ bleibt eine langweilige, überflüssige Angelegenheit. Der Name Stephen King ist es, der dieses Büchlein verkauft. Dessen Preis ist niedrig aber für das Gebotene trotzdem zu hoch, „Colorado Kid“ weniger eine Weihnachtsüberraschung als ein Windei, das sich nur der King-Komplettist ins Nest legen lassen sollte.
Autor
Eine Biografie des Stephen King kann ich mir an dieser Stelle sparen. Über den Verfasser unzähliger Bestseller der Unterhaltungsliteratur informieren ausführlich und zum Teil vorbildlich viele, viele Websites, zu denen selbstverständlich auch des Meisters eigene (www.stephenking.com) gehört.
Impressum
Originaltitel: The Colorado Kid (New York : Mass Market Paperback 2005)
Übersetzung: Andrea Fischer
Deutsche Erstausgabe: Dezember 2005 (Ullstein Taschenbuchverlag/TB Nr. 26378)
159 S.
ISBN-13: 978-3-548-26378-6
Neuauflage: Mai 2009 (Wilhelm Heyne Verlag/TB Nr. 43396)
176 S.
EUR 7,95
ISBN-13: 978-3-453-43396-0
www.randomhouse.de/heyne
Als e-Book: PeP-Verlag
ISBN-13: 978-3-641-03284-5
EUR 7,95
www.randomhouse.de/pep
Erik Larson – Isaacs Sturm

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts scheint der Mensch erstmals und endlich in der Lage zu sein, die Welt zu verstehen und nach seinem Willen zu formen. Details machen ihm noch zu schaffen, aber auch das wird sich binnen kurzer Zeit gewiss ändern. Der berechtigte Stolz darauf, was Technik und Wissenschaft in den geschaffen haben, geht freilich leicht in Hybris über. Diese Lektion muss die aufstrebende Weltmacht USA im Sommer des Jahres 1900 auf grausame Weise lernen.
Vielleicht ist gesunder Menschenverstand zu viel verlangt für ein nationalstolzes Land, das sowohl energisch als auch erfolgreich daran arbeitet, politisch und militärisch seine Konkurrenten auszuschalten. Gerade erst haben die Vereinigten Staaten einen Krieg mit Spanien vom Zaun gebrochen, mit geradezu spielerischer Leichtigkeit gewonnen und die karibische Kolonie Kuba in ihren Besitz genommen.
Isaac Cline ist der perfekte Repräsentant der neuen Zeit. Der junge Mann stammt aus relativ einfachen Verhältnissen, doch mit seinem messerscharfen Verstand, seiner nie versiegenden Energie und seinem unerhörten Arbeitseifer gelingt ihm die Realisierung des „Amerikanischen Traums“, der ihn binnen weniger Jahre zu Reichtum, Anerkennung und gesellschaftlichem Aufstieg führt. Clines Interesse gilt dem Wetter und vor allem der Möglichkeit, es vorauszusagen. Um 1900 beginnt sich die Meteorologie von einer Schwarzen Kunst in eine Wissenschaft zu verwandeln und in ein Politikum: Unter der Flagge der Vereinigten Staaten fährt um die Jahrhundertwende eine der mächtigsten Flotten der Welt.
Wissen ist tatsächlich Macht
Die größte Gefahr droht diesen Schiffen nicht von ihren Feinden, sondern von unvorhergesehenen Stürmen auf hoher See. Besonders in der Karibik, dem gerade gewonnenen Vorhof der jungen Großmacht, gehen auf diese Weise jährlich zahlreiche Schiffe und ihre Besatzungen buchstäblich zugrunde. Die besonderen Wetterverhältnisse führen über dem Golf von Mexiko in jedem Sommer zur Entstehung von Hurrikans, gewaltigen tropischen Wirbelstürme, die von ihrer Wiege, dem afrikanischen Kontinent, über den Atlantik kommend, entlang der Küstenlinie des nördlichen Südamerikas und Mittelamerikas eine Kurve nach Nordosten über die USA schlagen und dabei alles verwüsten, was ihren Weg kreuzt.
Zu den besonders gefährdeten Bundesstaaten gehört Texas, das dem Europäer eher durch Prärien und kleine Städte des Wilden Westens präsent ist, tatsächlich jedoch über eine lange Küste zum Golf von Mexiko verfügt. Hier liegen die beiden Städte Houston und Galveston, die um 1900 darum wetteifern, zur Hauptstadt ihres Staates zu werden. Die Waagschalen neigen sich allmählich zu Gunsten Galvestons. Das US Wetteramt siedelt seinen Chef Meteorologen für Texas hier an, da Galveston einen Logenplatz auf die labile Wetterlage der westindischen Region bietet.
Seit gut einem Jahrzehnt steht Isaac Cline der angesehenen Wetterstation in Galveston vor. Er gehört zur Prominenz der Stadt, hat nebenbei Medizin studiert, schreibt Artikel über seine Arbeit, gibt Vorlesungen und hat sogar die Zeit gefunden, eine Familie zu gründen. Alles ist planmäßig gelaufen im Leben Clines, der im Jahre 1900 auf der Höhe seiner Karriere steht. Er glaubt alles über das Wetter zu wissen, was die moderne Meteorologie, als deren hervorragender Vertreter er sich ohne falsche Bescheidenheit sieht, herausgefunden hat. Dass er sich quasi anmaßt, die Naturgesetze zu diktieren, ist ihm nicht bewusst. Hurrikans, davon ist Cline überzeugt, kündigen sich durch unverwechselbare Vorzeichen an. Solange er diese nicht am Himmel erkennt, wird es ergo auch kein Unwetter geben.
Ein verhängnisvoller Irrtum
Der große Hurrikan von 1900 will sich nicht in Clines Weltbild fügen. Eine Reihe klimatischer Ausnahmebedingungen lässt ihn direkten Kurs auf Galveston nehmen. Die Katastrophe naht nicht unbeobachtet, doch Cline, der den Himmel über Galveston und die Gezeiten beobachtet, kommt zu dem Schluss, dass der Sturm sich auflösen wird, bevor er die Stadt erreicht. So gibt es für die Bürger von Galveston keine Vorwarnung. Ahnungslos gehen sie ihren alltäglichen Geschäften nach, während der Hurrikan sich über dem Golfstrom nähert und dabei eine gewaltige Flutwelle vor sich aufzuschieben beginnt.
Galveston ist eine Boomstadt, die praktisch planlos und genau dort an der Küste errichtet wurde, wo es zwischen Meer und Land keinerlei Hindernis gibt, die eine Flutwelle brechen oder einen Sturm ablenken könnte. Die Bürger haben es aus Bequemlichkeit und Kostengründen nie für nötig befunden, einen schützenden Damm zu bauen. So nimmt das Verhängnis seinen ungehinderten Lauf: Binnen weniger Stunden wird Galveston ausgelöscht. Mindestens 6000 Menschen, vielleicht aber auch die doppelte Anzahl, verlieren ihr Leben. Genau wird man es niemals wissen, weil sich die Stadt in eine riesige Schlamm und Trümmerwüste verwandelt hat, unter der zahllose Opfer für immer begraben liegen.
Die verdrängte Katastrophe
Der Untergang der Stadt Galveston gehört zu jenen Ereignissen, die aus zunächst unerfindlichen Gründen zu einer Fußnote der Weltgeschichte herabgesunken sind. Bei näherer Betrachtung trifft man allerdings sehr alte Bekannte wieder, die dafür verantwortlich sind: Dummheit, Ignoranz, Selbstgefälligkeit, vor allem aber der tief verwurzelte menschliche Drang, unangenehme Erfahrungen zu verdrängen besonders dann, wenn man sie zwar verschuldet hat, aber selbst nicht betroffen ist.
Die wahre Tragödie ist weniger die Katastrophe selbst, sondern die Tatsache, dass sie in diesem Ausmaß hätte verhindert werden können. Dieser Erkenntnis mochte man sich bisher nicht einmal in Galveston selbst stellen. Dort sang man lieber das hohe Lied des Heldentums im Angesicht der drohenden Gefahr, und am lautesten erklang das Lob für Isaac Cline, den angeblichen Helden, der selbstlos seine Mitbürger noch vor dem Hurrikan warnte, als die Sturmflut bereits ganze Häuserzüge durch die Luft wirbelte. Cline hat persönlich an seinem Denkmal gearbeitet, und das gelang ihm angesichts seines publizistischen Geschicks hervorragend, zumal er so alt wurde, dass er jene, die es besser wussten, in der Mehrzahl einfach überlebte.
Erik Larson hatte es folglich nicht leicht, als er sich daran machte, die Geschichte Galvestons und des großen Hurrikans von 1900 zu rekonstruieren. Der Sturm hat die frühen Archive vor Ort vollständig vernichtet. Aber in den Familien der zahllosen Opfer fand Larson viele Augenzeugenberichte, die ein in dieser Klarheit bisher nicht gekanntes Bild der Katastrophe zeichnen. Die detaillierte Schilderung des Sturms und seiner Folgen ergänzt Larson durch einen ausführlichen Blick auf die Geschichte der Vereinigten Staaten an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Ohne würden die Ereignisse in Galveston unverständlich bleiben. Nicht fehlen darf eine Einführung in die Wetterkunde und hier naturgemäß in die Genese großer Wirbelstürme.
Der Leser als Zeuge
Larson wählt für sein Buch die Form des Tatsachenromans. Er schildert, was gewesen ist, scheut sich aber nicht, Lücken durch (allerdings gut abgesicherte) Vermutungen zu schließen. Wie der große Hurrikan vor der westafrikanischen Küste entstand und seinen verhängnisvollen Weg nahm, ist inzwischen geklärt. Larson präsentiert die komplizierten Mechanismen des Wetters verständlich und spannend zugleich. Dies gilt auch für die politischen Intrigen im und um das Wetteramt, die wohl hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass der Sturm ein völlig ahnungsloses Galveston traf.
„Isaacs Sturm“ ist nicht nur die Chronik einer Katastrophe, sondern auch die Tragödie eines Mannes, der (zu) viel wusste und doch unwissend war. Um 1900 benannte man große Stürme nach prominenten Opfern. Larson greift diese Tradition auf. Auch wenn Isaac Cline (1862 1955) das Unglück überlebte und niemals zur Rechenschaft gezogen wurde, blieb er für den Rest seines langen Lebens gezeichnet: Mit seiner Frau kam sein ungeborenes jüngstes Kind um, und in Augenblicken echter, von Selbstbetrug freier Reflexion begriff Cline durchaus, dass er und sein verehrtes Wetteramt kapitale Fehler begangen hatten.
Eric Larson ist mit „Isaacs Sturm“ zu Recht ein Bestseller gelungen. Mit dem Talent des echten Erzählers behält er die Fäden seiner Geschichte, die den halben Erdball umspannen, jederzeit fest in der Hand. „Spannend wie ein Krimi“ ist ein Urteil, das (viel zu) oft über ein Buch gesprochen wird, doch auf „Isaacs Sturm“ trifft es
zweifellos zu. Wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann das Fehlen von Bildern, die es in großer Zahl gibt. Aber das Internet gleicht dieses Manko aus. Die Eingabe der Begriffe „Galveston“ und „hurrican“ genügt, um zeitgenössische Fotos aus der dem Erdboden gleichgemachten Stadt betrachten zu können.
Autor
Erik Larson (geb. 1954) wuchs in Freeport, Long Island, auf. Er absolvierte die University of Pennsylvania, die er mit einem Abschluss in Russischer Geschichte verließ. Klugerweise ergänzte er dies mit einem Studium an der Columbia Graduate School of Journalism. Im Anschluss arbeitete er viele Jahre für diverse Zeitungen und Magazine.
Inzwischen hat Larson diverse Sachbücher veröffentlicht, von denen „Isaac’s Storm“ (1999, dt. „Isaacs Sturm“) ihm den Durchbruch und Bestseller-Ruhm brachte. Der Autor lebt mit seiner Familie in Seattle.
Taschenbuch: 373 Seiten
Originaltitel: Isaac’s Storm. A Man, a Time, and the Deadliest Hurricane in History (New York : Crown Publishers 1999)
Übersetzung: Bettina Abarbanell
http://www.fischerverlage.de
Der Autor vergibt: 




Jean M. Auel – Ayla und der Stein des Feuers (Erdenkinder 5)
30000 Jahre mag es her sein, da wird an der Küste des Schwarzen Meeres Ayla, ein kleines, halb verhungertes, durch ein Erdbeben eltern- und stammeslos gewordenes Mädchen vom Menschenschlag der Cro-Magnons – Sie und ich gehören ihm noch heute an – von einer Horde Neandertaler (der leicht vormenschlichen Konkurrenz), dem „Clan der Höhlenbären“, gefunden und aufgenommen – recht widerwillig, entspricht doch die Neue mit ihrem schlanken, geraden Wuchs, den blauen Augen, der hohen Stirn und den blonden Haaren so gar nicht den Schönheitsidealen ihrer krummbeinigen, wulstbrauigen und wortkargen Gastgeber. Das hässliche Schwänlein muss unter vielen stolzen Enten denn auch ein an Zuneigung armes aber an Knüffen und Püffen umso reicheres Dasein fristen, das durch die Feindschaft zwischen den „Anderen“, wie die Neandertaler Aylas Leute nennen, und den „Flachköpfen“, wie diese wiederum ihre urtümlichen Nachbarn schimpfen, nicht eben einfacher wird. Trotzdem arrangiert man sich, und Ayla schenkt sogar einem Sohn das Leben, der sich zwar schon im Vorschulalter rasieren müsste aber trotzdem von seiner Mutter heiß geliebt wird, bevor diese ihn dem fiesen, intriganten Kindsvater überlassen muss, als der Clan der Höhlenbären sie schnöde verstößt. („The Clan of the Cave Bear“, 1980; dt. „Ayla und der Clan des Bären“)
Es schließen sich einsame Lehr- und Wanderjahre eines Engels auf (vorzeitlicher) Erden an, der viel zu edel für diese Welt ist sowie dank eines schamanischen Crash-Kurses bei erwähntem Höhlenbären-Clan einen guten Draht zu Mutter Natur und ihren übersinnlichen Kindern besitzt. Diese sitzen irgendwo auf Wolke Sieben und lenken von dort die Geschicke derer, die da unter ihnen k(r)euchen und fleuchen. Einen Odem purer Güte und Nächstenliebe ausdünstend und im absoluten Wissen um die Heilkraft jedes Kräutleins, das da blüht, gelingt es Ayla, a) den bösen Wolf zum braven Haushund, b) das wilde Pferd zum geduldigen Reittier und c) den edlen Löwen zum Kingsize-Kätzchen zu zähmen. Nachdem sie diese Künste zur Vollendung gebracht hat, naht auch Mr. Right: der Werkzeugmacher Jondalar, wohlgestaltet, einfühlsam, liebevoll und – nicht zu vergessen – ein toller Liebhaber. Dieses Gottesgeschenk an die moderne Frau von Vorgestern hat auf einer kühnen Reise, die Jondalar aus seiner weit entfernten Heimat, der südfranzösischen Dordogne, den Fluss Donau – hinabführte, buchstäblich Schiffbruch erlitten und muss von Ayla zusammengeflickt und gepflegt werden, bevor man sich näherkommen und die gemeinsame Rückkehr in Jondalars Heimat beschließen kann. („The Valley of Horses“, 1982; dt. „Das Tal der Pferde“)
Gar lang ist die Reise, dazu hart und beschwerlich, und sie wird nicht einfacher dadurch, dass Ayla und Jondalar immer wieder warten müssen, während die Große Geistin dieser Urzeit-Welt – vulgo Jean M. Auel genannt – ihrer Neigung frönt, jedem Grashalm, jedem Pilz und jedem Kleintier, der oder das am Wegesrande sichtbar wird, aus- und abschweifende Exkurse zu widmen („essbar“ – „heilend“ – „kleidsam“). Kein Wunder, dass es gar nicht mehr vorwärtsgeht, als unser Paar auf Menschen trifft. Die Mamutoi oder Mammut-Jäger des Löwenlagers pirschen den großen Urzeit-Elefanten hinterher. Ayla ist angetan von diesem Stamm, und diese Zuneigung wird erwidert: Der schwarzhäutige Ranec ist‘s, der hier der blonden Fremden nachzusteigen beginnt. Für den armen Jondalar brechen harte Zeiten an, denn der Rivale ist fast so ein guter Frauenversteher wie er, sodass Ayla über 800 Seiten hin- und hergerissen wird, bevor man wieder zusammenfindet und die Reise nach Frankreich fortsetzt. („The Mammoth Hunters“, 1985; dt. „Mammutjäger”)
Die nächsten Tage und Wochen verbringen Ayla und Jondalar damit, ihre angeschlagene Beziehung wieder zu kitten. Spannungen, die trotz wertvoller & endloser Frau-Mann-Gespräche zurückbleiben, werden vorzeitlich unbekümmert in den Feuern der „Wonne“ verbrannt. Nachdem man sich so die Donau-Auen hinaufdiskutiert und -gebumst sowie zwischenzeitlich hustende Neandertaler oder bauchwehkranke Cro-Magnon-Genossen mit selbstgebrauter, ökologisch einwandfreier Medizin kuriert hat, wird es noch einmal dramatisch: Amazonen (!) verschleppen Jondalar in ihr Lotterlager, wo er für kräftige Nachkommen sorgen soll. Die kluge Ayla kann ihn vor diesem schrecklichen Schicksal retten, und man setzt die Reise auf die oben beschriebene Weise fort. Dann gilt es noch einen Gletscher zu überwinden, und im Finale ist das Ziel zum Greifen nahe. („The Plans of Passage“, 1990; dt. “Ayla und das Tal der Großen Mutter“)
Das geschieht dieses Mal:
Home at last! Zwölf reale Jahre nach Beginn ihrer ausgedehnten Lust- und Studienreise erreichen Ayla und Jondalar endlich die Dordogne und die Zelandonii der Neunten Höhle. Der Empfang ist allerdings nur partiell herzlich, denn die freigeistige Ayla eckt wieder einmal an. Das geht schnell in dieser höchst komplexen, von schier unendlich vielen, bekannten und ungeschriebenen Regeln, Protokollen und Kodizes bestimmten Gemeinschaft, die selbst das englische Könighaus vor Neid erblassen ließe. Ayla kann Tiere zähmen und Feuer mit Hilfe von Steinen entfachen: Talente, die von den Priesterinnen des Clans mit Misstrauen und Konkurrenzängsten zur Kenntnis genommen werden.
Aber Ayla spuckt grazil in die Hände und beginnt beherzt, ein weiteres Land unserer Ahnen im Sturm zu erobern. Mit gnadenloser Freundlichkeit und Herzenswärme sucht Mrs. Supertüchtig Höhle um Höhle heim, heilt alles Sieche nieder, beschämt dumme, geile Kerle und gewinnt die Herzen der weisen Frauen. Schließlich stürmt sie sogar die letzte Klippe, auf der lange unbezwingbar Marthona hockte, die gestrenge Schwiegermutter, der nicht gefällt, was Sohn Jondalar da aus fernen Landen in Höhle Nr. Neun geschleppt hat.
Doch von ebendiesem Jondalar empfing Ayla in einem wahren Pandämonium der Liebe, des Glücks und des geschriebenen Kitsches inzwischen ein Kind, das nach knapp tausendseitiger Schwangerschaft endlich das Licht der Welt erblickt und im bereits angedrohten sechsten Teil der „Erdenkinder“-Saga mit seinen Eltern, Freunden und Feinden sicherlich noch viele gute Zeiten, schlechte Zeiten durchleben und durchleiden wird.
„The same procedure as every year”
Da ist sie also wieder – die blonde Ayla, Schamanin, Super-Mom, Klassefrau & Mutter Theresa der Steinzeit. Dabei schien endlich Ruhe zu sein im Steinzeit-Karton, als sich Ayla und Jondalar in Band 4 zwölf Real-Jahre zuvor verabschiedet hatten. Im Schlusskapitel winkten schon die Zelandonii: ein durchaus taugliches Ende für eine Saga, die sich längst in Agonie dahinschleppte. „Ayla und das Tal der Großen Mutter“ war eine Zumutung; eine geschwätzige, kitschige Seifenoper im pseudo-exotischen Gewand, künstlich über jede Lesbarkeit hinaus aufgeblasen durch ausufernde Landschaftsbeschreibungen, peinliche Folkloredarbietungen und vor allem durch die zum Wahnwitz geronnene Manie der Verfasserin, ihre Leser noch über die Herstellung der letzten Haarnadel exakt ins Bild zu setzen.
Die Rekonstruktion des Steinzeit-Alltags war Jean M. Auel immer ein Herzensanliegen, zumal die Darstellung der Ergebnisse entsprechender Recherchen die Autorin einer Verpflichtung enthob, der sie mangels Talent oder Disziplin selten nachkommen konnte: Spätestens seit „Das Tal der Pferde“ erzählte Auel keine Geschichten mehr, sondern betätigte sich als Schreibautomat, bei dem nach jeweils tausend niedergeschriebenen Seiten die Batterie gewechselt wurde.
Zwölf Jahre Pause – man sollte meinen, Auel habe mehr als genug Zeit gehabt, sich endlich Neues einfallen zu lassen. Stattdessen mutet sie uns üblichen Quark zu, nur dass dieser noch ein gutes Stück breiter getreten wird. Schlimmer: „Der Stein des Feuers“ ist eine dreiste Neuauflage von „Der Clan des Bären“ – dieses Mal ohne Neandertaler.
Dass die Zelandonii stattdessen der Sprache mächtig sind, erweist sich als zusätzliches Manko: Kein Mund will stillstehen in ihren Höhlen, und was wir hören, erinnert fatal an die Endlos-Seifenopern des Fernsehens. Mag sein, dass sich die Menschen seit 30000 Jahren nicht grundsätzlich verändert haben und Intrigen, Klatsch und üble Nachrede auch den Alltag in den Höhlen der Dordogne bestimmten. Das möchte ich jedoch nicht unbedingt in epischer Breite nachlesen – und falls doch, dann bitte so, dass mir ob der unter dem Gewicht der ihnen aufgeladenen Klischees neandertalerkrumm daherkommenden Figuren, der Dämlichkeit der Dialoge oder des absoluten Leerlaufs der weitgehend durch Abwesenheit glänzenden Story nicht ständig die Tränen kommen.
In einem ist Auel allerdings konsequent: Immer wenn man glaubt, nun könne es einfach nicht schlimmer kommen, widerlegt sie dies mit Leichtigkeit. Dieses Mal lässt sie ihren Röntgenblick nicht nur über jeden Stein und jeden Strauch in und um die Zelandonii-Höhlen schweifen; wir können den Ort des langweiligen Geschehens anschließend quasi aufzeichnen. Zusätzlich wird ausführlich wiederholt, was in den vorangegangenen vier Bänden der „Erdenkinder“-Saga geschehen ist. Sicherlich muss die lange Pause nach Teil 4 irgendwie überbrückt werden. Wieso dies nicht in einer Zusammenfassung vor dem Einsetzen der eigentlichen Handlung geschehen konnte, bleibt rätselhaft. Stattdessen nerven Ayla und Jondalar die Leser, die ohnehin die Vorgängerbände kennen, mit uferlosen „Weißt-Du-noch?“-Histörchen.
Wenn der Höhlensegen schiefhängt
Unterhaltungsfeindlich sind darüber hinaus Auels ebenso hartnäckige wie vergebliche Versuche, neben der Alltags- auch die Geisteswelt der Steinzeit zum Leben zu erwecken. Historiker und Archäologen kennen eine scherzhafte Faustregel, nach der jeder Fund, der sich nicht anderweitig deuten lässt, dem Kultisch-Religiösen zuzuordnen ist. Gleichzeitig wird sich jeder Wissenschaftler, der diese Bezeichnung verdient, heftig hüten, Aussagen über Kult und Riten lange versunkener Kulturen zu treffen, die über Theorien hinausgehen.
Auel hat als Schriftstellerin freie Bahn, und diese Chance nutzt sie: nur leider nicht besonders einfallsreich. Ihre Geisterwelt wird von allerlei Muttergottheiten bevölkert, die im Einklang mit der Natur (und Gott ist für Auel definitiv eine Frau) schwingen und stets wissen, was am besten ist für Mensch und Tier. Hinter der Dunstwolke aufwändig geschilderter (und breit ausgewalzter) Zeremonien treten allerdings keine kosmischen Wahrheiten, sondern hausbackene Binsenweisheiten zutage: Vertragt euch; hört auf eure Mütter/Frauen/Priesterinnen; seid nett zu Kindern, Tieren und Neandertalern.
Wenn‘s dann trotzdem nicht klappt mit Friede, Freude & Eierkuchen, tragen ganz gewiss die nicht unbedingt bösen, sondern eher ignoranten und nie ganz erwachsenen (oder zurechnungsfähigen) Männer die Schuld: Die „Ayla“-Saga startete 1980 und ist in gewisser Weise selbst inzwischen zur historischen Quelle geworden: als (allerdings vielfach gebrochenes und trivialisiertes) Spiegelbild einer feministischen Weltsicht, wie sie einst en vogue war. „Die Vernichtung der weisen Frauen“ hieß ein typischer Sachbuch-Bestseller dieser Zeit, der die europäischen Hexenverfolgungen des 13. bis 18. Jahrhunderts als Verschwörung missgünstiger und um ihre Macht fürchtender Patriarchen gegen ein Netzwerk starker, kluger, heilkundiger, vor allem aber selbstständiger Frauen deutete. Diese Theorie hat sich inzwischen erledigt, und der Feminismus hat sich weiterentwickelt
Zurück blieb Ayla, die weiterhin die Fackel hochhalten muss, die Auels Leser/innen ins matriarchalische Utopia leiten soll, wie es in den 1970er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts beschworen wurde. Immerhin: Hübsch anzuschauen durfte Ayla trotzdem immer sein; so weit ging Auels schwesterliche Solidarität doch nicht, ihrem Publikum eine vierschrötige Höhlen-Walküre als realistische Heldin zu präsentieren. Den Rest erledigt popularisiertes New Age-Gewaber US-amerikanischer Prägung. Was sich in den Höhlen der Zelandonii abspielt, erinnert stets verdächtig an die Zeremonien, die sich die Medizinmänner (oder hier besser -frauen, die es ja auch gegeben hat) diverser Indianerstämme in der Vergangenheit ausgedacht haben. Erst hat man die nordamerikanischen Ureinwohner für Hollywood vom Pferd geschossen, nun werden sie von zivilisationsmüden Heilssuchern verkitscht, die sich aus dem reichen Mythengut herauspicken, was den Weg ins Nirvana angeblich abkürzt und dabei auch noch spannend unterhält.
Der Fluch des Erfolgs
Aber kann ausschließlich Jean M. Auel verantwortlich für das „Ayla“-Elend gemacht werden, das über die lesende Welt kommt? Die Verfasserin steht in einer langen, langen Reihe von Autoren, die eine Schnulze durch eine exotische Kulisse aufwerteten. Vor vielen Jahren gab Auel ihr Bestes als hoffnungsvolle Neu-Autorin und traf mit einem im Rückblick allenfalls mittelmäßigen aber durchaus lesenswerten Werk den Geschmack eines Publikums, das zu diesem Zeitpunkt auf „Ayla und der Clan des Bären“ gewartet zu haben schien. Binnen eines Monats ging dieser Titel mehr als 100000 Mal über die Ladentische. Ein Star war geboren, einem Stephen King oder einer Joanne K. Rowling durchaus vergleichbar – auch finanziell: 34 Millionen verkaufte Exemplare später kassierte Auel als Vorschuss (!) für die Ayla-Romane 4 bis 6 25 Mio. Dollar; nicht schlecht für eine Hobby-Autorin, die erst im Alter von 42 Jahren zum Schreibtisch fand.
Das Honorar ist wohl der eigentliche Schlüssel zu Aylas Wiedergängertum: 2002 spürte Auel nach zwölf aylalosen Jahren offenbar den Druck ihrer Geldgeber, endlich den versprochenen Nachfolgeband zu liefern. Diese Theorie würde das traurige Ergebnis jedenfalls erklären. Der Verlag bekam, was er wollte: kein Buch, das man einen Roman nennen dürfte, aber einen dicken Stapel beschriebenen Papiers, das sich unter dem eingeführten Markenzeichen „Auel“ als „Ayla V.“ prächtig vermarkten lassen würde.
Lesen würden diesen Schinken alle Ayla-Fans, aber kaufen sollten ihn noch viele, viele weitere Menschen. Die Strategie ist bekannt: Hinter dem multimedial begleiteten „Event“ kann der Anlass ruhig verschwindet. So wurde die Buchpremiere von „Ayla und der Stein des Feuers“ 2002 in Les Eyzies im Herzen Frankreichs als gigantisches Pressespektakel inszeniert. Hier lebten, liebten und litten einst Auels Hollywood-Cro-Magnons. Über 150 Journalisten fielen ein, um die Starautorin zu treffen. Diese erzählte die stets gern gehörten Geschichten ihrer Recherche-Touren, die sie nicht nur auf Aylas und Jondalars Spuren durch Russland, die Ukraine, Tschechien, Ungarn, Österreich, Deutschland und Frankreich führte, sondern die pflichtbewusste Autorin auch dazu animierten, Tiere in Fallen zu fangen, Steinwerkzeuge zu basteln, Matten zu knüpfen und natürlich Archäologen, Anthropologen oder Biologen zu befragen.
Elend mit Epilog
Das Buch hatten diese und andere Steigbügelhalter wohl nie gelesen, es war nicht erforderlich, da Veranstaltungen wie die in Les Eyzies ihren eigentlichen Zweck glänzend erfüllten. Die Schlagzeilen ebneten „Ayla V.“ den Weg zu neuerlichem Bestseller-Ruhm und Rekord-Auflagen. In Deutschland ging trotzdem lieber kein Risiko ein. Noch bevor sich womöglich jene Spielverderber zu Worte meldeten, die „Ayla und der Stein des Feuers“ tatsächlich lesen & für mies befinden würden, ließ man das Werk in einer Hauruck-Aktion von zwei simultan arbeitenden Übersetzern in unsere Muttersprache. Das Risiko war allerdings kalkulierbar gering: „Ayla V.“ wurde von 34 Verlagshäusern weltweit gleichzeitig in die Buchhandlungen gepresst!
Diese Prozedur wiederholte sich mit „Ayla VI.“ und wurde durch das Internet ergänzt. Abermals hatte Auel sich viele Jahre Zeit gelassen. „Ayla und das Lied der Höhlen“ wurde 2011 zum Offenbarungseid einer sichtlich ausgeschriebenen, kranken, alternden Autorin, die endlich zu Ende bringen wollte, wozu sie sich verpflichtet hatte. Selbst Hardcore-Auel-Fans konnten und wollten ihren Unmut über ein ‚Buch‘ nicht unterdrücken, das die bekannte Ayla-Rezeptur noch einmal aufkochte und dabei endgültig in Esoterik-Schwurbel versandete.
Seltsamerweise hielten sich Kino und Fernsehen bisher zurück mit der Verfilmung von Auel-Abenteuern. Zwar gibt es „Ayla und der Clan des Bären“ von 1985, ein unfreiwillig komisches B-Movie, in dem unsere Heldin durch Daryl Hannah zumindest optisch kongenial verkörpert wurde. Aber vielleicht sind wenigstens dieses Mal die oft und gern geschmähten Medienspezialisten die Klügerin, weil sie erkennen, dass sich aus einem 1000-seitigen Roman manchmal höchstens das Drehbuch für einen 30-Minuten-Kurzfilm destillieren lässt.
Zur Serie gibt es u. a. diese Website.
Taschenbuch: 984 Seiten
Originaltitel: The Shelter of Fire (New York : Crown Publishing Group 2002)
Übersetzung: Maja Ueberle-Pfaff u. Christoph Trunk
http://www.randomhouse.de/heyne
eBook: 1494 KB
ISBN-13: 978-3-641-07921-5
http://www.randomhouse.de/heyne
Hörbuch-Download: 2064 min. (ungekürzt, gelesen von Hildegard Meier)
ISBN-13: 978-3-8371-1091-3
http://www.randomhouse.de/randomhouseaudio/
Der Autor vergibt: 




Jonathon King – Tödliche Fluten
Anfang der 1920er Jahre versuchten Cyrus Mayes und seine beiden Söhne Steven und Robert Geld beim Bau des ersten Highways durch die Sümpfe der Everglades im Süden des US-Staats Florida zu verdienen. Sie gerieten in eine stickige grüne Hölle, in der brutale Aufseher die Arbeiter wie Sklaven misshandelten. Die Gewalt regierte hier, wo das Gesetz abwesend war. Wer die Flucht versuchte, wurde vom firmeneigenen Lohnkiller John William Jefferson als ‚Deserteur‘ betrachtet, verfolgt und umgebracht, denn niemand sollte wissen, was in den Everglades vor sich ging.
Auch Mayes und seine Söhne wurden offenbar ermordet. Ein Urenkel hat Briefe gefunden, die auf diese Familientragödie hinweisen. Er wünscht Aufklärung und engagiert den Anwalt Billy Manchester, der wiederum seinen Freund, den Privatdetektiv Max Freeman, mit den Ermittlungen beauftragt. Manchester entdeckt, dass die Firma Noren, die einst mit den Straßenbauarbeiten beauftragt war, im PalmCo-Konzern aufgegangen ist, einem der größten Bauunternehmer in Florida. Jonathon King – Tödliche Fluten weiterlesen
Arthur Conan Doyle – Eine Studie in Scharlachrot [Sherlock Holmes]

Arthur Conan Doyle – Eine Studie in Scharlachrot [Sherlock Holmes] weiterlesen
Dava Sobel – Die Planeten

Dava Sobel – Die Planeten weiterlesen
John D. MacDonald – Alptraum in Pink [Travis McGee 2]

John D. MacDonald – Alptraum in Pink [Travis McGee 2] weiterlesen
John D. MacDonald – Abschied in Dunkelblau [Travis McGee 1]

John D. MacDonald – Abschied in Dunkelblau [Travis McGee 1] weiterlesen
Max Allan Collins – CSI Las Vegas: Das Versprechen

Clive Staples Lewis – Die Chroniken von Narnia (Gesamtausgabe)

Clive Staples Lewis – Die Chroniken von Narnia (Gesamtausgabe) weiterlesen