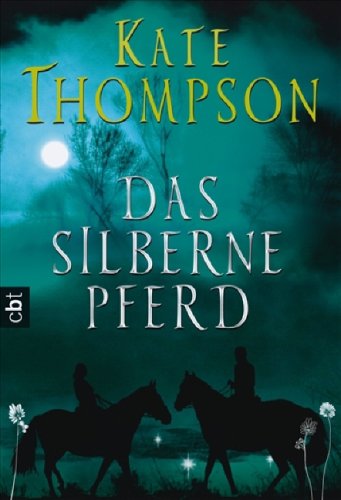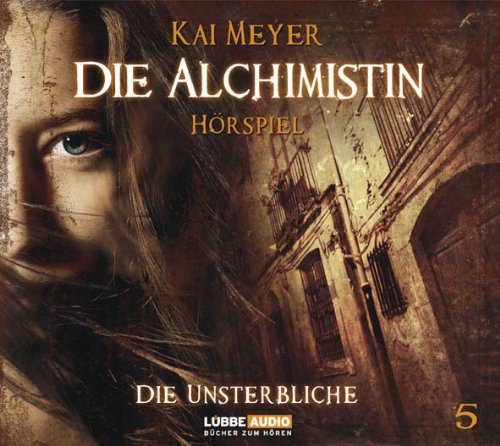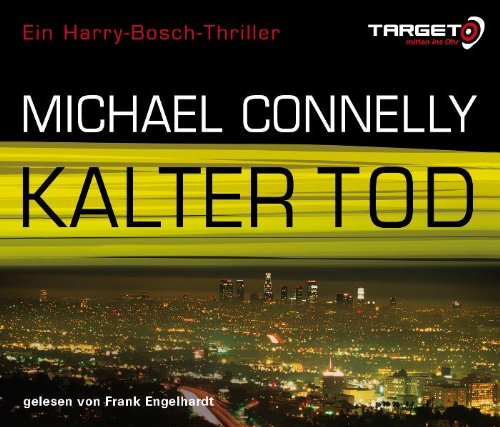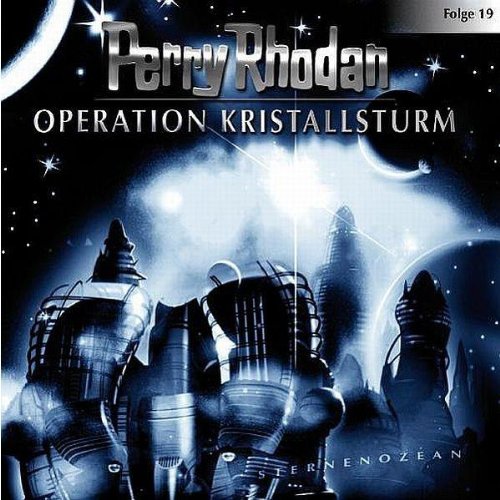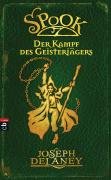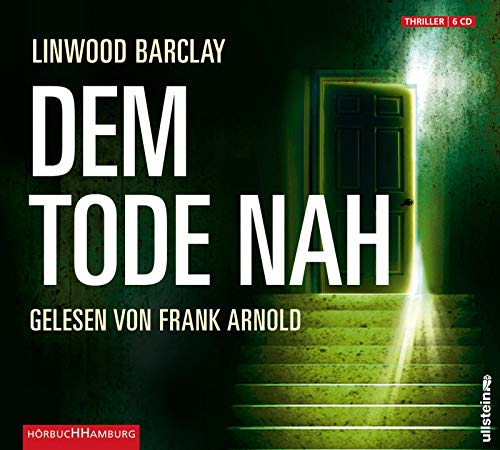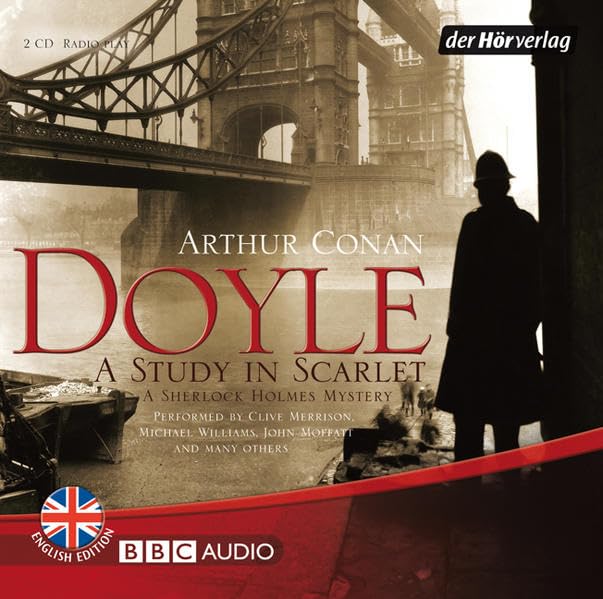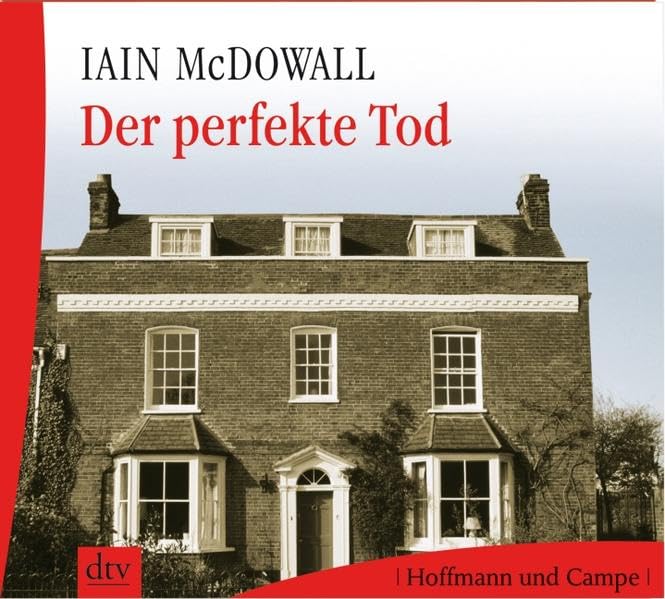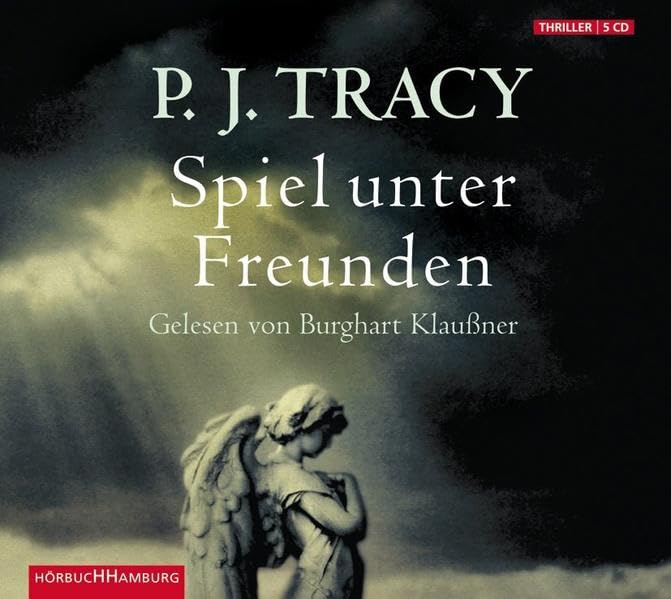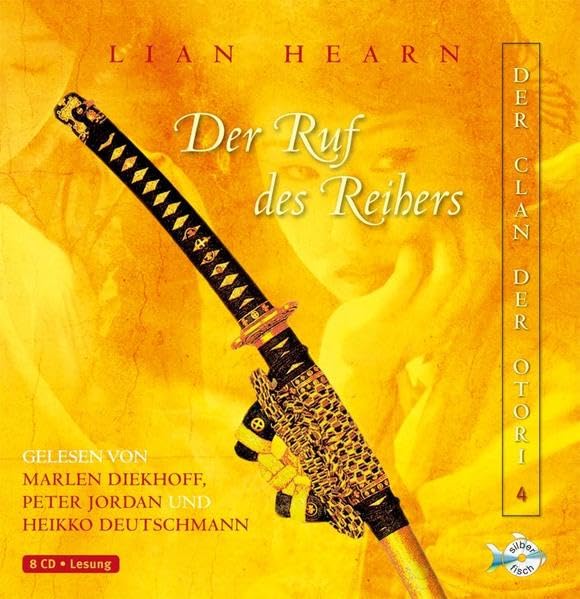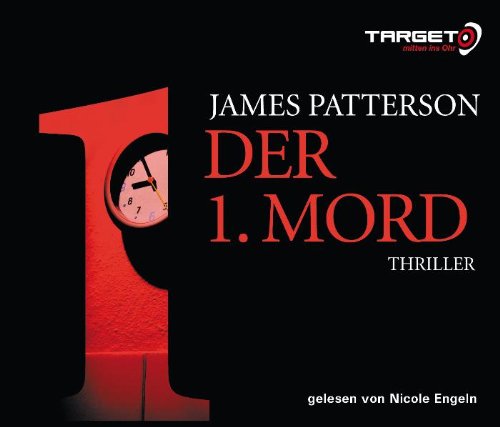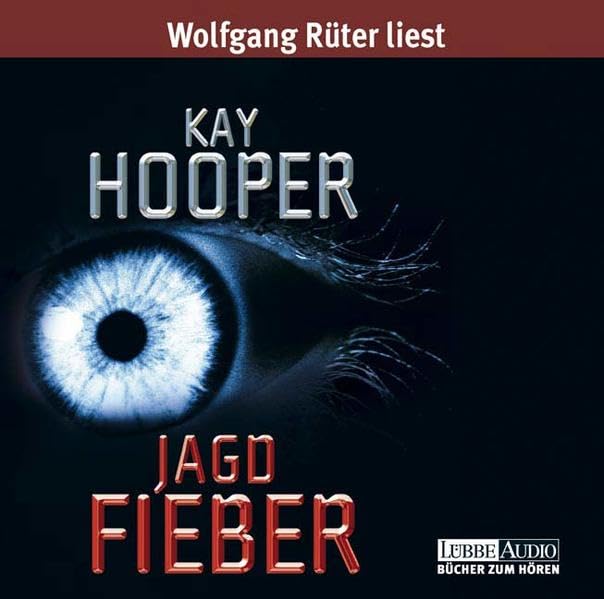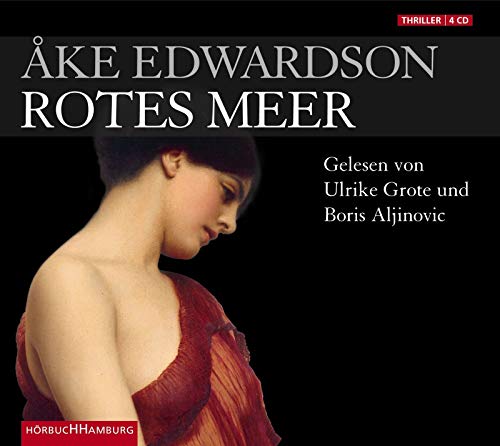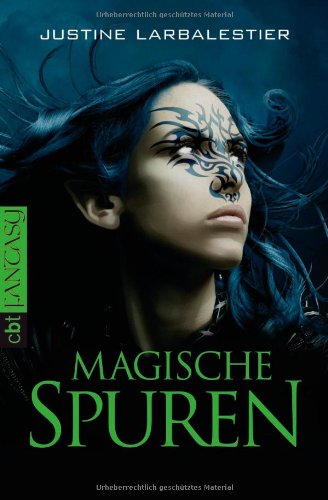_Action-Fantasy: Helden mit Unterleib, freundliche Dämonen_
Rowarn ist kein gewöhnlicher junger Mann. Seit jeher neigt er zu Gewaltausbrüchen. Eines Morgens erwacht er im Wald, neben sich die Leiche einer furchtbar zugerichteten jungen Frau. Schon bald bezichtigen ihn, wie befürchtet, die Dorfbewohner des Mordes und fordern Vergeltung. Rowarn kann sich nicht erinnern, die Tat begangen zu haben. Was er nicht weiß: Er hat eine finstere Vergangenheit, in der uralte Dämonen schlummern – die Dämonen von Valia.
_Die Autorin_
Uschi Zietsch wurde 1961 in München geboren. Nach ihrem Studium von Jura, Theaterwissenschaft, Geschichte und Politik machte sie ihren kaufmännischen Abschluss an der IHK. Bis Mitte 1996 war sie neben ihrem Schreiben hauptberuflich in Marketing/Vertrieb tätig. Seither ist sie freischaffende Schriftstellerin. 1986 veröffentlichte sie ihren ersten Fantasyroman „Sternwolke und Eiszauber“. Bis heute folgten über hundert weitere Publikationen. Im Dezember 2008 wurde ihr für ihre Kurzprosa „Aische“ der „Armin T. Wegner
Literaturpreis Menschenrechte“ von |Amnesty International| verliehen. Zietsch lebt mit ihrem Mann im bayerischen Unterallgäu. Ihr eigener Verlag heißt |Fabylon|.
Die Waldsee-Chroniken:
1) Dämonenblut
2) Nachtfeuer
3) Perlmond
4) Nauraka
_Handlung_
Der 19-jährige Rowarn lebt im idyllischen Wald von Inniu, doch weit abseits des Dorfes bei seinen Muhmen, den beiden Zentauren bzw. Velerii Schattenläufer und Schneemond. Sie vertreten bei ihm die Stelle seiner Eltern, die er nie kennengelernt hat. Doch dies soll sich nun ändern, denn große Ereignisse werfen ihre Schatten nun auch auf seine Region.
Rowarn hat mit Anini, einer Dorfschönheit, eine angenehme Liebesnacht verbracht. Doch als er am nächsten Morgen am Waldrand aufwacht, ist sein Liebeslager voller Blut. Entsetzt springt er in den See, um sich zu reinigen, und statt das Dorf Aninis zu verständigen, irrt er umher. So kommt es, dass man ihn schließlich im Dorf selbst für den Mörder des Mädchens hält, und ihr Bruder Rayem, der Sohn des Wirtes Hallim, würde ihn am liebsten umbringen. Rowarn kann lediglich seine Unschuld beteuern.
Deshalb zieht es ihn weiter hinaus in den Wald, um Frieden zu finden. Dieses Jahr ist der weiße Falke ausgeblieben, der sonst immer die Mitte des Jahres anzeigt, das Kommen des Sommers. Stattdessen stößt Rowarn an seinem Lieblingsbaum auf eine Schar unbekannter Reiter, vor der er sich nicht zu verbergen vermag. Deren Führer stellen sich als Fürst Noirun und Zwerkenkönig Olrig vor. Sie wollen Rekruten für ihren Krieg gegen die Dämonen von Femris anwerben.
Als Rowarn sie zu seinen Zieheltern führt, erfährt er zunächst einiges über die Vorgänge in Ardig Hall, dem Zentrum des Landes Valia auf der Welt Waldsee. Dort wurde ein Mord begangen, an Ylwa, der letzten Angehörigen des magiebegabten Volkes der Nauraka, die einst aus der Tiefe des Meeres kamen. Der Mörder war der Dämon Femris, der Ylwas Bruchstück des Tabernakels, eines mystischen Gegenstandes großer Macht, rauben wollte. Nun erfährt Rowarn von Schneemond unter vier Augen, dass Ylwa Rowarns Mutter war. Ylwa hatte vor 20 Jahren ihr Kind in die Obhut der Velerii gegeben, damit es in Sicherheit aufwachse. Rowarn schwört den Dämonen Rache für den Mord an seiner Mutter.
Doch zuvor gilt es den Mord an Anini aufzuklären. Fürst Noirun und Kriegskönig Olrig erklären sich dazu bereit, bei der Suche nach dem Täter behilflich zu sein. Morwen, die ausgezeichnete Fährtensucherin Noiruns, bemerkt die eindeutigen Spuren um den Tatort: eine Gruppe Dämonen ist bis hierher vorgedrungen, doch raubte sie nur das Herz Aninis. Das deutet darauf hin, so Morwen, dass der Gruppenführer Kraft sammelt, um sich dieses Land untertan zu machen. Folglich müssen die Menschen sich beeilen, die Dämonen zu stoppen, bevor sie so mächtig geworden sind, dass keiner sie mehr bezwingen kann.
Mit der Erlaubnis des Dorfältesten begibt sich die Soldatentruppe des Fürsten auf die Suche nach der Gruppe Dämonen. Rowarn schließt sich ihnen an, denn er bewundert Noirun, Olrig und Morwen und hofft, etwas von ihnen zu lernen. Rayem, Aninis Bruder, bildet mit ihm ein streitsüchtiges Paar Treiber. Als sie in den Höhlen im Wald nichts finden, fällt es Rowarn wie Schuppen von den Augen: Die Dämonen sind zwar hier – aber bereits im Dorf!
Rowarn eilt mit dem keuchenden Rayem ins Dorf zurück, wo sich seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten. Jetzt heißt es, allen Mumm zusammenzunehmen und die letzten Überlebenden zu verteidigen.
_Mein Eindruck_
Das hört sich vorerst relativ konventionell an, wie eine Kombination aus Detektivstory und Fantasy à la Tolkien. Doch die langjährige Fantasyautorin Uschi Zietsch hat für ihre Waldsee-Chroniken ein eigenes Universum entworfen, das sich dem jungen Helden Rowarn ebenso schrittweise erschließt wie seine eigene Herkunft und Natur. Deshalb ist sein Weg ins Herz dieses Weltentwurfs für ihn wie auch für uns gepflastert mit Entdeckungen. Viele davon sind freundlich, etliche aber auch reichlich unangenehm. Rowarn muss sich seinen ihm zustehenden Platz erst erobern.
Das klingt ein wenig nach Tolkiens [„Herrn der Ringe“. 1330 In der Tat greift die Autorin zunächst auf bewährte Muster zurück, um den Leser in Sicherheit zu wiegen. So macht sich Rowarn wie Frodo mit einem Auftrag auf den Weg, und sein treuer Freund Rayem begleitet ihn. Doch nicht neun Gefährten machen sich von Bruchtal aus auf eine Expedition ins Herz des Feindeslandes, sondern eine ganze Armee. Dass mit dieser Truppe etwas nicht ganz stimmen kann, merkt Rowarn spätestens dann, als die Fährtenleserin der Rekrutenkompanie nachts unter seine Decke schlüpft, um mit ihm Liebe zu machen.
Aber holla, so einen Sauhaufen hätte es bei Professor Tolkien nicht gegeben! Nicht nur Rowarn darf es munter im Schlafsack treiben, sondern auch Rayem und etliche andere. Dies gehört jedoch nicht zum Rekrutentraining, wie es aussieht, sondern ist ein den Rekruten vorbehaltenes Privileg. Aber immerhin bilden sich schnell persönliche Bande und die „faulen Eier“ unter den Rekruten sind schnell aussortiert.
Im Armeelager steht Rowarn, der von Knappen zum persönlichen Adjutanten des Fürsten beförderte Frischling, dem Widerstand der anderen Rekruten gegenüber. Ein erster Versuch, den Streit gütlich beizulegen, scheitert, und er muss seine Kampfkunst demonstrieren. Fortan hat er zwei erste Feinde. Es werden nicht die letzten sein.
|Vorgeschichte|
Fürst Noirun und Kriegskönig Olrig ziehen Rowarn zu ihrem Kämpen heran. Nicht nur das Kämpfen mit richtigen Waffen erlernt der Jüngling, sondern in Unterredungen mit Fürst Noirun auch die Geschichte Valias und Ardig Halls. In Ardig Hall herrschte Rowarns Mutter Ylwa, was er Noirun nicht verrät. Sie hütete einen Splitter des heiligen Tabernakels, das für ganz Waldsee von elementarer Bedeutung ist.
Der Dämon Femris ist bemüht, alle Bruchstücke des Tabernakels an sich zu bringen. Doch wie konnte es ihm gelingen, eine zaubermächtige Nauraka wie Ylwa zu überwinden? Noirun und andere Ritter erzählen Rowarn, wie Ylwa von einem Zwielichtgänger namens Nachtfeuer überwältigt wurde, der in Femris‘ Diensten steht.
|Finale?|
Der Clou an der Geschichte ist jedoch, dass es Femris und seiner Armee nicht gelungen ist, den Belagerungsring, den Noiruns Armee um sie gelegt hat, zu durchbrechen. Folglich kann nur eine Schlacht die Entscheidung bringen, ob Femris den Splitter behält oder an Noiruns Scharen verliert. Rowarn verrät es Noirun nicht, aber einem anderen Ritter: Er sinnt auf Rache für den Mord an seiner Mutter. Also hat er Femris und Nachtfeuer im Visier. Er ahnt nicht, dass auch diese es auf ihn abgesehen haben. Deshalb sorgt der Schluss dieses Bandes für einige handfeste Überraschungen. Die obligatorische Schlacht ist noch lange das letzte Wort in dieser Geschichte.
|Gegen den Strich|
Nicht nur führt die Autorin Fabelwesen wie Zentauren und ziegenfüßige Monster in eine Tolkien-Welt ein, sondern sie revidiert auch die überkommene Tradition der Bilder. Jeder kennt inzwischen aus Jacksons Verfilmung den schrecklichen Balrog von Moria, der an der Brücke von Khazad-dûm Gandalf zum Verhängnis wurde. Nun lässt die Autorin solch ein Monster-Viech auch in ihrer Geschichte auftreten, allerdings auf der Seite der Guten. Diese Wesen werden einfach „Dämonen“ genannt. Dummerweise gibt es aber auch Abtrünnige unter ihnen, die zu Femris halten.
|Erotik|
Wir sind außerdem daran gewöhnt, dass die Recken im „Herrn der Ringe“ vorläufig unbeweibt durch die Gegend latschen. Arwen taucht nur bei Jackson laufend auf, nicht aber im Original. Aragorn lebt also keusch, und zwar monatelang. Dito Boromir und sein Bruder Faramir. Sie haben daheim niemanden, der ihnen ein Süppchen am Herd kocht oder das Bettchen wärmt. (In Mittelerde wurden noch keine Glasfenster erfunden …)
Nicht so Fürst Noirun. Wie Rowarn zu seinem wachsenden Erstaunen feststellt, ist der Fürst keineswegs ein Kostverächter, was weibliche Gesellschaft angeht. Diese Ladys sind weit verstreut in verschiedenen Gasthöfen zu finden. Versteht sich von selbst, dass auch Zwergendamen vom Menschengeschlecht angezogen sind, und die betreffende Lady bedauert sehr, dass sie Rowarn nicht mit ihren Liebeskünsten verwöhnen darf. Er hat nämlich gerade Spione des Feindes belauscht und Wichtigeres vor, als mit ihr ins Heu zu hüpfen. Vielleicht ein anderes Mal, honey! Wie schön, dass diese Helden auch einen Unterleib haben dürfen!
|Die Anhänge|
Die Anhänge enthalten als besonders hilfreichen Teil ein Glossar, das die zahlreichen Namen und Begriffe erklärt, welche die Autorin für ihr Waldsee-Universum erfunden hat. Dieses Glossar wird in den Folgebänden je nach Bedarf weiter ausgebaut. Ein zweiter Text ist die Rede einer Mutter an ihr Kind – es könnte sich um Rowarn handeln -, in der es um den Traum des Schöpfers geht, auf dem das ganze Waldsee-Universum basiert.
_Unterm Strich_
Der erste Band eines neuen Fantasy-Zyklus ist immer etwas heikel. Dieser bildet keine Ausnahme. Für den Leser fängt alles erst ganz gemütlich an, bevor im Mittelteil eine erhebliche Umgewöhnungsphase eintritt. Viele Figuren widersprechen den Klischees, die das Fantasygenre (oder vielmehr die amerikanischen Verlage) für sich eingerichtet hat. Soldaten und Recken haben ein Liebesleben, das sie dennoch nicht lächerlich macht. Und Monster wie Balrogs entpuppen sich als Verbündete, wenn man auch nicht versuchen sollte, mit ihnen Kirschen zu essen.
Das letzte Drittel ist dann wieder vertrautes Terrain: die Entscheidungsschlacht. Dies ist zwar nicht das Ringen der Völker um das Schicksal von Mittelerde, aber die diversen Durchgänge bietet doch eine Reihe von dramatischen Kämpfen gegen ernstzunehmende Gegner. Leider kommt es in den Reihen der Guten zu beklagenswerten Verlusten. Rowarn fällt es schwer, den Befehl seines neuen Dienstherrn Noirun zu befolgen und nur vom Seitenaus zuzuschauen. Wenigstens kann er von dieser Position aus den Überblick über das Geschehen bewahren, wofür ihm der Leser dankbar ist.
Da noch zahlreiche Geheimnisse der Enthüllung harren und Rowarn seinen Racheplan weiterverfolgt, bin ich gespannt, wie der Zyklus weitergeht. Der Weltentwurf der versierten Autorin birgt jedenfalls noch einiges Potenzial, um aufregende Abenteuer mit fremdartigen Wesen zu gestalten.
|415 Seiten
ISBN-13: 978-3-404-28517-4|
http://www.uschizietsch.de
http://www.bastei-luebbe.de
http://www.fabylon-verlag.de