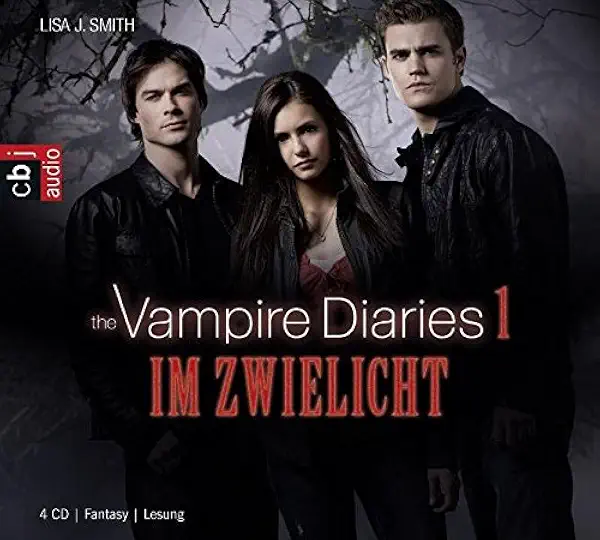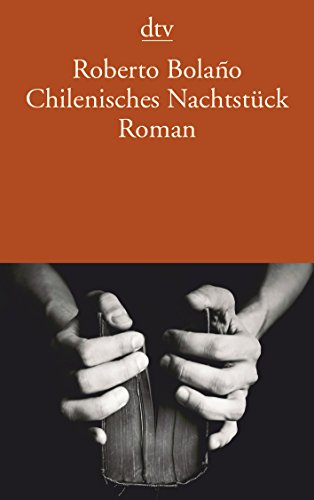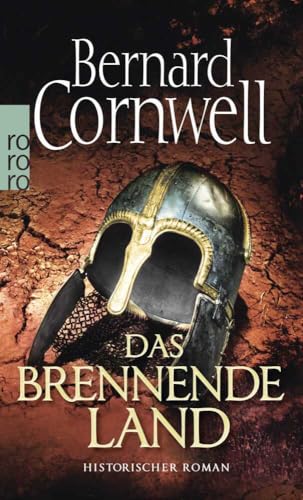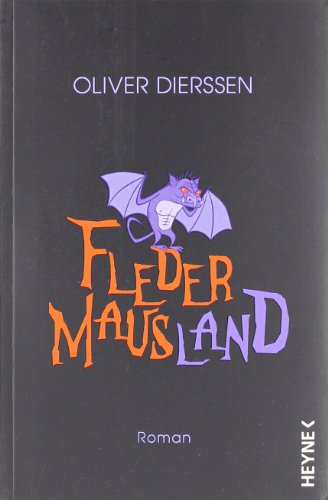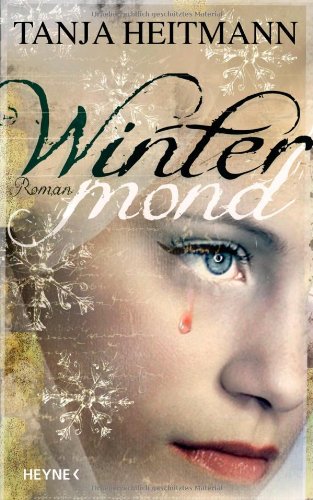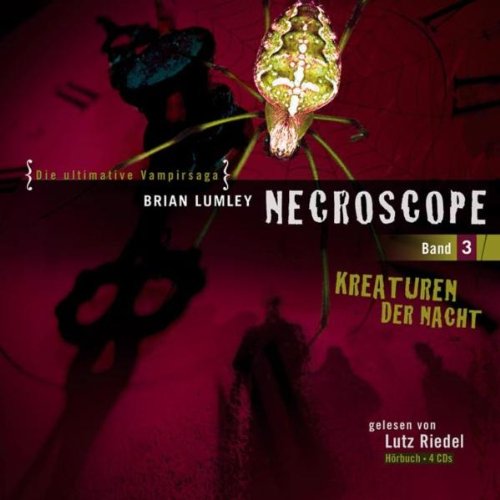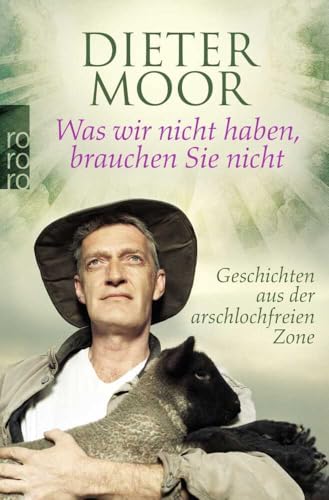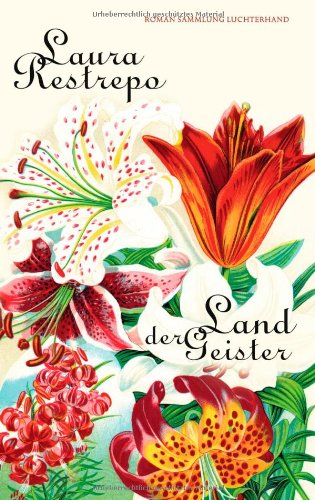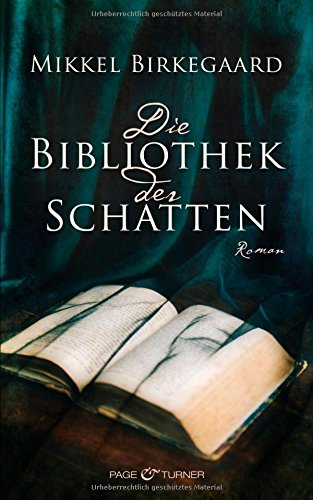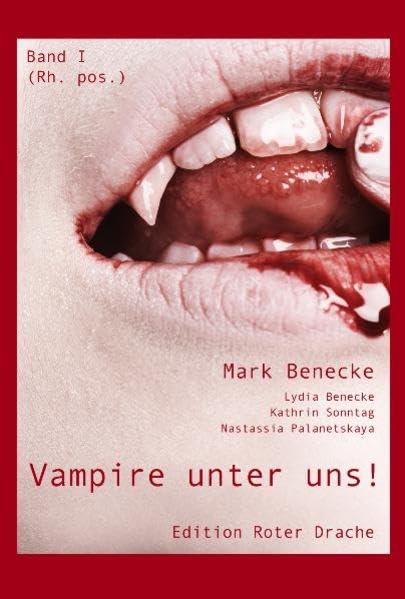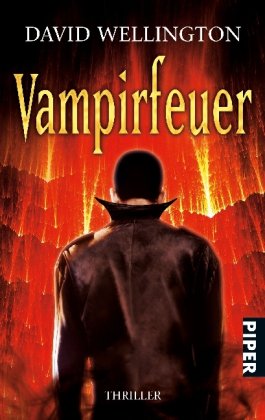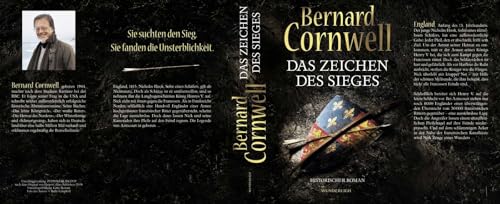Die „Vampire Diaries“ laufen seit einiger Zeit erfolgreich auch im deutschen Fernsehen. Die Serie basiert auf der Jugendbuchreihe gleichen Namens der amerikanischen Autorin Lisa J. Smith. Fürs Fernsehen entdeckt wurde der Stoff sicherlich im Kometenschweif der momentanen Twilight-Euphorie und tatsächlich werden Fans vor Freude jubilieren, bietet „Vampire Diaries“ doch einen praktisch baugleichen Plot, und das, obwohl Smith den ersten Teil der Reihe bereits 1991 veröffentlichte.
_Elena ist die_ Königin ihrer Highschool: Bildhübsch und beliebt, hält sie sich einen Hof Freundinnen, die sie umschwirren wie die Motten das Licht. Alle Jungs liegen ihr zu Füßen und sie hat die freie Auswahl, wem sie ihre Gunst gewähren will. Bisher war der nette Matt Mann der Stunde gewesen, doch während der Sommerferien ist Elena aufgegangen, dass sie eigentlich nur mit Matt befreundet sein will. Also macht sie mit ihm Schluss, mal ganz nebenbei auf dem Schulweg. (Ein Tipp an die jugendlichen Leser: Es handelt sich hier um Fiktion, dass das Ende einer Beziehung jemals so harmonisch und geradezu kuschelig über die Bühne geht, ist relativ unwahrscheinlich – nur so als Rat für den weiteren Lebensweg.)
Somit ist Elena frei für neue Abenteuer. Wie gut, dass es da prompt einen Neuzugang in ihrem Jahrgang gibt – den feschen (Italiener!) Stefano Salvatore, der stilsicher im Porsche vorfährt und die getönte Sonnenbrille auch im Unterricht nicht abnimmt. Hach, wie romantisch! Elena ist sofort Feuer und Flamme und macht es sich zur Aufgabe, Stefanos Herz zu erobern. Dabei geht sie vor, als handele es sich um einen Geschäftsplan und nicht um Herzensangelegenheiten. Sich Stefano zu angeln wird zum Selbstzweck. Dass sie ihre Freundinnen auf einem Friedhof mit Blut schwören lässt, ihr bei der Um-den-Finger-wickel-Aktion immer beizustehen, ist da nur die Krönung der pubertären Hysterie.
Kurzum, Stefano erweist sich als harter Brocken. Er scheint völlig immun gegen Elenas sprühenden Charme und ihre überdurchschnittliche Schönheit zu sein. Doch halt! Natürlich ist das nur ein literarischer Kniff, um das Unausweichliche etwas hinauszuzögern und die reichlich konfliktarme und geradlinige Handlung auf Romanlänge zu strecken. Denn selbstverständlich ist Stefano verknallt in Elena, nur trägt er – natürlich! – ein dunkles und gefährliches Geheimnis mit sich herum und will deshalb jeden von sich fernhalten. Schließlich ist Stefano ein Vampir aus dem Florenz des 15. Jahrunderts und Elena sieht haargenau aus wie seine damals verflossene Catarina, die ihn und seinen Bruder Damon zum Vampir machte, nur um sich dann (gekränkte Eitelkeit) durchs Sonnenlicht zu einem Häufchen Asche verbrennen zu lassen.
Aber „Im Zwielicht“ wäre kein ordentliches Jugendbuch, wenn nicht alles doch noch in die richtigen Bahnen gelenkt würde: Stefano und Elena finden schließlich zueinander und Elena ergeht sich in schwülstigen und endlosen Tagebucheinträgen über die Schicksalhaftigkeit ihrer Liebe. Nebenbei taucht auch noch Damon auf, der ein paar Leute umbringt, um Stefanos Aufmerksamkeit zu erregen (Stefano erweist sich allerdings als ziemlich träge in dieser Hinsicht) und die Geschichte generell etwas aufzumischen. Bevor das alles jedoch zu einem Höhepunkt führen kann, beendet Lisa J. Smith ihr Buch einfach, genau da, wo andere Autoren ihren Showdown einbauen würden. Die Erzählung endet damit so unvorhergesehen und abrupt, dass man zunächst annimmt, einfach vergessen zu haben, eine weitere CD einzulegen. Doch dem ist nicht so, Lisa J. Smith beendet den ersten Teil ihrer Reihe tatsächlich mitten in der Szene, gerade als ob ihr die Puste ausgegangen wäre. Sehr schade.
_Smiths „Vampire Diaries“_ können wirklich nur jugendlichen Leserinnen uneingeschränkt empfohlen werden. Für diese hat sie einen Roman voller romantischer Klischees verfasst, die man so hochdosiert nur in jungen Jahren gut finden kann. Dass sie dabei ihre Protagonistin Elena praktisch als die Oberzicke der Schule charakterisiert, ist noch ihr größter Fehler. Elenas Oberflächlichkeit äußert sich vor allem in ihrer Fokussierng auf das Äußerliche: Darauf, wie sie erscheint, welches Bild sie bei anderen erweckt. Dass Stefano dabei nur das letzte Accessoire in ihrer Beliebtheitskollektion ist (oder zumindest so erscheint), stößt beim Leser sauer auf und macht die beiden nicht gerade zu Vorbildern in Sachen schicksalhafter Liebe. Zwar meint Elena, unsterblich in Stefano verliebt zu sein, doch kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie sich eigentlich nur in ihrer Eitelkeit gekränkt fühlt, weil er ihr so lange widersteht. Denn das facht ihr Interesse erst recht an – dieses ewige gefühlsmäßige hin und her, das zu keinem wirklichen Ergebnis führt, mag für das anvisierte Publikum (Mädchen zwischen 13 und 17) wirklich spannend sein. Alle mit etwas mehr Jahren auf dem Buckel werden sich von der generellen emotionalen Unreife der Charaktere wohl eher genervt fühlen und froh sein, dass sie die Pubertät bereits hinter sich gelassen haben.
CBJ Audio hat „Im Zwielicht“ als gekürzte Lesung auf vier CDs veröffentlicht, wobei es ausnahmsweise wirklich keine Rolle spielt, dass der Roman für die Hörbuchfassung etwas zusammengeschrumpft wurde. Da die Handlung und die Charaktere relativ eindimensional daherkommen, hat man beim Hörbuch nie den Eindruck, wichtige Entwicklungen zu verpassen. Sprecher Adam Nümm schafft das Kunststück, den Text absolut ironiefrei zu lesen (großes Lob!), ihm also immer mit dem nötigen Ernst zu begegnen, den Fans der Reihe erwarten werden. Von Zeit zu Zeit sind Tagebucheinträge Elenas eingesträut (gelesen von Jennie Appel), die man wohl getrost hätte kürzen können, da sie die Handlung nicht vorantreiben. Allerdings wurden sie vermutlich zumindest in Teilen erhalten, um dem Originalsound des Buches nahezukommen. Mehrwert bieten sie jedenfalls nicht.
_Abschließend kann man_ sagen: Ein empfehlenswertes Hörbuch für alle, die lieber hören als sich das Buch vorzunehmen. Allerdings sollten sich Erwachsene möglichst fernhalten, außer sie stehen noch in gutem Kontakt zu ihrem inneren Teenie.
|4 Audio CDs
gelesen von Adam Nümm
ISBN-13: 978-3837104295
|
_Lisa J. Smith beim Buchwurm:_
[Engel der Verdammnis (Night World 1)]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6012
[Prinz des Schattenreichs (Night World 2)]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6013
[Jägerin der Dunkelheit (Night World 3)]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6014