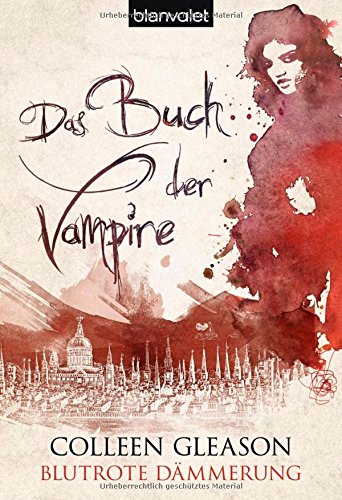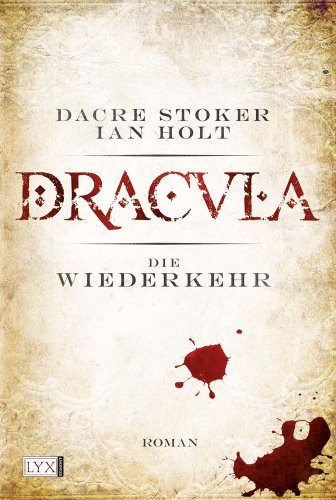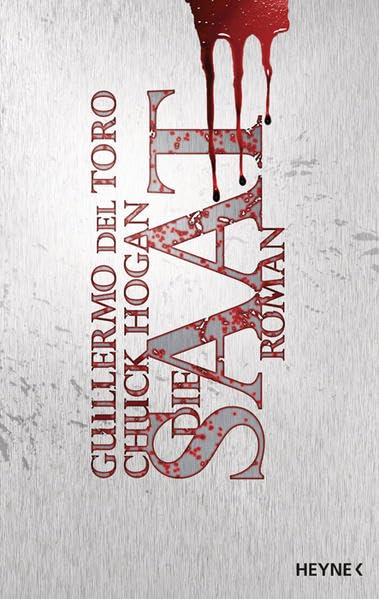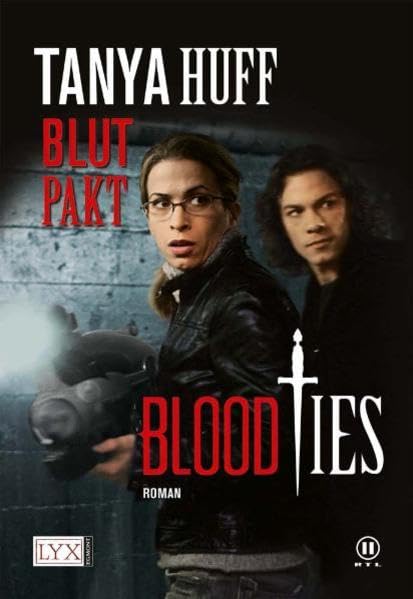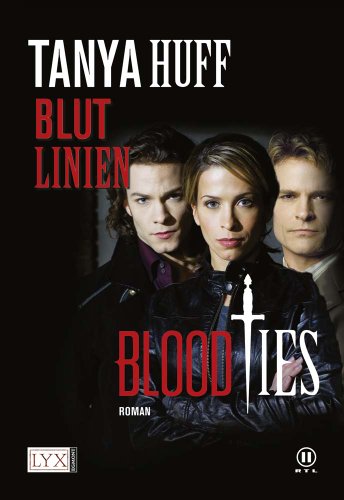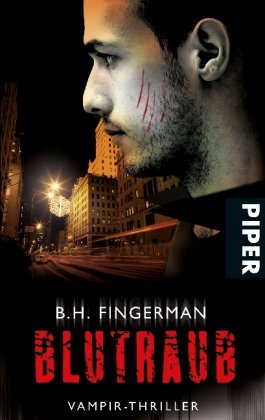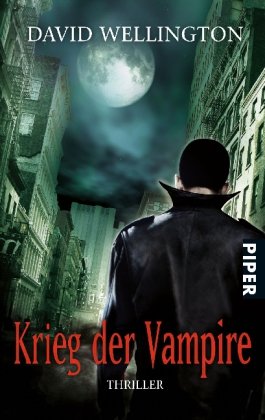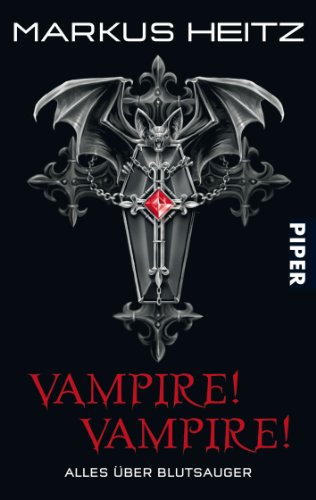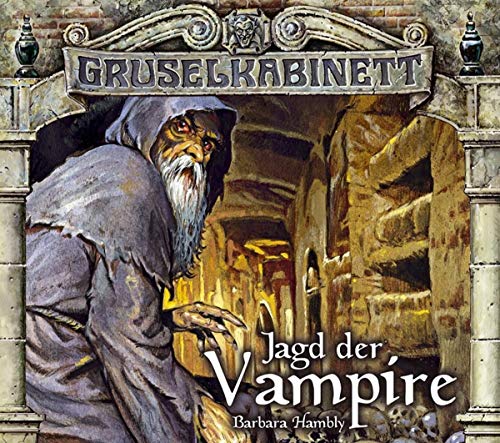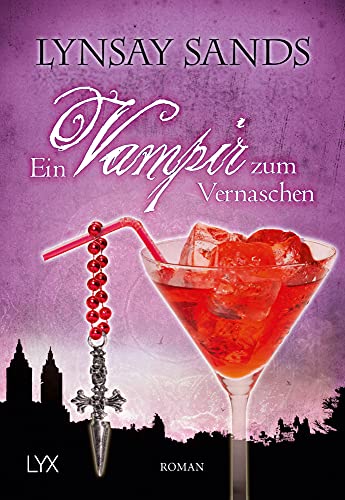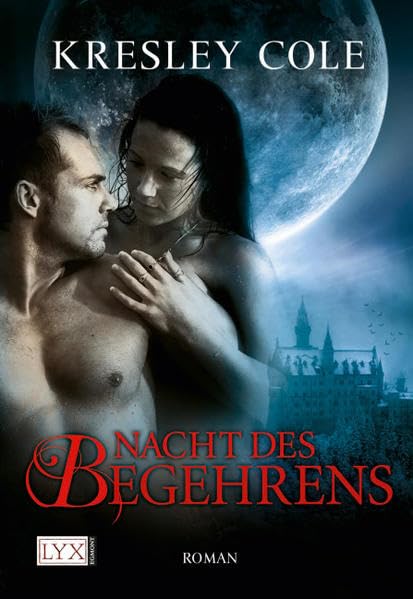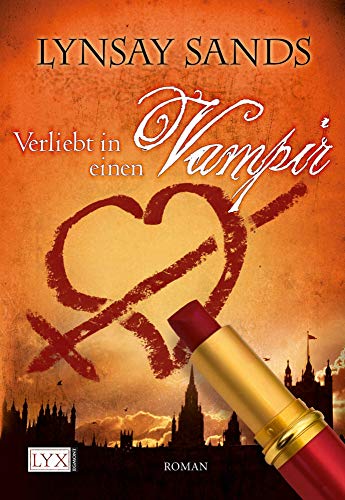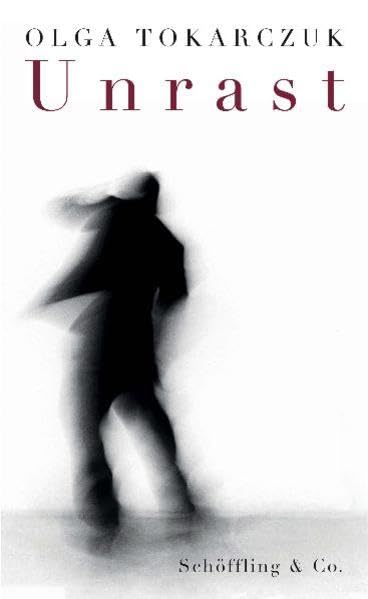Lady Victoria Gardella sollte wohl eigentlich Teekränzchen und Bälle besuchen. Doch das Schicksal hat etwas anderes für sie bereit gehalten, denn sie ist die Illa Gardella, die Anführerin einer Schar von Vampirjägern, die es auf die Vampire und Dämonen von Rom abgesehen haben. Und so läuft Victoria auch am liebsten in weiten Hosenröcken herum und ihre Zofe hat es sich zur hehren Aufgabe gemacht, allerlei Waffen und Gimicks in den Kleidern ihrer Herrin unterzubringen.
Victoria trauert immer noch um ihre Großtante Eustacia, die vorige Illa Gardella, von der Victoria nun den Titel geerbt hat. Doch der Tod Eustacias bekommt bald eine weitere Dimension, als sich heraus stellt, dass die Vampire von Rom versuchen, in ein alchemistisches Labor einzudringen, das sich nur mit drei bestimmten Schlüsseln öffnen lässt. Einen davon trug Eustacia immer am Körper, doch nun ist er unauffindbar. Also versucht Victoria den geheimnisvollen Sebastian Vioget ausfindig zu machen, denn er war Zeuge von Eustacias Tod und weiß deshalb vielleicht vom Verbleib des Schlüssels. Auf jeden Fall muss es den Jägern vor den Vampiren gelingen, das Labor zu öffnen!
Gleichzeitig tobt in Rom der Karneval und die ganze Stadt scheint auf den Beinen. Solch eine Veranstaltung ist für die Vampire der Stadt natürlich ein gefundenes Fressen (im wahrsten Sinne) und so sind Victoria und ihre Venatoren ständig unterwegs, um Vampire zur Strecke zu bringen.
„Blutrote Dämmerung“ von Colleen Gleason ist bereits der dritte Band ihrer Reihe „Das Buch der Vampire“. Die Grundidee erinnert ein bisschen an „Buffy“ in einem historischen Setting: Seit die erste Vampirjägerin eine Frau aus der Gardella-Familie war, wird die Begabung weiter vererbt. Wie auch bei „Buffy“ wird damit eine junge Frau aus ihrem normalen Leben gerissen, um plötzlich Vampiren und anderen Monstern den Garaus zu machen. Und wie Buffy muss auch Victoria hart darum kämpfen, ihre Familie im Ungewissen zu lassen – zu ihrem eigenen Schutz. Um das Ganze mit etwas religiösem Hintergrund aus zu polstern ist das Hauptquartier der Venatoren eine alte Kirche und sie beziehen ihre übermenschliche Kraft aus der vis bulla, einem Silberkreuz, dessen Rohstoff aus einer Mine unter dem Berg Golgotha stammt. Doch natürlich schmückt Gleason ihr Universum noch mit allerlei anderen Ideen aus. So macht sie bespielsweise eine ganze Hierarchie von Vampiren und Dämonen auf, von denen jede „Sorte“ ihre eigenen Stärken hat.
„Blutrote Dämmerung“ wird in den USA als Paranormal Romance vermarktet, doch tatsächlich lassen sich Gleasons Bücher nicht so einfach einordnen. Sicher, sie lässt eine Handvoll attraktiver Männer auftauchen, die alle auf ihre Art um Victoria werben und manchmal auch erhört werden. Allerdings gibt es keine Romanze, keine schicksalhafte Liebe, die irgendwann komplett die Handlung unterwandert, um der Leserin eine Liebesszene nach der anderen zu liefern. Statt dessen behält Gleason ihre Handlung immer im Auge und lässt romantische Szenen quasi auf Nebenschauplätzen stattfinden, als kleine Pausenfüller, bevor Victoria wieder auf Vampirjagd muss. Das ist ein wirklich erfrischender Gegensatz zur Paranormal Romance, vor allem auch, weil Gleason durchaus eine talentierte Autorin ist und sich die Mühe macht, ein umfangreiches Universum für ihre Romanreihe zu entwerfen. So hat man als Leser nicht den Eindruck, die Charaktere würden in einem stereotypen Setting mit Elementen aus historischen und fantastischen Romanen agieren. Gleason überzeugt mit einer ausgewogenen Geschichte, die sowohl spannend, unterhaltsam als auch erotisch ist.
Zwar ist nicht alles gelungen – oder eher: Einiges ist zu gelungen. So wird Victoria in ihrem Haus von ihrer Mutter und deren zwei Busenfreundinnen heimgesucht. Da sie schon so lange nichts mehr von ihrer Tochter gehört hat und sich nun langsam sorgt, hat sich ihre Mutter spontan zu einem unangekündigten Besuch entschlossen. Natürlich ist sie wenig begeistert, als sie fest stellt, dass ihre hübsche Tochter im heiratsfähigen Alter praktisch gar nicht am gesellschaftlichen Leben teilnimmt, und so versucht sie, Victoria in die Rolle einer hübschen Modepuppe zurück zu drängen, während Victoria verzweifelt versucht, ihre nächtlichen Aktivitäten aufrecht zu erhalten, ohne ihrer Mutter Anlass zum Misstrauen zu geben. Gleason beschreibt hier einen vollkommen legitimen – und eigentlich auch interessanten – Konflikt, doch leider sind die drei Besucherinnen als solche Karikaturen geraten, dass man als Leser ständig hofft, sie würden endlich von einem Vampir ausgesaugt und in die ewigen Jagdgründe befördert werden. Da Victorias Mutter auch die schlafwandlerische Gabe hat, immer in Schwierigkeiten zu geraten, wird man als Leser immer frustrierter, wenn es Victoria mal wieder gelingt, ihre Mutter vor dem sicheren Tod zu retten. Die Geheimnisse, die Victoria vor ihrer Mutter haben muss, machen deren Beziehung zu einer tickenden Zeitbombe – ein Thema mit Potenzial, an dem man sich als Autor sicherlich wiederholt abarbeiten kann. Ist es jedoch zu viel verlangt, die Frau Mama wenigstens ein bisschen sympathisch zu gestalten? Da Victorias Mutter nun aber als solch ignorante Schreckschraube daherkommt, stellt man sich als Leser immer wieder auf Victorias Seite und das nimmt dem Mutter-Tochter-Konflikt den Pfiff.
Trotzdem, „Blutrote Dämmerung“ ist ein wirklich überzeugendes Stück Unterhaltung. Die Helden sind heldenhaft, die Leidenschaften leidenschaftlich und die Vampire ordentlich böse. Und Victoria ist eine Heldin, die man lieb gewinnen kann. Eine klare Leseempfehlung!
|Taschenbuch: 448 Seiten
ISBN-13: 978-3442372720
Originaltitel: |The Gardella Vampire Chronicles 03. The Bleeding Dusk|
Deutsch von Patricia Woitynek|