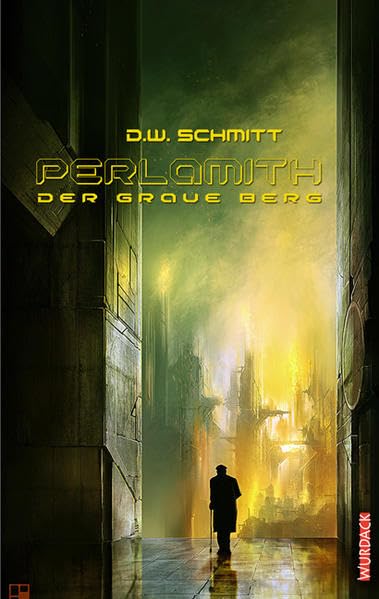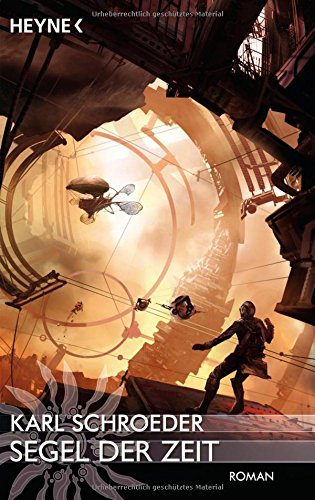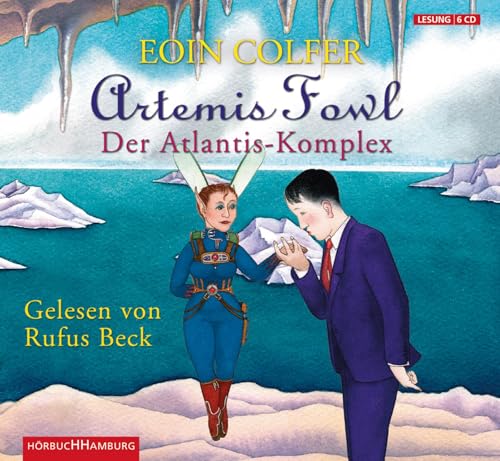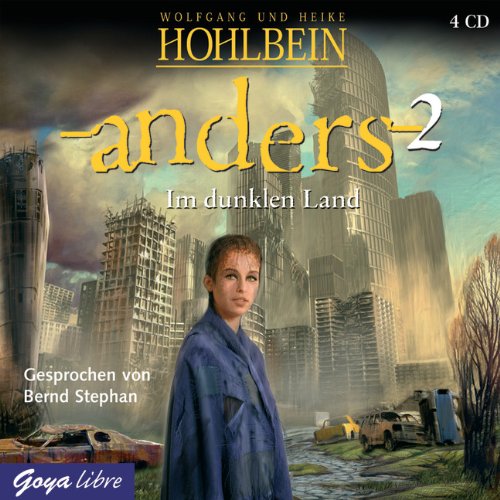Zwischen der Verpflichtung für ihren Pantap und der Sorge vor der großen Invasion des Sternenkaisers begibt sich der Fernerkunder Megatao auf die Suche nach der letzten Hoffnung. Kommandant Eftalan Quest und seine Mannschaft versuchen, was noch keinem Menschen glückte: Den Planeten des Ursprungs zu finden, die eine legendäre Welt, auf der alles Leben begann – doch um was zu tun …?
Andreas Eschbach wurde geboren, erlebte eine Kindheit, studierte Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete als Softwareentwickler, ehe es ihn nach Frankreich zog. Dort lebt und arbeitet er mit seiner Familie an der Bretagne im Urlaub.
Die ferne Zukunft: Die Menschheit hat sich über Galaxien ausgebreitet und dabei in die unterschiedlichsten Gruppierungen aufgespalten, so dass die einzelnen Völker voneinander nichts mehr wissen. In der Galaxis Gheera existiert das monarchische Reich des Pantap, und dieses Reich, obwohl gigantisch in seinen Dimensionen, wird von den Heerscharen des Sternenkaisers angegriffen. Noch kennt niemand die Streitkräfte des Gegners, doch es gehen Gerüchte über unglaubliche Massen an Kriegsschiffen, die über weit überlegene Technik gebieten. Da scheint es nicht abwegig, wenn der Pantap einen seiner mächtigen Fernerkunder, die Megatao unter dem Kommando des Kriegshelden Eftalan Quest, auf eine geheime Mission schickt, deren Ziel nur dem Kommandanten höchst selbst bekannt ist.
Quests Mannschaft arbeitet effizient und höchst erfolgreich an den einzelnen Abschnitten auf ihrem Weg, zum Beispiel entwenden sie der gigantischen Bibliothek von Paschkan, die von Außerirdischentechnik geschützt wird, die Heiligtümer, die gehütetsten Informationen, die von Außerirdischen berichten. So findet man schließlich das Volk der Yorsen, der ältesten und mächtigsten Wesen der Galaxis, und erhält dort den nächsten Hinweis auf dieser intergalaktischen Schnitzeljagd. Doch was wäre das alles wert ohne den Unsterblichen Smeeth, den man mit seinem beschädigten Raumschiff aus dem All fischt? Und was hofft Quest auf dem legendären Planeten des Ursprungs zu finden?
„Quest“ ist ein Roman aus den Anfängen des eschbachschen Schaffens. Das „Jesusvideo“ war schon geschrieben, und Eschbach erreichte Publikum außerhalb der Science-Fiction-Szene. Mit „Quest“, das er selbst als Geschenk an seine Fans beschreibt, machte er den letzten Schritt zurück in die offensichtlichen marketingtechnischen Niederungen des Prädikats „SF“, das im Folgenden von seinen Büchern für Erwachsene verschwindet. Quest, einstmals erschienen in wunderschöner großformatiger Paperbackausgabe mit Innenillustrationen auf buntem Hochglanzpapier, präsentiert auf den ersten Blick seine Zugehörigkeit zum „Raumschiffe, Aliens und T..ten“-Genre, wobei Letztere in allen anderen Bereichen der Literatur mindestens genau so präsent sind wie in der SF und Eschbach einen sich stets weiterentwickelnden Stil hat, sie in Szene zu setzen.
Ab diesem Zeitpunkt erscheint Eschbachs Science-Fiction also entweder getarnt als Thriller, oder in Form von Jugendromanen wie dem Marsprojekt oder zuletzt der „*Out-Trilogie“. „Quest“ spricht aber erfreulich direkt schon durch sein Titelbild den echten Fan an, was nicht bedeutet, es sei für andere Leser verschlossen – ein Vorurteil, unter dem die SF Zeit ihres Daseins leidet. Raumschiffe, fremde Galaxien, Sternenkaiser … na und? „Quest“ bietet mehr als ein Beziehungsdrama, in dem die Standesunterschiede und gesellschaftlichen Zwänge eine Rolle spielen; es gibt Ausblicke in die charakterlichen Untiefen des Menschen, egoistisches Handeln bis zur Selbsterkenntnis, Gott als Sinnbild negativer Motivation und schlicht wunderbare Unterhaltung an einer spannenden, gut erzählten Geschichte. Es macht seinem Titel Ehre, denn man kann die Geschichte ebenso auf diesen Aspekt reduzieren: Die Queste, die Suche nach dem Planet des Ursprungs, nach dem Mythos der Menschheit.
Quest als Protagonist ist ein mehrschichtiges Subjekt; er tritt zwar selten in Erscheinung und macht eher den Eindruck des überlegenen, hochintelligenten Kommandanten – über seine Beziehung zur ersten Heilerin erfährt man aber mehr von ihm, als der Schein vortäuscht. Im Grunde ist er ein zerstörtes Leben, zerfressen von Verantwortung und Heldenstatus, ein Mensch, der seine großen Verluste nie verwunden hat. Und doch scheinen diese Verluste ihn vor allem in seinem egozentrischen Weltbild zu bestärken, zeigt er doch nie Trauer oder menschlichen Verlust, sondern in erster Linie Verzweiflung über seine Unfähigkeit, über die Last, die das Schicksal ihm auferlegt hat, über Gottes Gleichgültigkeit. Er ist verbittert ob der Ausweglosigkeit seiner tödlichen Erkrankung, ohne die Möglichkeit, einen Verantwortlichen für die Geschehnisse zu finden als sich selbst.
Andere Charaktere haben ihre weltlicheren Probleme, so wie der erste Verweser (Quests Stellvertreter), der als Einziger in der Kommandohierarchie über Fähigkeiten verfügt und doch niemals ein Kommando wird führen können in der durch gesellschaftliche Strukturen geregelten Konzeption der monarchistischen Flotte des Pantap. Oder der junge Novize Bailan, der sich dem Abenteuer seines zölibatären Lebens gegenüber sieht, als er die Niedere kennenlernt, einer jungen Frau der untersten Kaste, die rechtlos und wertlos wie Leibeigene behandelt werden – auch ein Aspekt, den Eschbach schließlich für eine dramatische Wendung nutzt. Und nicht zuletzt der Unsterbliche, Smeeth, der von Narben übersäte Mann aus der Vergangenheit, der so unendlich viel mehr weiß und kann, als die menschliche Vorstellungskraft für möglich hält, und der sich doch an seine tierische Abstammung klammert, um das Alleinsein über die Jahrtausende zu ertragen. Er ist der Mensch, dessen Abgeklärtheit schließlich den einzigen Ausweg für Quest, den gescheiterten Kommandanten und Fahnenflüchtigen, aufzeigt. Und er ist der Mann, dessen bloße Existenz für die unaufhaltbare Invasion des Sternenkaisers verantwortlich ist durch die Mythen, die sich um ihn und seine Geschwister ranken, die Mythen der Unsterblichkeit, die die Sternenkaiser seit Menschengedenken verfolgen und zu erreichen trachten. Wenn man die Zustände in der Galaxis Gheera auf diesen Punkt reduzierte, würde man sogar Quests Zustand auf Smeeths Existenz zurückführen können. Ein unmenschlicher Gedanke.
Übrigens hängt im Speiseraum der Megatao ein kleiner Haarteppich, eine Kostbarkeit, die den Flechtenden Jahre seines Lebens kostet – was für die Zukunft der Galaxis noch eine ausschlaggebende Rolle spielen soll, wie Eschbach uns in seinem Romanerstling „Die Haarteppichknüpfer“ bereits miterleben ließ.
Sascha Rotermund als Sprecher ist für die neue Vertonung der Eschbach-Klassiker eine feste Größe. An seiner Stimme und Betonung lässt sich nichts aussetzen, es ist durchweg ein angenehmes Hörerlebnis, dem auch die nötige übergreifende Spannung nicht fehlt. Einzig die Namen haben eine eindeutige Anglisierung erhalten, was aufgrund ihrer Schreibweise durchaus im Rahmen des Vorstellbaren liegt, andererseits lässt sich jeder Name – vor allem auch in Anbetracht der zeitlichen Distanz zur Existenz des heutigen Englisch – auch unbedenklich deutsch aussprechen. Die Kürzungen, die aus redaktionellen Gründen anfallen mussten, fallen bei diesem Roman wieder erstaunlich unauffällig aus, und obzwar die vollständige Lektüre natürlich noch eine ganz andere Aussagekraft hat, bietet diese Lesung eine hoch zufrieden stellende und unterhaltende Leistung.
„Quest“ ist mithin einer der besten Romane Eschbachs.
6 Audio-CDs mit 442 Minuten Spieldauer
ISBN: 978-3-7857-4663-9
www.luebbe.de
Der Autor vergibt: