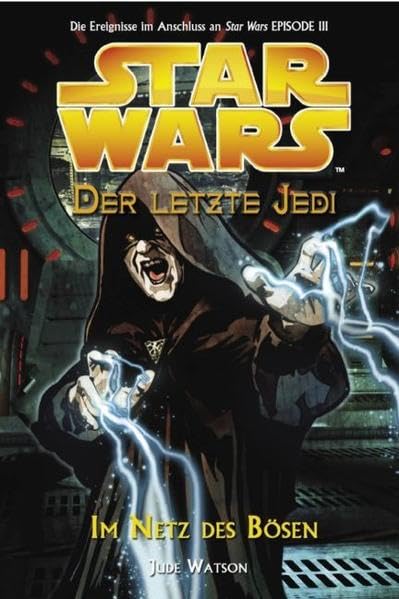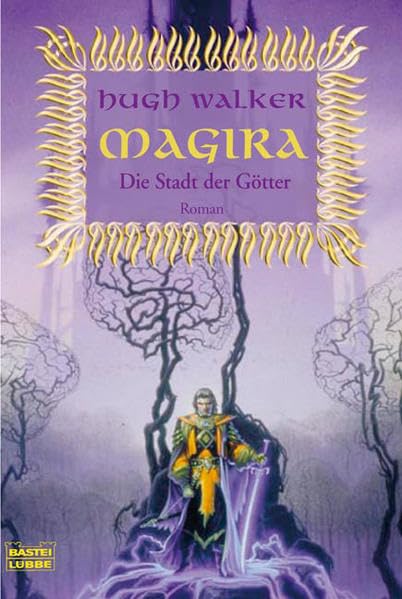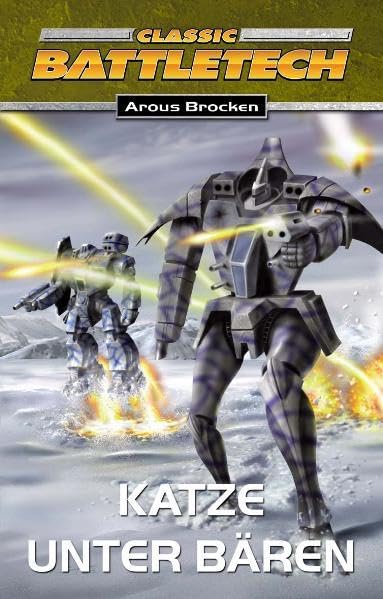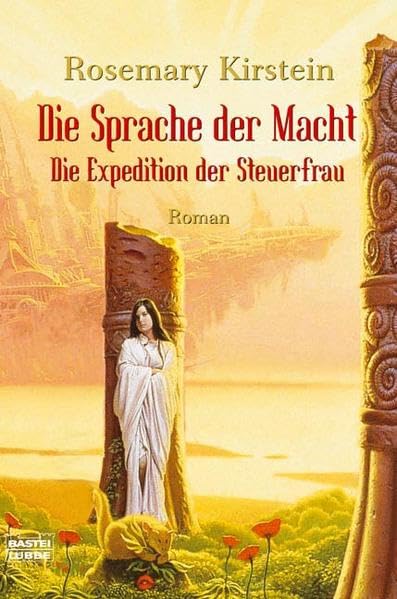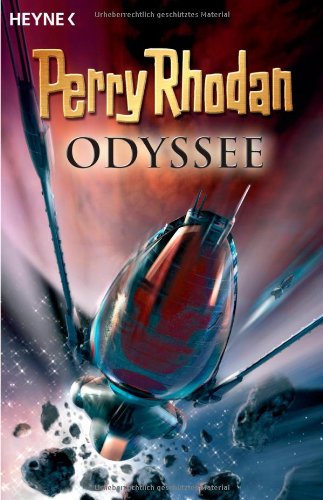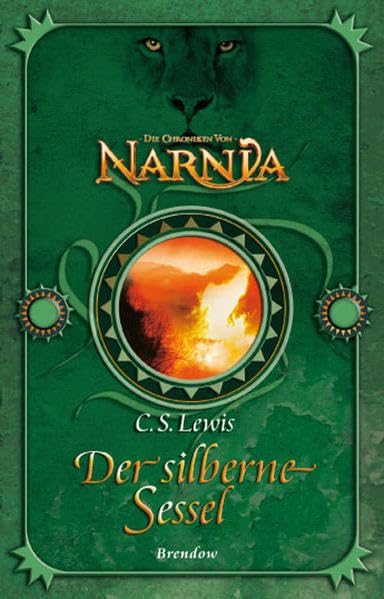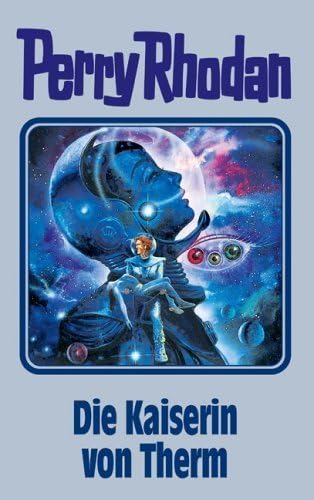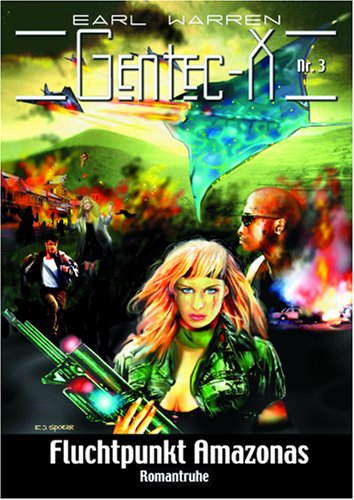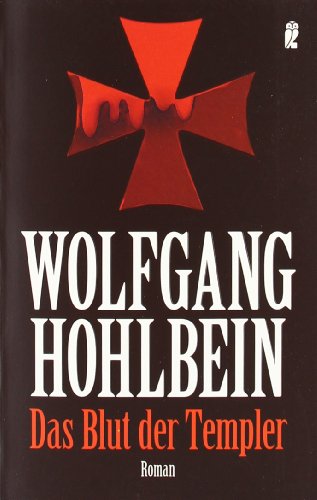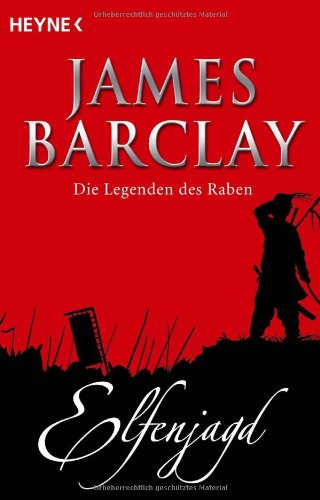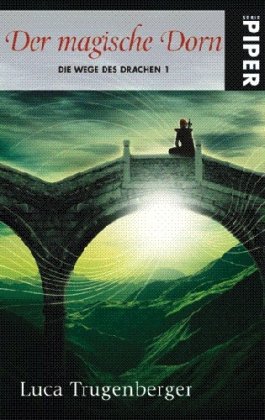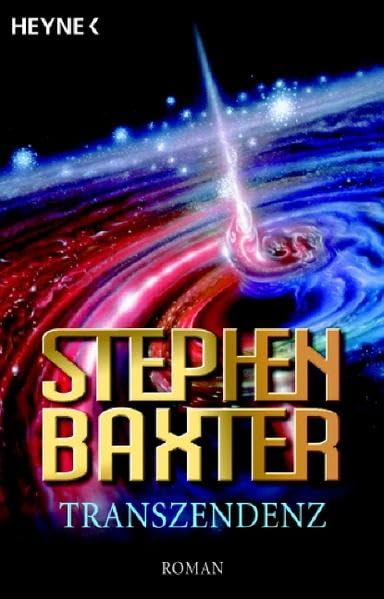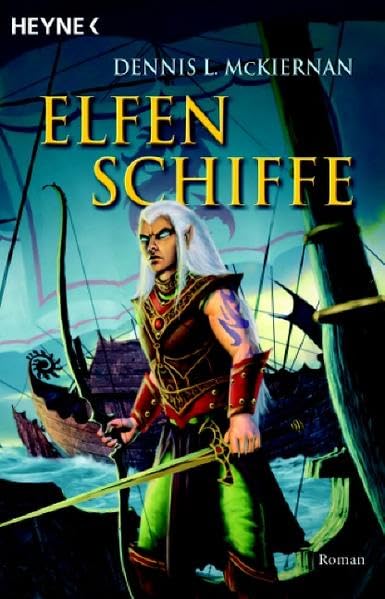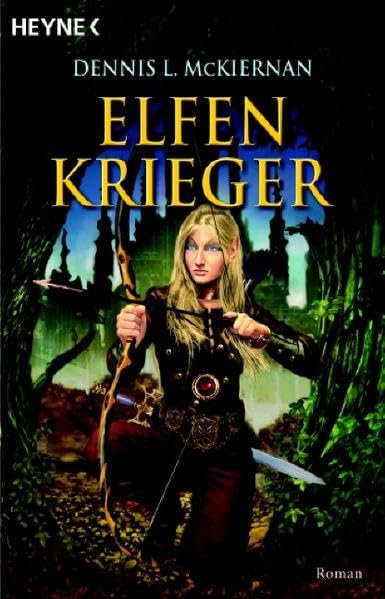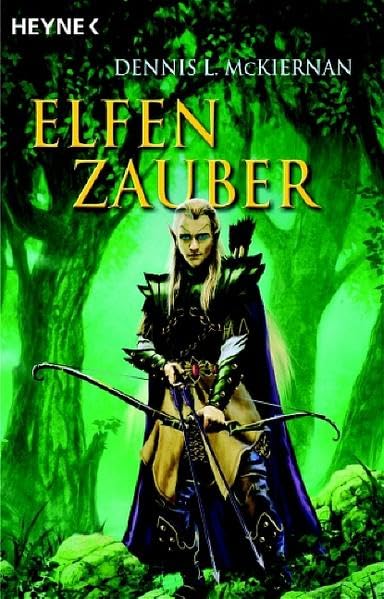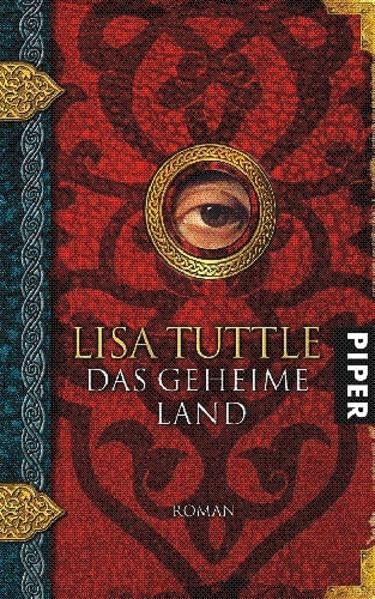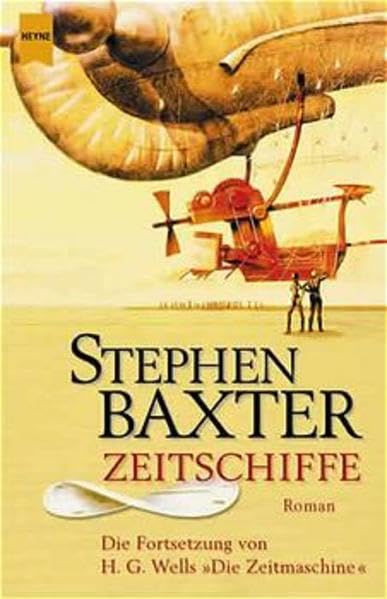_Story_
Kurz nach seiner Flucht aus dem imperialen Gefängnis wird Ferus Olin erneut dem Imperator vorgestellt. Freiwillig folgt er dem Ruf Palpatines und lässt sich von ihm ein unverbindliches Angebot unterbreiten. Er soll die Missstände und das derzeit herrschende Chaos auf dem Planeten Samaria wieder in die rechten Bahnen lenken und damit den Weg für die Machtübernahme des Imperiums freimachen. Ferus lehnt jedoch dankend ab, erkennt aber erst dann die gemeinen Hintergedanken des Imperators: Roan und Dona, beides enge Verbündete Olins, befinden sich ebenfalls in der Gefangenschaft des Imperators und steuern geradewegs auf ihr Todesurteil zu, wenn Ferus die Kooperation ablehnt.
Ferus lässt sich auf den erzwungenen Deal ein und trifft kurze Zeit später Bog Divinian, einen weiteren Mittelsmann des Imperiums, der die Hintergründe des Hacker-Angriffs auf den Planeten untersucht. Skeptisch beäugt, ermittelt der Jedi Olin in den Netzwerken Samarias und findet bald tatsächlich erste Spuren. Als Ferus gemeinsam mit einigen alten Verbündeten die Fährte des Saboteurs aufnimmt, wird ihm jedoch erst klar, dass er in ein großes Netz aus Intrigen und hinterhältigen Machenschaften geraten ist. In seiner Bredouille bleibt ihm nur noch eine Wahl: die Flucht nach vorne …
_Meine Meinung_
„Im Netz des Bösen“ ist bereits der fünfte Roman aus der „Star Wars“-Serie „Der letzte Jedi“ und spielt in der Zeit zwischen den Filmepisoden III und IV. Im Gegensatz zu früheren derartigen Serien steht dieses Mal nicht der junge Anakin Skywalker im Mittelpunkt – dieser hat nämlich inzwischen schon die Position von Darth Vader eingenommen -, sondern ein weiterer junger Jedi namens Ferus Olin, der einst Seite an Seite mit Obi-Wan Kinobi kämpfte, allerdings vorzeitig den Orden der Jedi verließ. Er gehört einer Spezies verborgener Jedis an, die von Teilen des Imperiums bereits lange tot geglaubt sind und besonders Darth Vader im Glauben lassen, er wäre der Letzte seiner Art. Doch weit gefehlt, wie sich im weiteren Verlauf von „Im Netz des Bösen“ noch zeigen soll.
Die Geschichte setzt an dem Punkt an, als Ferus sich auf die Einladung des Imperators einlässt und sein unmoralisches Angebot anhört. Obwohl er im Grunde genommen weiß, dass der Imperator ihn mit Leichtigkeit in eine tödliche Falle locken könnte, folgt er seinem Ruf, weil er auf das Ehrgefühl Palpatines baut. Seine Hoffnung wird auch nicht enttäuscht, doch hätte er eigentlich wissen sollen, dass der erste Mann des Imperiums immer noch Mittel und Wege kennt, um seine offensichtlich unterlegenen Gegner in die Schranken zu weisen. In diesem Fall sind es zwei von Olins besten Freunden, die dieser alleine schon aus Dankbarkeit nicht im Stich lassen kann.
Damit öffnet sich auch erst die eigentliche Geschichte, die einer recht strikt voranschreitenden Handlung folgt, dabei nur wenige überraschende Momente hat und leider auch in vielerlei Hinsicht vorhersehbar scheint. Der Weg von Ferus und seinen Gefährten, die an anderer Stelle für Gerechtigkeit und Freiheit kämpfen, ist im Prinzip schon von Beginn an vorbestimmt, und lediglich die einzelnen unerwartet auftauchenden Personen am Ende des Romans sorgen dafür, dass nicht alles komplett durchsichtig ist. Jeder erwartet insgeheim, dass es dem jungen Jedi und seinen Gefährten gelingen wird, die Schergen des Imperators in die Schranken zu weisen und Vader und Co. zu überlisten, und es ist auch völlig klar, dass Ferus in den wichtigen Eckpunkten der Story die Oberhand haben wird.
Problematisch ist in diesem Sinne auch der sehr geringe Umfang des Romans. Zwar ist das Buch mit 160 Seiten noch halbwegs ausreichend bestückt, doch weil alleine 30 Seiten für Glossar und Werbung draufgehen, bleibt für die Geschichte nur ein ziemlich knapper Rahmen, der erwartungsgemäß auch zu oberflächlichen Darstellungen und wenig Tiefe führt. Inhaltlich ist das Ganze zwar bis zu einem gewissen Punkt interessant, und es ist ja auch eigentlich mal ganz erfrischend, neue Figuren im riesigen „Star Wars“-Universum kennen zu lernen, doch weil es sich hier um einen (sicherlich ungewollten) Kurzabriss handelt und zu keiner Zeit wirklich packende Spannung aufkommt, wird „Im Netz des Bösen“ der mächtigen Überschrift „Star Wars“ definitiv nicht gerecht.
Schauen wir aber mal, wie die Serie sich entwickeln wird, denn dieser Roman ist schließlich nur ein Teil eines größeren Ganzen, der zumindest noch den kleinen Hoffnungsschimmer belässt, dass künftig noch Schwung in „Der letzte Jedi“ hineinkommt. An guten Ideen mangelt es ja schließlich nicht.
http://www.paninicomics.de