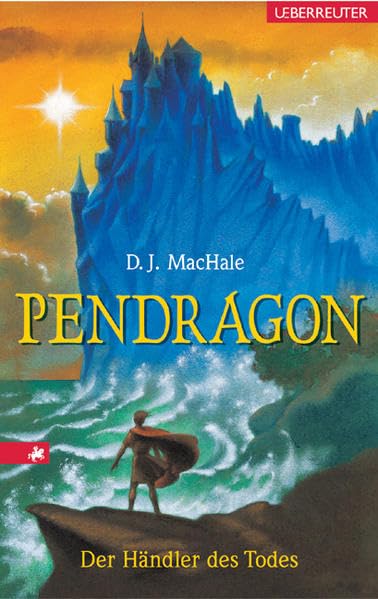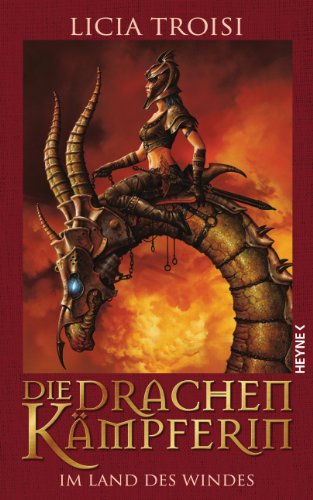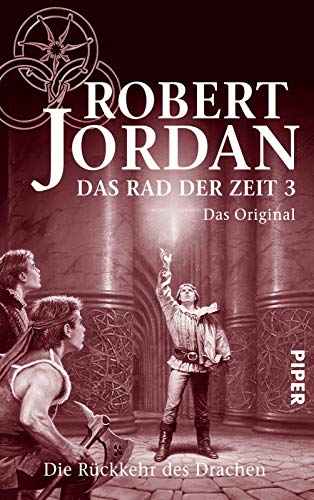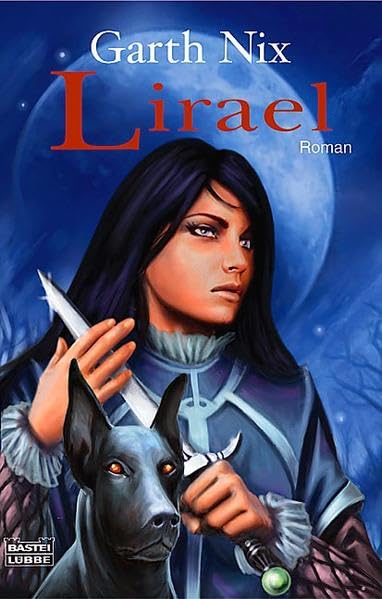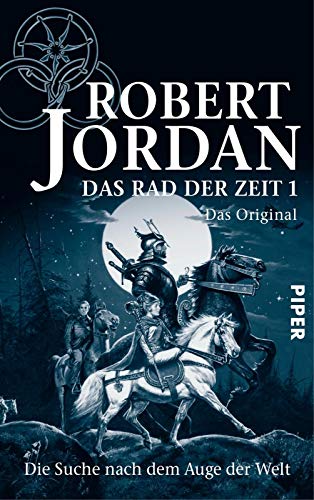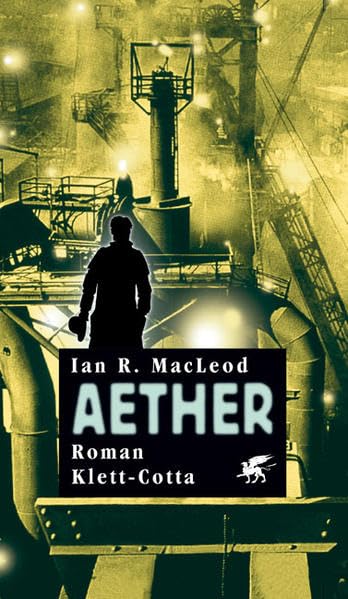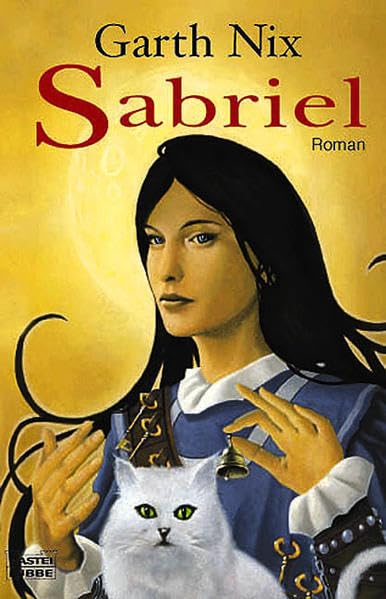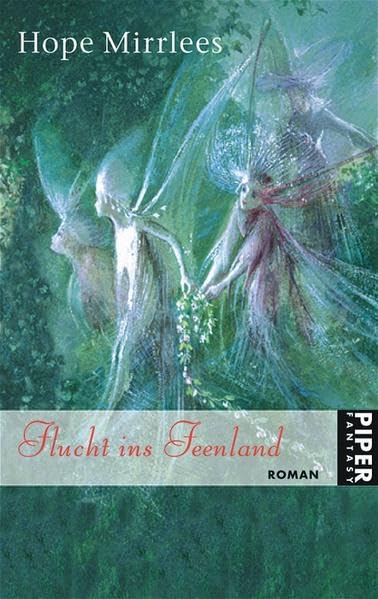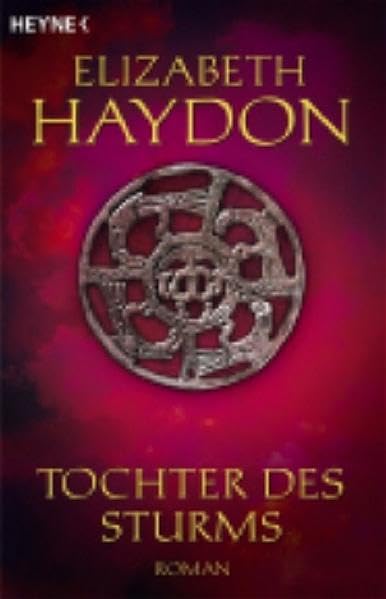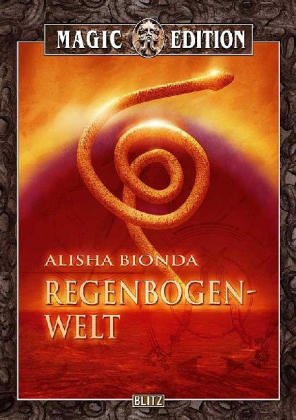Ein Buchrücken, der nicht viel Interessantes verspricht, ein Cover, das wegen der kitschigen Darstellung mehr abschreckt als einlädt, und eine Saga, die sich über ganze sieben Bände erstrecken soll, nach dem Erkunden der Inhaltsangabe aber eher darauf schließen lässt, als echte Serie nicht sonderlich gut geeignet zu sein. Das ist „Pendragon“, eine noch recht frische Fantasy-Serie vom amerikanischen TV-Drehbuchautor D.J. MacHale und laut mehreren Zeugenaussagen die Fantasy der Zukunft. Doch trifft dies wirklich zu?
_Story_
Bobby Pendragon ist der Star der Highschool, und das mit gerade mal 14 Jahren. Und diesen Ruf möchte er in Kürze noch weiter ausbauen, denn im entscheidenden Spiel der schulinternen Basketballmeisterschaft ist er in der ersten Garde des Teams seiner Highschool. Beflügelt durch einen überraschenden Kuss der schönen und beliebten Courtney bereitet er sich im Stillen auf das große Match vor, doch dann wendet sich das Blatt.
Freut sich Bobby anfangs noch über den erneuten Besuch seines Onkels, macht dieser ihm letztendlich einen Strich durch die Rechnung. Er erzählt Bobby von der bedrohten Welt und davon, dass er die einzige Person ist, die das furchtbare Schicksal noch wenden kann. Doch dazu bedarf es sofortigen Handelns und somit auch des Aufgebens seines jetzigen Umfelds. Kein Basketballfinale, keine Courtney, keine Starallüren. Bobby ist jedoch skeptisch und mit der Bitte eines Onkels überhaupt nicht einverstanden.
Erst als sich die beiden in eine verlassene U-Bahn-Station inmitten der New Yorker Bronx begeben und der junge Pendragon Zeuge einer wilden Verfolgungsjagd wird, der sein Onkel als Gefangener zum Opfer fällt, ist Bobby bereit, seiner Berufung zu folgen. Durch ein Wurmloch gerät er schließlich in eine andere Welt, in der er auf weitere Gefährten trifft, die ein ähnliches Schicksal wie er teilen. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach Bobbys Onkel und den geheimnisvollen Rittern, die ihn auf der Erde entführt haben. Doch die eigene Familie ist nicht sein einziges Problem. Ein Krieg steht nämlich unmittelbar bevor, und bevor sich Bobby versieht, muss sich der Teenager der drohenden Vernichtung stellen – und das ohne jegliche Vorahnung …
_Meine Meinung_
Na ja, die Ideen, die D.J. MacHale hier in den Plot einfließen lässt, sind alles andere als neu, geschweige denn in irgendeiner Form innovativ. Ein junger Mann soll als Zeitreisender eine fremde Welt retten und wird von einem Tag auf den nächsten von seinem Schicksal überrannt. Klingt wie der Plot eines kitschigen Hollywood-Streifens und kommt dem eigentlich auch sehr nahe. Kitsch auch deswegen, weil die Statusbeschreibung des Protagonisten anfangs auch an die Einleitung einer zweitklassigen Highschool/Teenie-Geschichte wirkt. Bereits hier merkt man, dass der Autor über fortgeschrittene Erfahrungen aus der Filmbranche verfügt und diese auch flächendeckend einsetzt.
Andererseits ist MacHale aber auch ein toller Erzähler, denn seine Geschichte ist sehr phantasievoll gestaltet und bietet auch genügend Spannung, um den (jugendlichen) Leser von der ersten bis zur letzten Seite bei der Stange zu halten. Schon ab dem Moment, in dem Bobbys Onkel ins Geschehen eingreift und die Welt des beliebten Teenagers durcheinander bringt, gewinnt die Story ordentlich an Fahrt und Vielschichtigkeit, die MacHale indes wieder dazu nutzt, um der Geschichte einen tollen Hintergrund zu verpassen. Die Welt, in der sich Bobby nach seinem Sprung durch Zeit und Raum aufhält, ist dabei das Sahnestück einer farbenfrohen, sehr ausgefüllten Standortbeschreibung, die ganz klar zu den Stärken des Autors zu zählen ist.
Dem gegenüber steht aber leider ein allzu plumper Schreibstil, der in vielen Szenen nicht darüber hinausreicht, immer wieder klarzustellen, wie cool doch alles ist. Bobby erlebt auf seiner Reise so viele verschiedenartige Dinge, doch nur selten gelingt es MacHale auch, diese Ereignisse mit ähnlich atemberaubender Präzision in Szene zu setzen wie die eindrucksvollen Schilderungen der Handlungsschauplätze. Und schon haben wir den nächsten, weitaus schwerwiegenderen Ausflug nach Hollywood entdeckt, dessen Beigeschmack diesmal deutlich fader ist. Manche Dialoge finden zum Beispiel auf einem sprachlich eher minderwertigen Niveau statt und unterstreichen die eingangs erwähnten Kitsch-Anteile von „Pendragon“. Das mag den jüngeren Leser zwar jetzt weniger stören als das anspruchsvolle Fantasy-Publikum, wird aber mit zunehmender Lesedauer doch als störend empfunden.
Große Teile der sprachlichen Defizite kann MacHale dann aber – besonders in der zweiten Hälfte von „Der Händler des Todes“ – durch die relativ souveräne Entwicklung des Inhalts kaschieren. Sobald Bobby Pendragon nämlich seine Überheblichkeit abgelegt hat und sich vom vorbestimmten in einen tatsächlichen Helden verwandelt, beginnt man, sich mit der Hauptfigur zu identifizieren und Sympathien für seinen Charakter zu entwickeln. Gleichzeitig gelingt es dem Leser dann auch, sich durch die oberflächlichen Anfangsdialoge durchzukämpfen und schließlich in die Welt des jungen Reisenden einzutauchen, die nach späteren Erkenntnissen weitaus größer und umfangreicher ist, als man dies zunächst vermuten mag. Und dass MacHale spätestens hier ganze Arbeit geleistet hat, indem er die Spannungskurve linear ansteigen lässt, kann man trotz der anfänglichen und zu Recht geäußerten Bedenken nicht mehr abstreiten.
Diese neue Serie sollte man daher auch in zwei Seiten aufteilen. Auf der einen steht eine spannende, schöne Geschichte, auf der anderen einige Defizite, die in erster Linie mit der auf modern getrimmten, aber nicht gerade der modernen Fantasy-Literatur entsprechenden Sprache zu tun haben. Gerade jüngeren Lesern möchte ich diese neue Reihe aber dennoch empfehlen, denn auf der Suche nach kurzweiliger Unterhaltung (und das beziehe ich zunächst nur auf „Der Händler des Todes“) ist man bei diesem ersten Band genau richtig.